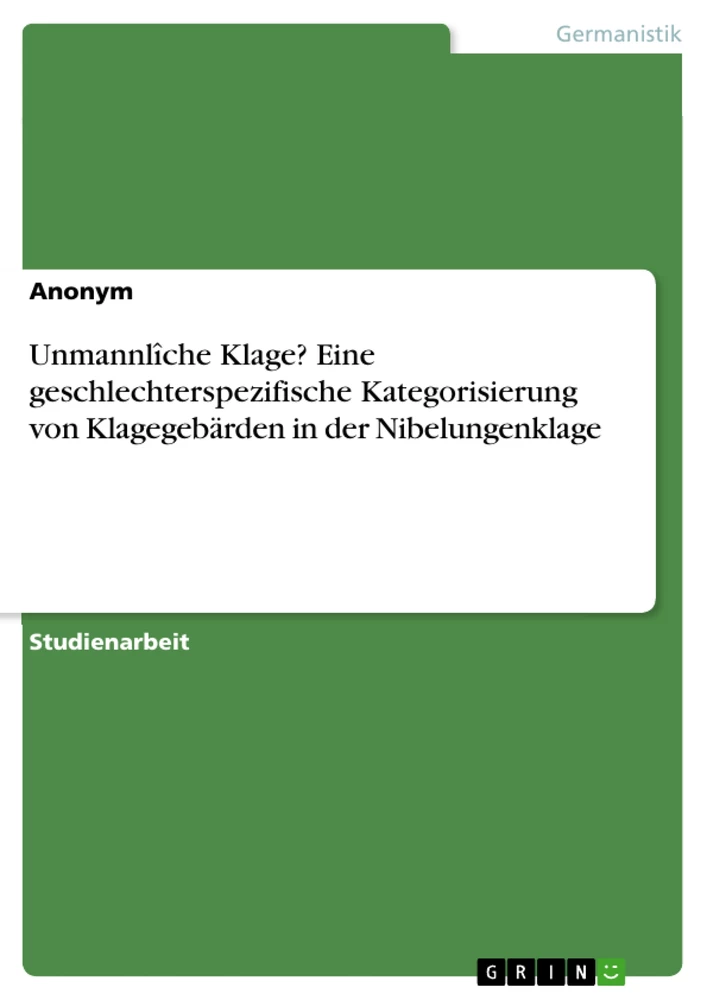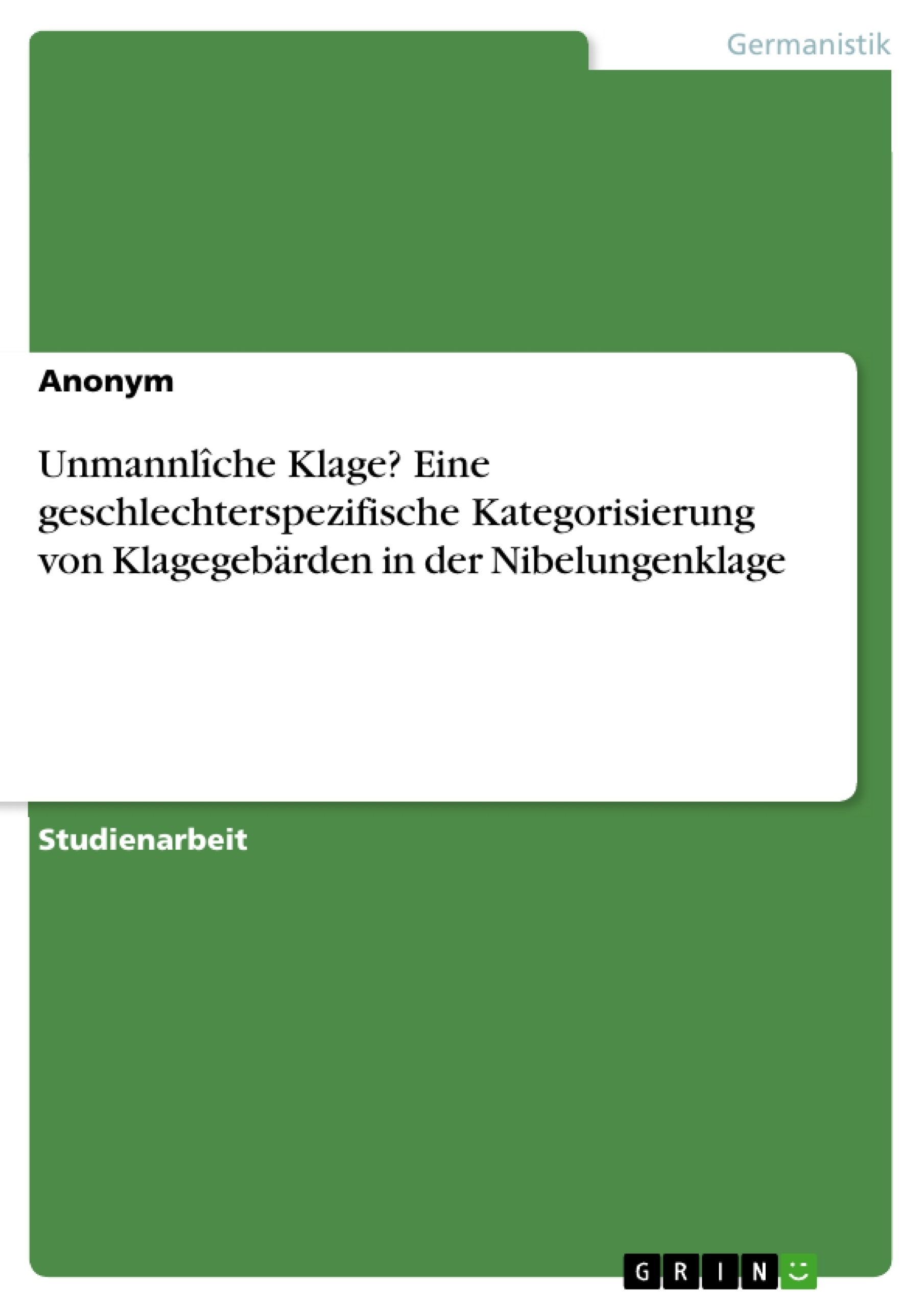Der Anreiz dieser Hausarbeit ist es, durch das Auswerten und Kategorisieren von zahlreichen Klagegebärden eine faktische Beurteilung des Klageverhaltens Etzels treffen zu können. Anhand zahlreicher Verse soll beispielhaft aufgezeigt werden, inwiefern die Norm der Geschlechterrolle in Form des Klage- und Trauerverhaltens von König Etzel eingehalten wird. Bei der Lektüre der Nibelungenklage ist es unabdinglich den Protagonisten am Hunnenhof besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie werden von Dichter und den anderen Figuren in einem besonderen Maße in den Mittelpunkt der Totenklage gehoben. Die Klagegebärden des König Etzels stehen an Ausmaß und Emotionalität weit über allen anderen Figuren und geben dem heutigen Leser vor allen Dingen Rätsel auf. Scheinbar überschreitet der König in seiner unermesslichen Trauer immer wieder die gesellschaftlichen Grenzen der Klage.
„Allen schriftlichen Quellen zufolge trennt das Mittelalter streng zwischen (der Wahrnehmung/Inszenierung von) männlichen und weiblichen Körpern wie den dazugehörigen sozialen Geschlechtsidentitäten. Jeder Versuch der Transgression der Geschlechtergrenzen (sowohl der körperlichen wie der sozialen) wird – außer unter relativ klar definierten Sonderkonditionen – gesellschaftlich sanktioniert.“
Die sozialen Geschlechteridentitäten geben in der mittelalterlichen Literatur einen klar abgesteckten Spielraum für die Figuren vor, in dessen Grenzen ein konventioneller Akteur agieren darf. Verhaltensmuster waren für die damalige Gesellschaft notwendig, denn nur durch sie konnten Stabilität und Ordnung hergestellt werden. Das kalkulierbare Verhalten sicherte einen Austausch von Informationen. Die geschlechterspezifische Kategorisierung von Verhaltensmustern muss demnach auch für das Trauer- und Klageverhalten von literarischen Figuren gegolten haben. Althoff hält dazu fest, dass „(…) auch mittelalterliche Literatur bei ihren Beschreibungen von Kommunikations- und Interaktionsvorgängen nicht ohne Rückgriff aus diese Spielregeln auskommt.“ Zum erleichterten Austausch von Information orientierten sich schon die Dichter des Mittelalters an festgeschriebenen Trauer- und Klagegebärden, dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Dichter ihrer Zeit auch schon mit solchen Regelwerken spielen konnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1 Weibliche Expression der Trauer
- 2.2 Männliche Expression der Trauer
- 3. Klagegebärden Etzels
- 3.1 extra-linguistische Ebene
- 3.2 semi-linguistische Ebene
- 3.3 linguistische Ebene
- 3.4 Interaktionismus des Figureninventars
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Klageverhalten König Etzels in der Nibelungenklage und analysiert es im Kontext mittelalterlicher Geschlechterrollen. Ziel ist es, die Klagegebärden Etzels zu kategorisieren und zu bewerten, um festzustellen, inwieweit er die gesellschaftlichen Normen des Trauerverhaltens einhält.
- Geschlechterspezifische Kategorisierung von Klagegebärden im Mittelalter
- Analyse des Klageverhaltens König Etzels in der Nibelungenklage
- Konflikt zwischen individueller Trauer und gesellschaftlichen Normen
- Rollenverständnis von Trauer und Klage im Mittelalter
- Auswertung extra-, semi- und linguistischer Ebenen der Klage
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die zentrale Rolle König Etzels in der Nibelungenklage. Der scheinbar exzessive Ausdruck seiner Trauer und die Überschreitung gesellschaftlicher Grenzen bilden den Ausgangspunkt der Untersuchung. Die Arbeit zielt darauf ab, durch Kategorisierung der Klagegebärden eine faktische Beurteilung von Etzels Verhalten vorzunehmen und zu analysieren, ob die Norm der Geschlechterrolle in seinem Klage- und Trauerverhalten eingehalten wird. Die Einleitung verweist auf die strenge Trennung männlicher und weiblicher Körper und sozialer Geschlechtsidentitäten im Mittelalter und deren gesellschaftliche Sanktionierung bei Transgressionen. Sie stellt die Notwendigkeit von Verhaltensmustern zur Herstellung von Stabilität und Ordnung in der damaligen Gesellschaft heraus und betont die Relevanz geschlechterspezifischer Kategorisierung auch für Trauer- und Klageverhalten.
2. Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretische Grundlage für die Analyse. Es behandelt die besondere Rolle des Körpers in der mittelalterlichen Literatur bei der Expression von Emotionen und die Herausforderung, die Codierung dieser Gebärden zu entschlüsseln. Das Kapitel fokussiert auf die Kategorisierung männlicher und weiblicher Trauer- und Klagegebärden, um eine Grundlage für die Analyse der Nibelungenklage zu schaffen. Es wird die Schwierigkeit der Gattungszuordnung der Nibelungenklage erwähnt, die Elemente der Totenklage, des Kommentars und der Fortsetzung enthält. Schließlich werden die von Ann Marie Rasmussen definierten drei Modi der Emotionsausprägung (linguistic, semi-linguistic, extra-linguistic) vorgestellt, die als Analyseinstrument für die Untersuchung der Klagegebärden dienen.
3. Klagegebärden Etzels: Dieses Kapitel analysiert die Klagegebärden Etzels auf den drei Ebenen (extra-linguistisch, semi-linguistisch, linguistisch) und im Kontext des Interaktionismus des Figureninventars. Es untersucht die konkreten Ausdrucksformen des Königs und setzt sie in Beziehung zur Norm der Geschlechterrolle im Mittelalter. Die Zusammenfassung berücksichtigt die unterschiedlichen Ausdrucksformen der Trauer auf den drei Ebenen, die im Detail im Originaltext beschrieben sind. Die Analyse der Interaktionen Etzels mit anderen Figuren und deren Einfluss auf sein Klageverhalten bilden einen weiteren Schwerpunkt.
Schlüsselwörter
Nibelungenklage, König Etzel, Klagegebärden, Geschlechterrollen, Mittelalter, Trauerverhalten, extra-linguistische Ebene, semi-linguistische Ebene, linguistische Ebene, Emotion, Gesellschaftliche Normen, Literaturanalyse.
Nibelungenklage: König Etzels Klageverhalten - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert das Klageverhalten König Etzels in der Nibelungenklage. Der Fokus liegt auf der Kategorisierung und Bewertung seiner Klagegebärden im Kontext der mittelalterlichen Geschlechterrollen. Es wird untersucht, inwieweit Etzels Trauerverhalten den gesellschaftlichen Normen entspricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt geschlechterspezifische Kategorisierung von Klagegebärden im Mittelalter, die Analyse von Etzels Klageverhalten in der Nibelungenklage, den Konflikt zwischen individueller Trauer und gesellschaftlichen Normen, das Rollenverständnis von Trauer und Klage im Mittelalter und die Auswertung extra-, semi- und linguistischer Ebenen der Klage.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: einer Einleitung, einem Theoriekapitel, einem Kapitel zur Analyse der Klagegebärden Etzels und einem Resümee. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung. Das Theoriekapitel legt die theoretische Grundlage dar, insbesondere die Kategorisierung männlicher und weiblicher Traueräußerungen. Das dritte Kapitel analysiert Etzels Klageverhalten auf drei Ebenen (extra-, semi- und linguistisch) und im Kontext der Interaktionen mit anderen Figuren. Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analysemethode. Die Klagegebärden Etzels werden auf drei Ebenen untersucht: extra-linguistisch (körperliche Gesten), semi-linguistisch (Paraverbale Elemente) und linguistisch (sprachliche Äußerungen). Das analytische Instrumentarium stützt sich auf die von Ann Marie Rasmussen definierten Modi der Emotionsausprägung. Die Analyse betrachtet auch den Interaktionismus zwischen Etzel und anderen Figuren.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine faktische Beurteilung von Etzels Klageverhalten vorzunehmen und zu analysieren, ob er die Norm der Geschlechterrolle in seinem Trauerverhalten einhält. Die Analyse soll Aufschluss darüber geben, wie sich individuelle Trauer im Kontext gesellschaftlicher Normen des Mittelalters manifestiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Nibelungenklage, König Etzel, Klagegebärden, Geschlechterrollen, Mittelalter, Trauerverhalten, extra-linguistische Ebene, semi-linguistische Ebene, linguistische Ebene, Emotion, Gesellschaftliche Normen, Literaturanalyse.
Wie wird die Trauer im Mittelalter dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Trauer im Mittelalter unter Berücksichtigung der strengen Trennung männlicher und weiblicher Körper und sozialer Geschlechtsidentitäten. Sie beleuchtet die gesellschaftliche Sanktionierung von Transgressionen dieser Normen und die Relevanz geschlechterspezifischer Kategorisierung für Trauer- und Klageverhalten.
Welche Rolle spielt der Körper in der mittelalterlichen Literatur?
Der Körper spielt eine besondere Rolle in der mittelalterlichen Literatur bei der Expression von Emotionen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entschlüsselung der Codierung dieser Gebärden, insbesondere im Kontext von Trauer und Klage.
Welche Bedeutung hat die Nibelungenklage für diese Studie?
Die Nibelungenklage bildet den primären Textkorpus für die Analyse. König Etzels Klageverhalten und die Interaktionen mit anderen Figuren im Kontext der Erzählung bilden die Grundlage der Untersuchung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Unmannlîche Klage? Eine geschlechterspezifische Kategorisierung von Klagegebärden in der Nibelungenklage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1142414