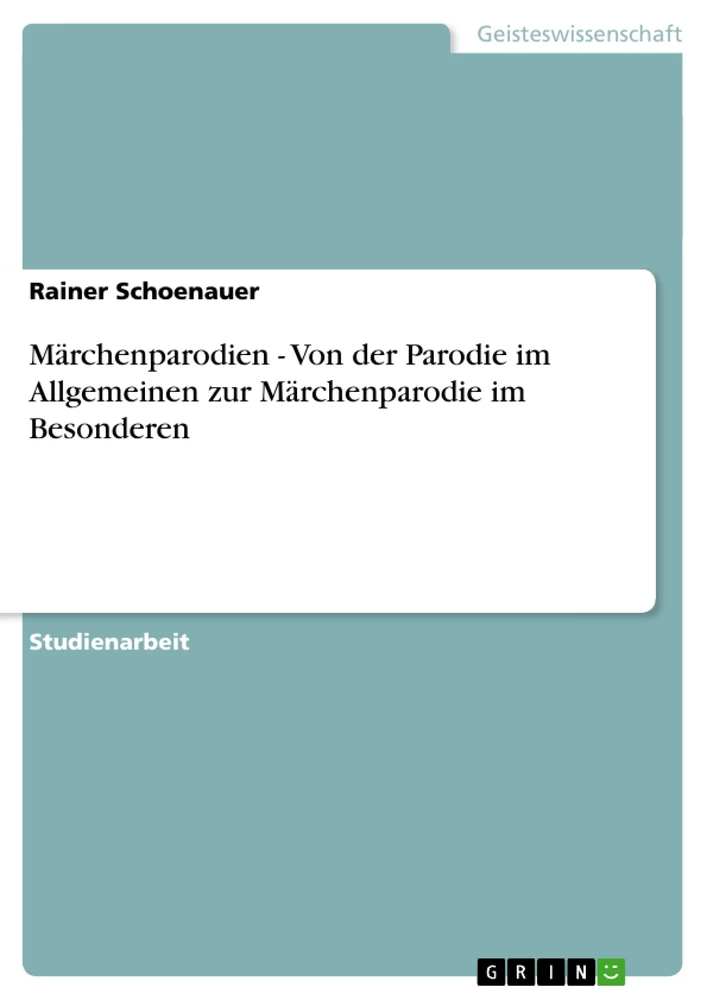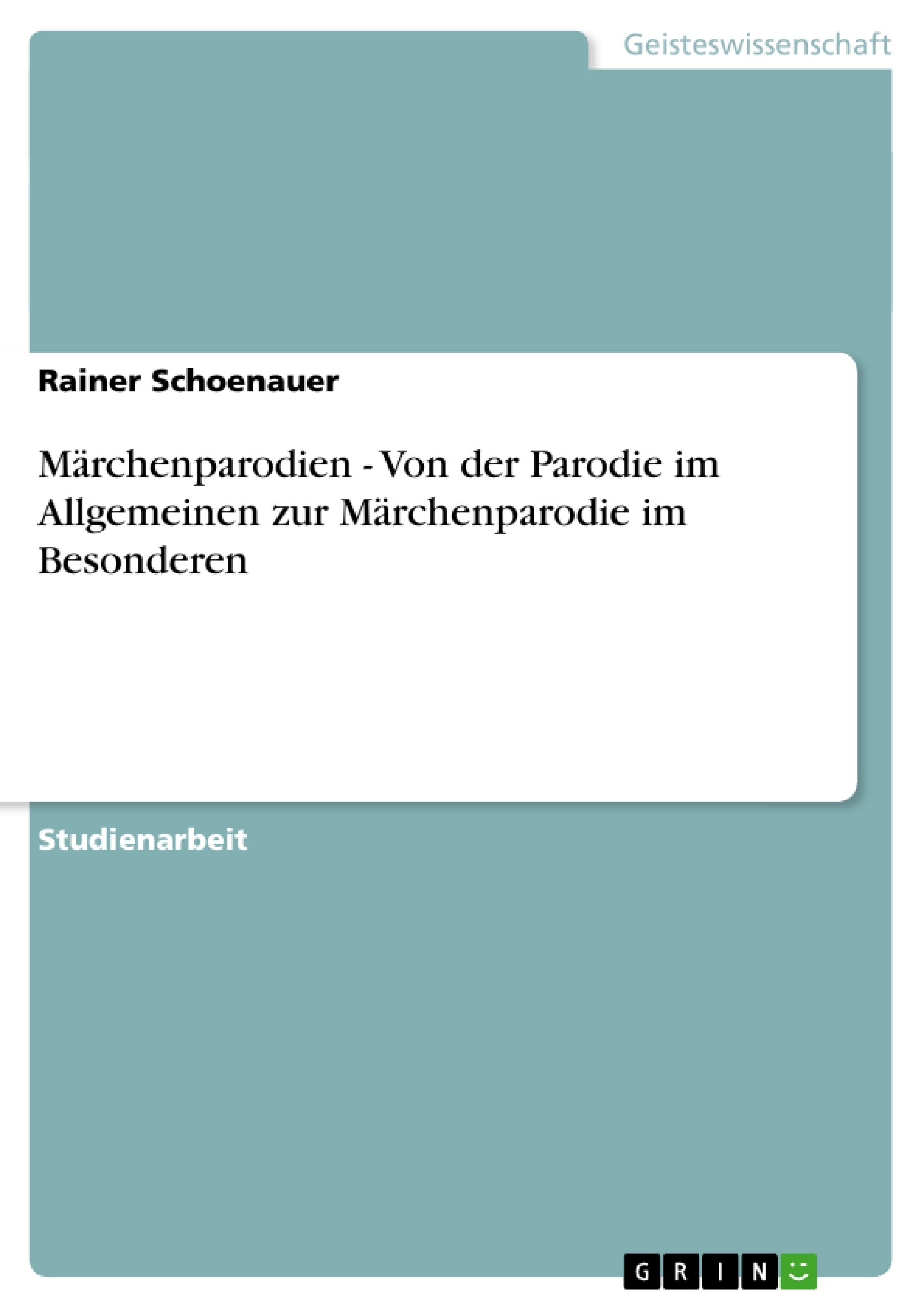So reich die Quellen für Märchenparodien sprudeln, so ärmlich dümpelt die Literatur, die sich mit ihnen beschäftigt dahin. (...)
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vieles andere trivial und unbrauchbar ist, von der verwirrenden Komplexität seiner Ausführungen ganz zu schweigen. Viele Autoren begnügen sich damit, Definitionen und Meinungen anderer Wissenschaftler zu zitieren, aneinander zu reihen und kurz zu erläutern. „Wer soll eigentlich diesen ganzen Wust lesen, den der wildgewordene Wissenschaftsbetrieb Jahr für Jahr unten herauslässt?“4. So schreibt Hans Ritz etwas salopp über wissenschaftliche Publikationen und wenn dies auch übertrieben sein mag, so muss man doch sagen, dass es nicht immer einfach war aus dem vielen Material das Richtige und Nützliche heraus zu filtern. Deswegen beruht vieles in dieser Arbeit auf eigener Gedankenleistung und folgt eigenen Überlegungen, getreu Kants Devise „sapere aude“ („Habe Mut dich deines Verstandes zu bedienen!“). Nicht allein weil die Literatur recht unbefriedigend war und das Thema „Märchenparodie“ entweder gar nicht oder nur kurz am Rande erwähnt wurde, sondern auch weil ich mit „Onkel Hotte“, „Shrek“, der „Märchenstunde“ und den anderen Märchenparodien, Beispiele gewählt habe, die literarisch noch nicht aufgearbeitet wurden.
Zunächst werde ich versuchen den Begriff der Parodie sowohl nach antikem, wie auch nach neuzeitlichem Verständnis zu definieren (2. Kapitel). Das dritte Kapitel beschäftigt sich dann mit einem Kommunikationsmodell der Parodie nach Wolfgang Karrer und entwickelt daraus ein genaueres Modell. Die darauf folgenden drei Kapitel setzen sich dann mit dem Typ der Märchenparodie näher auseinander, wobei sich jeweils ein Kapitel der Vorlage und darauf bezogenen Eigenschaften (Kapitel 4), ein Kapitel den Veränderungsmöglichkeiten (Kapitel 5) und eines der Intention widmen (Kapitel 6), die sich grob in Kritik, Unterhaltung und das eigenständige Werk unterteilt. Das siebte Kapitel schließlich befasst sich mit der Frage, ob Märchenparodien überhaupt literarisch und gesellschaftlich wertvoll sind. Dabei ist dieser Teil weniger eine Diskussion der Pros und Kontras, sondern vielmehr ein Plädoyer für Sinn und Wert von Parodien im Allgemeinen und der Märchenparodie im Besonderen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition der Parodie
- 2.1 Antikes Parodienverständnis
- 2.2 Neuzeitliches Parodienverständnis
- 3. Kommunikationsmodelle der Parodie
- 3.1 Karrers Kommunikationsmodell
- 3.2 Neues Kommunikationsmodell
- 4. Vorlage
- 4.1 Bekanntheitsgrad der Märchen
- 4.2 Offenheit des Inhalts
- 4.3 Kritik am Märchen
- 5. Veränderungsmöglichkeiten
- 5.1 Kombination von Genres und Motiven
- 5.2 Umkehrung
- 6. Intention
- 6.1 Kritik
- 6.1.1 Kritik an Werk und/oder Autor
- 6.1.2 Kritik an gesellschaftlichen Faktoren
- 6.1.3 Kritik an der Märcheninterpretation
- 6.2 Unterhaltung
- 6.3 Das selbstständige Werk
- 7. Der Wert der Märchenparodien
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Märchenparodie, insbesondere im Kontext neuerer audiovisueller Medien und Literatur. Ziel ist es, den Begriff der Parodie zu definieren und ein Kommunikationsmodell zu entwickeln, um anschließend die spezifischen Merkmale von Märchenparodien zu analysieren.
- Definition und Entwicklung des Parodiebegriffs
- Kommunikationsmodelle der Parodie
- Analyse der Vorlagen und ihrer Eigenschaften
- Untersuchung der Veränderungsmöglichkeiten in Märchenparodien
- Erforschung der Intentionen hinter Märchenparodien (Kritik, Unterhaltung, eigenständiges Werk)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Märchenparodien ein und stellt den aktuellen Boom dieser Gattung in verschiedenen Medien dar, von Radio und Fernsehen bis hin zum Internet. Sie betont den Mangel an wissenschaftlicher Literatur zu diesem Thema und kündigt den Aufbau der Arbeit an, der sich sowohl auf neuere Texte als auch auf audiovisuelle Medien konzentriert.
2. Definition der Parodie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Parodie", indem es das antike und das neuzeitliche Verständnis gegenüberstellt und erläutert. Es untersucht die etymologischen Wurzeln des Wortes und die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Präfixes "para".
3. Kommunikationsmodelle der Parodie: Hier wird das Kommunikationsmodell von Wolfgang Karrer vorgestellt und auf dessen Basis ein präziseres Modell entwickelt, um die Kommunikationsprozesse in Parodien besser zu verstehen und zu analysieren.
4. Vorlage: Dieses Kapitel analysiert die Eigenschaften der Vorlagen, also der ursprünglichen Märchen, die parodiert werden. Es untersucht den Bekanntheitsgrad der Märchen, die Offenheit ihres Inhalts und die Möglichkeiten, diese für eine Parodie zu kritisieren.
5. Veränderungsmöglichkeiten: Hier werden die verschiedenen Möglichkeiten der Veränderung und Adaption von Märchen in Parodien untersucht. Es werden insbesondere die Kombination von Genres und Motiven sowie die Umkehrung von Elementen und Rollen betrachtet.
6. Intention: Dieses Kapitel widmet sich den Intentionen hinter der Schöpfung von Märchenparodien. Es unterscheidet dabei grob zwischen Kritik (an Werken, Autoren, gesellschaftlichen Faktoren und Interpretationen), Unterhaltung und dem Anspruch, ein eigenständiges Werk zu schaffen.
7. Der Wert der Märchenparodien: Das siebte Kapitel argumentiert für den literarischen und gesellschaftlichen Wert von Märchenparodien. Es ist weniger eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen, sondern ein Plädoyer für den Sinn und Wert der Parodie im Allgemeinen und der Märchenparodie im Besonderen.
Schlüsselwörter
Märchenparodie, Parodie, Kommunikationsmodell, Märchen der Brüder Grimm, audiovisuelle Medien, Kritik, Unterhaltung, literarischer Wert, gesellschaftlicher Wert, Oliver Kalkofe, Shrek, "7 Zwerge", "Märchenstunde" (ProSieben).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Märchenparodien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Märchenparodie, insbesondere in neueren audiovisuellen Medien und Literatur. Sie analysiert Märchenparodien umfassend, von der Definition des Begriffs Parodie über Kommunikationsmodelle bis hin zur Intention und zum Wert dieser Gattung.
Welche Aspekte der Märchenparodie werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte: Definition und Entwicklung des Parodiebegriffs, Kommunikationsmodelle, Analyse der Vorlagen (Märchen), Veränderungsmöglichkeiten in Parodien, Intentionen (Kritik, Unterhaltung, eigenständiges Werk), und schließlich den literarischen und gesellschaftlichen Wert von Märchenparodien.
Wie wird der Begriff "Parodie" definiert?
Die Arbeit vergleicht das antike und neuzeitliche Verständnis von Parodie, untersucht die etymologischen Wurzeln und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Präfixes "para". Es wird ein präziseres Kommunikationsmodell entwickelt, um die Kommunikationsprozesse in Parodien besser zu verstehen.
Welche Kommunikationsmodelle werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert das Kommunikationsmodell von Wolfgang Karrer und entwickelt darauf aufbauend ein eigenes, präziseres Modell, um die Kommunikation in Parodien zu analysieren.
Welche Eigenschaften der Märchenvorlagen werden analysiert?
Die Analyse der Vorlagen umfasst den Bekanntheitsgrad der Märchen, die Offenheit ihres Inhalts und die Möglichkeiten, sie in einer Parodie zu kritisieren.
Welche Veränderungsmöglichkeiten in Märchenparodien werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Kombination von Genres und Motiven sowie die Umkehrung von Elementen und Rollen als wesentliche Veränderungsmöglichkeiten in Märchenparodien.
Welche Intentionen stecken hinter Märchenparodien?
Die Arbeit unterscheidet zwischen verschiedenen Intentionen: Kritik (an Werken, Autoren, gesellschaftlichen Faktoren und Interpretationen), Unterhaltung und dem Anspruch, ein eigenständiges Werk zu schaffen.
Welchen Wert haben Märchenparodien laut der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert für den literarischen und gesellschaftlichen Wert von Märchenparodien. Es wird ein Plädoyer für den Sinn und Wert der Parodie im Allgemeinen und der Märchenparodie im Besonderen gehalten.
Welche Beispiele für Märchenparodien werden genannt?
Die Arbeit nennt Beispiele wie Oliver Kalkofe, Shrek, "7 Zwerge" und "Märchenstunde" (ProSieben) als Beispiele für Märchenparodien in audiovisuellen Medien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition der Parodie, Kommunikationsmodelle der Parodie, Vorlage, Veränderungsmöglichkeiten, Intention, Der Wert der Märchenparodien und Zusammenfassung.
- Quote paper
- Rainer Schoenauer (Author), 2007, Märchenparodien - Von der Parodie im Allgemeinen zur Märchenparodie im Besonderen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114208