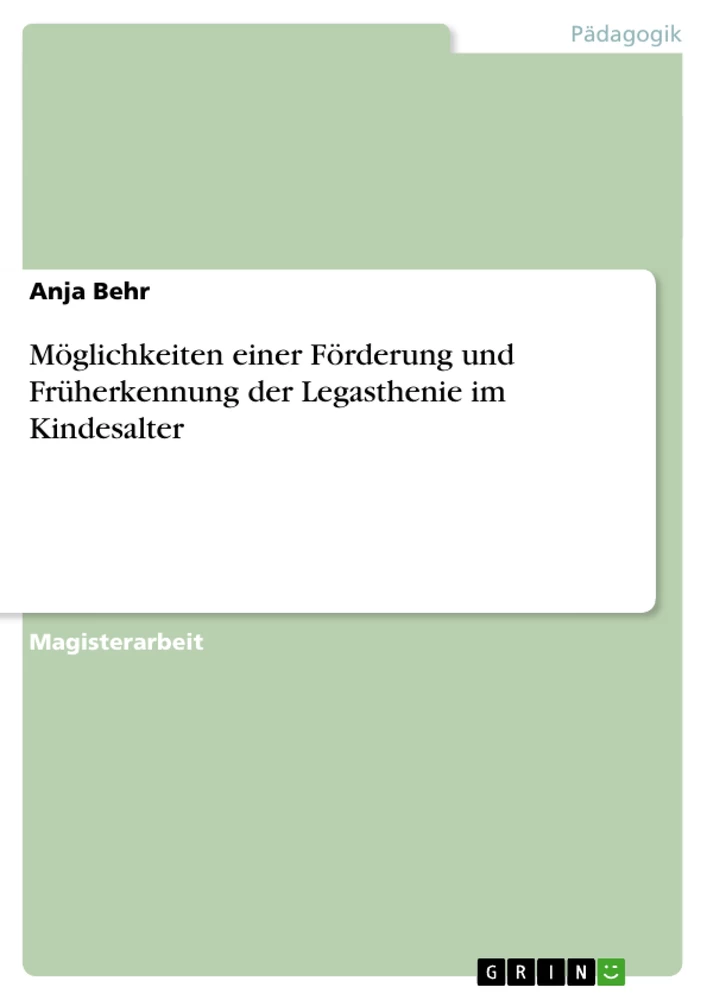John F. Kennedy (1917-1963) – 35. Präsident der Vereinigten Staaten, Winston Churchill (1874-1965) – ehem. Premierminister von Großbritannien und Nobepreisträger, Albert Einstein (1879-1955) – Physiker und Nobelpreisträger, Charles Darwin (1809-1882) – britischer Naturwissenschaftler, Leonardo da Vinci (1452-1519) – Maler, Bildhauer, Architekt, Walt Disney (1901-1966) – amerikanischer Filmproduzent, Jackie Stewart (geb. 1939) – ehem. britischer Rennfahrer, Cher (geb. 1946) – amerikanische Sängerin und Schauspielerin, Tom Cruise (geb. 1962) – amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent, Reinhard Mey (geb. 1942) – deutscher Liedermacher,...
Immer mehr hört man heutzutage: Mein Kind hat Legasthenie! Was aber heißt das genau? Legasthenie ist keine Modeerscheinung, sondern eine medizinisch nachweisbare Teilleistungsstörung im Bereich der Sprachverarbeitung, die auch negative Auswirkungen auf das Leben des Kindes haben kann. Wie sehr einige Kinder unter der Störung leiden, zeigt die obige Strophe aus dem Lied „Der unendliche Tango der deutschen Rechtschreibung“ von Reinhard Mey, der in diesem Lied beschreibt, wie er sich damals als Kind gefühlt hat (vgl. http://www.reinhard-mey.de). Oft besitzen die Lehrer nicht die nötigen Qualifikationen, erkennen die Legasthenie zu spät oder gar nicht und stempeln die betroffenen Kinder als dumm oder faul ab, was zu schweren psychischen Schäden führen kann. Wichtig ist deshalb eine frühe Diagnose und Förderung, denn legasthene Kinder sind nicht dumm oder faul, im Gegenteil, oft sind sie sogar hochintelligent und auf ganz unterschiedlichen Gebieten sehr begabt. Haben sie ihre Ausbildung erfolgreich absolviert, findet man unter ihnen nicht selten Rechtsanwälte, Ärzte oder Ingenieure. Wie man auch bei den aufgezählten berühmten Persönlichkeiten sieht, liegen ihre Begabungen oft im sportlichen, kreativen oder technischen Bereich. Wie eine frühe Diagnostik und Förderung aussehen kann, soll im Rahmen dieser Arbeit erörtert werden. Ehe im vierten Kapitel die diagnostische Vorgehensweise und im fünften Kapitel die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten ausführlich dargestellt werden, wird im ersten Kapitel erläutert, was man genau unter Legasthenie versteht und seit wann man sich mit diesem Phänomen beschäftigt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Was heißt Legasthenie?
- 1.2 Historischer Rückblick
- 2. Ursachen der Legasthenie
- 2.1 Genetische Erklärungsansätze
- 2.2 Neurobiologische Erklärungsansätze
- 2.3 Weitere Erklärungsansätze
- 3. Symptome der Legasthenie und ihre Auswirkungen
- 3.1 Die Primärsymptomatik
- 3.2 Auswirkungen der Legasthenie auf die psycho-soziale Lage
- 3.2.1 Primäre und sekundäre Komorbidität
- 3.2.2 Prognose für die schulische, berufliche und soziale Entwicklung
- 3.2.3 Spätlegasthenie und funktionaler Analphabetismus
- 4. Förder- und Differentialdiagnostik
- 4.1 Die Relevanz der Anamnese
- 4.2 Testdiagnostische Verfahren
- 4.2.1 Basisdiagnostik
- 4.2.1.1 Verfahren zur Diagnostik der Rechtschreibstörung
- 4.2.1.2 Verfahren zur Diagnostik der Lesestörung
- 4.2.2 Zusatzdiagnostik
- 4.2.2.1 Intelligenztests
- 4.2.2.2 Untersuchung der Sprachentwicklung
- 4.2.2.3 Untersuchung der motorischen Entwicklung
- 4.2.2.4 Verfahren zur Überprüfung der Aufmerksamkeit
- 4.2.2.5 Verfahren zur Erfassung von emotionalen und Verhaltensproblemen
- 4.3 Integration aller Ergebnisse
- 5. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Förderung
- 5.1 Schulische Förderung
- 5.1.1 Die Erlasse und Richtlinien der Bundesländer
- 5.1.2 Organisation und Gestaltung des Förderunterrichts
- 5.1.3 Selbsthilfe durch die Eltern
- 5.1.4 Die Hausaufgabensituation
- 5.2 Außerschulische Förderung
- 5.2.1 Woran erkennt man eine gute Therapie?
- 5.2.2 Beispiele für Förderprogramme
- 5.2.2.1 Der Kieler Lese- und Rechtschreibaufbau nach Dummer-Smoch und Hackethal (2002, 2001)
- 5.2.2.2 Die Lautgetreue Rechtschreibförderung nach Reuter-Liehr (1992)
- 5.2.2.3 Das Marburger Rechtschreibtraining nach Schulte-Körne und Mathwig (2001)
- 5.2.3 Computerprogramme
- 5.3 Sozialrechtliche Hilfen
- 6. Legasthenie, Gesellschaft und Schule – Prävention der Legasthenie
- 6.1 Früherkennung von Risikokindern
- 6.2 Frühförderung als Prävention
- 6.3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Möglichkeiten der Förderung und Früherkennung von Legasthenie im Kindesalter. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Ursachen, Symptome, Diagnostik und Fördermöglichkeiten von Legasthenie zu geben und die Bedeutung der Prävention zu betonen.
- Definition und historische Entwicklung von Legasthenie
- Ursachen und Erklärungsansätze für Legasthenie (genetisch, neurobiologisch, etc.)
- Symptome und Auswirkungen von Legasthenie auf die psycho-soziale Entwicklung
- Diagnostik und verschiedene Fördermethoden (schulisch und außerschulisch)
- Früherkennung und Prävention von Legasthenie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel definiert den Begriff Legasthenie und beleuchtet deren historische Entwicklung. Es werden berühmte Persönlichkeiten genannt, die trotz Legasthenie große Erfolge erzielt haben, um das Vorurteil der "Dummheit" zu entkräften und die Wichtigkeit frühzeitiger Diagnose und Förderung hervorzuheben.
2. Ursachen der Legasthenie: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für das Entstehen von Legasthenie. Es werden genetische Faktoren, neurobiologische Aspekte und weitere mögliche Ursachen detailliert analysiert, um ein umfassendes Bild der komplexen Ätiologie dieser Lese-Rechtschreibstörung zu liefern. Die verschiedenen Theorien werden kritisch beleuchtet und in Bezug zueinander gesetzt.
3. Symptome der Legasthenie und ihre Auswirkungen: Hier werden die primären Symptome von Legasthenie beschrieben und ihre weitreichenden Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung des Kindes beleuchtet. Es wird zwischen primärer und sekundärer Komorbidität differenziert und die langfristige Prognose für die schulische, berufliche und soziale Entwicklung thematisiert. Der Begriff der Spätlegasthenie und des funktionalen Analphabetismus wird ebenfalls erklärt und eingeordnet.
4. Förder- und Differentialdiagnostik: Dieses Kapitel widmet sich der wichtigen Thematik der Diagnostik von Legasthenie. Die Bedeutung der Anamnese wird hervorgehoben, und verschiedene testdiagnostische Verfahren, sowohl Basis- als auch Zusatzdiagnostik (Intelligenztests, Sprachentwicklungsuntersuchungen, etc.), werden detailliert beschrieben. Der Prozess der Integration aller diagnostischen Ergebnisse wird erläutert.
5. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Förderung: Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über verschiedene Fördermöglichkeiten für Kinder mit Legasthenie, sowohl im schulischen als auch außerschulischen Bereich. Es werden Beispiele für Förderprogramme und computergestützte Programme vorgestellt und die Rolle der Eltern und sozialrechtliche Hilfen erörtert. Die Bedeutung der Organisation und Gestaltung des Förderunterrichts wird ebenso beleuchtet wie die Problematik der Hausaufgabensituation für betroffene Kinder.
6. Legasthenie, Gesellschaft und Schule – Prävention der Legasthenie: Das Kapitel konzentriert sich auf die Prävention von Legasthenie. Es beleuchtet die Früherkennung von Risikokindern und die Bedeutung der Frühförderung als präventive Maßnahme. Die Zusammenfassung dieses Kapitels betont die Notwendigkeit von frühzeitigen Interventionen zur Vermeidung langfristiger negativer Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung, Früherkennung, Förderung, Diagnostik, Prävention, Schulische Förderung, Außerschulische Förderung, Neurobiologie, Genetik, Psycho-soziale Auswirkungen, Komorbidität, Differentialdiagnostik, Risikokinder, Frühförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Förderung und Früherkennung von Legasthenie
Was ist der Inhalt dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Legasthenie, von der Definition und historischen Entwicklung bis hin zu Ursachen, Symptomen, Diagnostik, Fördermöglichkeiten und Prävention. Sie beleuchtet genetische und neurobiologische Aspekte, beschreibt verschiedene Förderprogramme (schulisch und außerschulisch) und betont die Wichtigkeit der Früherkennung und Frühförderung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und historische Entwicklung von Legasthenie; Ursachen (genetische, neurobiologische und weitere Erklärungsansätze); Symptome und deren Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung; Differentialdiagnostik und verschiedene Fördermethoden (inkl. Basis- und Zusatzdiagnostik); schulische und außerschulische Fördermöglichkeiten (mit konkreten Beispielen von Förderprogrammen); Früherkennung und Prävention von Legasthenie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (Definition und historischer Überblick); Ursachen der Legasthenie; Symptome und deren Auswirkungen; Förder- und Differentialdiagnostik; verschiedene Fördermöglichkeiten (schulisch und außerschulisch); Legasthenie, Gesellschaft und Schule – Prävention. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Welche Ursachen für Legasthenie werden untersucht?
Die Arbeit untersucht genetische Faktoren, neurobiologische Aspekte und weitere mögliche Ursachen für Legasthenie. Die verschiedenen Theorien werden kritisch beleuchtet und in Bezug zueinander gesetzt, um ein umfassendes Bild der komplexen Ätiologie zu liefern.
Welche Symptome von Legasthenie werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die primären Symptome von Legasthenie und deren Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung. Es wird zwischen primärer und sekundärer Komorbidität differenziert und die langfristige Prognose für die schulische, berufliche und soziale Entwicklung thematisiert. Spätlegasthenie und funktionaler Analphabetismus werden ebenfalls erklärt.
Welche diagnostischen Verfahren werden erläutert?
Die Arbeit erläutert die Bedeutung der Anamnese und beschreibt verschiedene testdiagnostische Verfahren, sowohl Basisdiagnostik (Verfahren zur Diagnostik der Rechtschreibstörung und Lesestörung) als auch Zusatzdiagnostik (Intelligenztests, Sprachentwicklungsuntersuchungen, Untersuchungen der motorischen Entwicklung, Verfahren zur Überprüfung der Aufmerksamkeit und zur Erfassung emotionaler und Verhaltensprobleme). Der Prozess der Integration aller diagnostischen Ergebnisse wird ebenfalls erläutert.
Welche Fördermöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Fördermöglichkeiten vor, sowohl im schulischen (inkl. Erlasse und Richtlinien der Bundesländer, Organisation und Gestaltung des Förderunterrichts, Selbsthilfe der Eltern und die Hausaufgabensituation) als auch im außerschulischen Bereich (mit Beispielen für Förderprogramme wie den Kieler Lese- und Rechtschreibaufbau, die Lautgetreue Rechtschreibförderung nach Reuter-Liehr und das Marburger Rechtschreibtraining, sowie Computerprogramme). Sozialrechtliche Hilfen werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird die Prävention von Legasthenie behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Früherkennung von Risikokindern und die Bedeutung der Frühförderung als präventive Maßnahme. Die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen zur Vermeidung langfristiger negativer Auswirkungen wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung, Früherkennung, Förderung, Diagnostik, Prävention, Schulische Förderung, Außerschulische Förderung, Neurobiologie, Genetik, Psycho-soziale Auswirkungen, Komorbidität, Differentialdiagnostik, Risikokinder, Frühförderung.
- Quote paper
- Anja Behr (Author), 2007, Möglichkeiten einer Förderung und Früherkennung der Legasthenie im Kindesalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114158