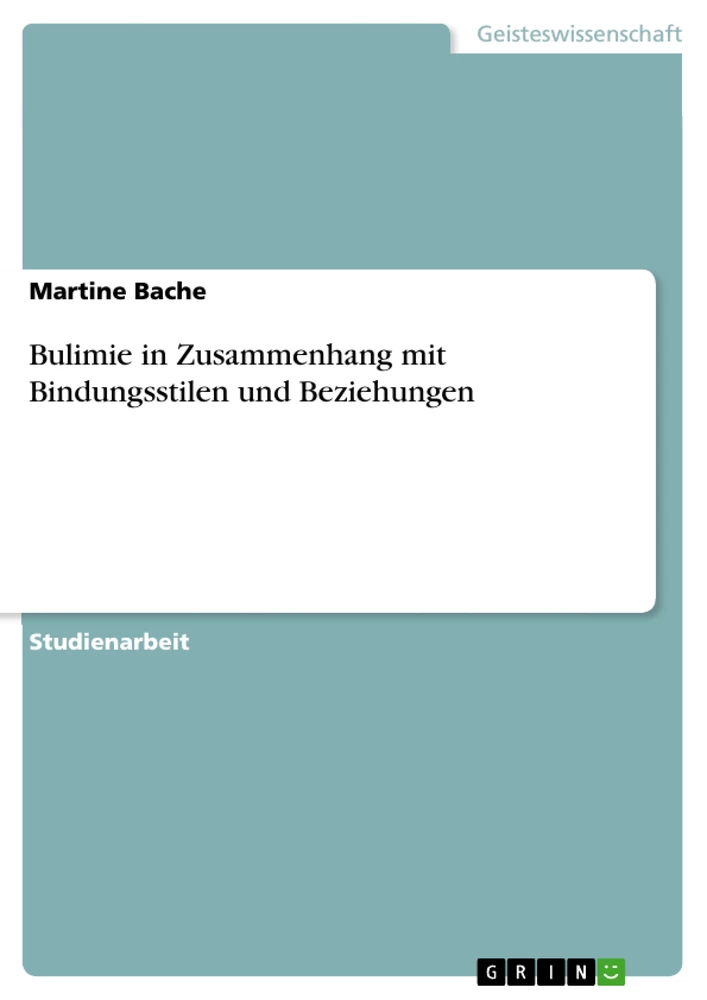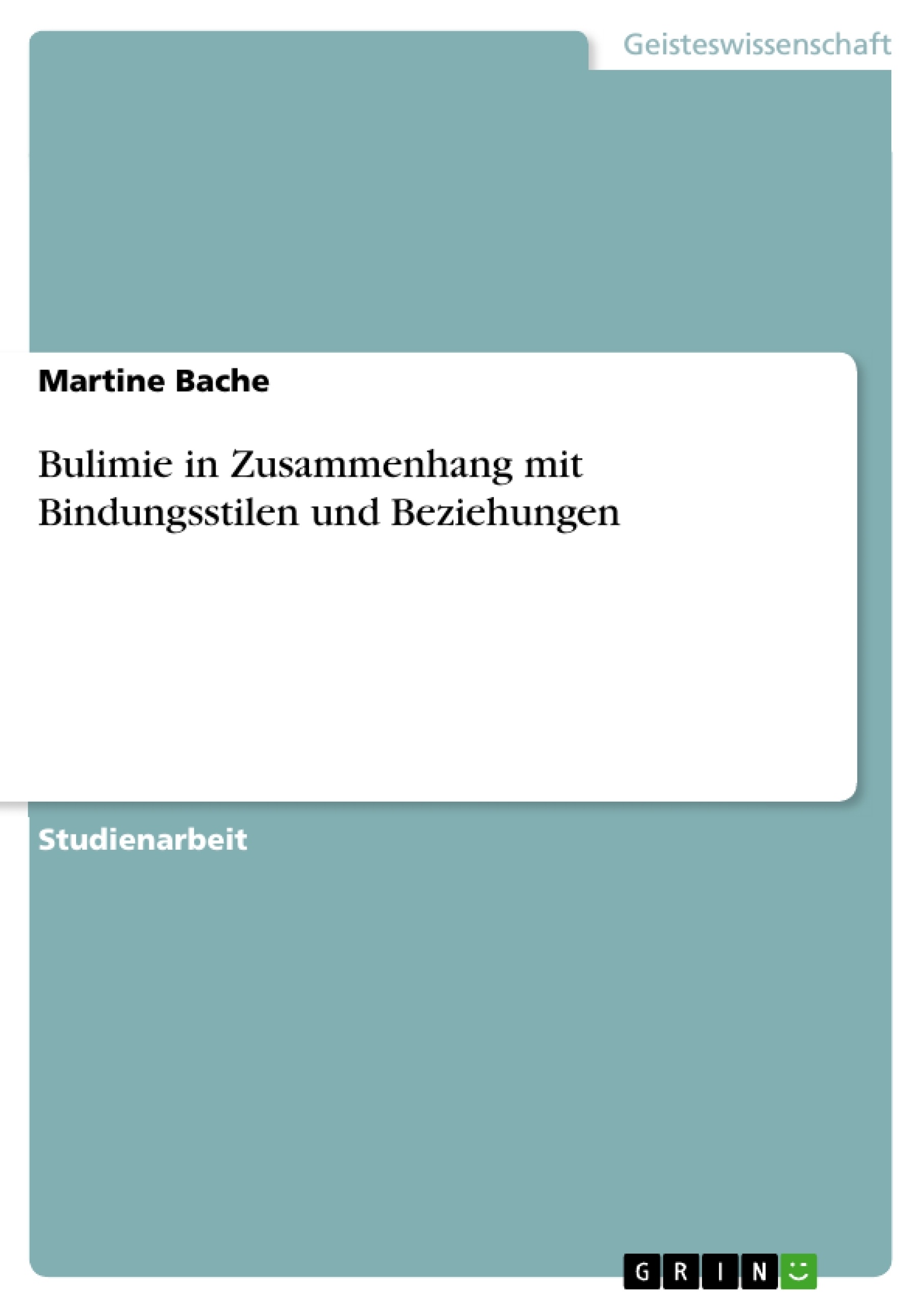„Niemand denkt so viel an Essen, wie der, der fastet oder hungert, klagt so viel über Essprobleme, wie der, der Diät hält, hat so viel Angst vor Gewichtszunahme, wie der, der hungert oder an Gewicht abgenommen hat, ist mehr gefährdet die Kontrolle über sein Essverhalten zu verlieren, wie der, der fastet oder hungert“ (Kienzel, 1999, zit. nach Aebischer, 2000). Prof. Kienzel, Leiter der Psychosomatischen Ambulanz, Innsbruck, gibt an, dass essgestörten PatientInnen „Gefühle wie unbeschwertes Genießen, gesunder Appetit oder wahre Hungergefühle“ in Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme meistens fremd sind. Das Essen ist vielmehr mit Gefühlen wie Scham, Schuld, Angst vor Gewichtszunahme, Einsamkeit und Angst zu versagen verbunden, was wiederum einen erheblichen Einfluss auf den Selbstwert der Betroffenen haben kann (Aebischer, 2000, S.22).
Essstörungen sind heutzutage weit verbreitete und häufig vorkommende Erkrankungen, die mit erheblichen Problemen für Betroffene, Familie, Freunde, sowohl auf physiologischer, psychologischer und sozialer Ebene einhergehen.
Im Folgenden soll nun die Essstörung „Bulimie“ anhand des im Seminar gezeigten Filmbeispiels 4, sowie anhand verschiedenster Literatur näher beschrieben werden. Es werden unterschiedliche Schwerpunktthemen herausgearbeitet, die mir bei der Patientin 4 vordergründig erschienen sind. Zur Vereinfachung wird Patientin 4 „Hanna“ genannt (Name frei erfunden). Der Begriff „Bulimia“ setzt sich aus den griechischen Worten „Bous“- Ochse und „Limos“-Hunger zusammen. Es bedeutet also wörtlich genommen „Ochsenhunger“. Im übertragenen Sinn bezieht es sich aber ausschließlich auf die Heißhungerattacken und Essanfälle, die als primäres Merkmal dieser Essstörung gelten (Westenhöfer, 1992, zit. nach Rechberger 2002)...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bulimie: kurze Definition
- 3. „Das Kind in mir“
- 4. Bulimie und Bindungsstile
- 5. Bulimie und zwischenmenschliche Beziehungen
- 6. Persönliche Stellungnahme
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bulimie, Bindungsstilen und zwischenmenschlichen Beziehungen am Beispiel der Patientin 4, "Hanna". Ziel ist es, die wesentlichen psychischen und sozialen Faktoren zu beleuchten, die zu Hannas Erkrankung beigetragen haben. Die Arbeit greift auf klinisch-psychologische Erkenntnisse und Literatur zurück.
- Der Einfluss frühkindlicher Erfahrungen auf die Entwicklung von Essstörungen.
- Der Zusammenhang zwischen Bulimie und Bindungsmustern.
- Die Rolle zwischenmenschlicher Beziehungen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung.
- Die Bedeutung des Selbstwertgefühls bei Bulimie.
- Die Auswirkungen von Trennungen und Verlusten auf die psychische Gesundheit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Essstörungen ein und beschreibt die weitverbreitete Problematik von Bulimie. Sie stellt die Patientin 4, "Hanna", vor und skizziert die Schwerpunktthemen der Arbeit, die sich auf Hannas Fall konzentrieren. Die Einleitung zitiert Kienzel (1999) über die Verbindung von Essstörungen mit Gefühlen wie Scham, Schuld und Angst, die das Selbstwertgefühl stark beeinflussen.
2. Bulimie: kurze Definition: Dieses Kapitel liefert eine knappe Definition von Bulimie, geleitet vom griechischen Begriff „Ochsenhunger“. Es erläutert die Diagnosekriterien nach DSM IV, die sich auf wiederholte Fressattacken und kompensatorische Maßnahmen wie Erbrechen oder Fasten beziehen. Hannas Fall wird als Beispiel herangezogen, mit Angaben zu Häufigkeit und Schwere ihrer Symptome.
3. „Das Kind in mir“: Dieses Kapitel analysiert den Hintergrund von Hannas Bulimie. Es wird der Zusammenhang zwischen frühkindlichen Erfahrungen und der Entwicklung von Essstörungen untersucht, wobei die Trennung der Eltern und die fehlende Liebe und Anerkennung als entscheidende Faktoren genannt werden. Wardetzkis (2006) Ausführungen über die Auswirkungen frühkindlicher Beeinträchtigungen auf das spätere Selbstwertgefühl und die Verarbeitung von Trennungen werden herangezogen. Der Verlust des Kontakts zum Vater wird als verschärfender Faktor für Hannas Erkrankung beschrieben. Das Kapitel betont die Rolle von Verlassenheitsgefühlen und mangelnder emotionaler Zuwendung in der Kindheit.
Schlüsselwörter
Bulimie, Essstörung, Bindungsstil, zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstwertgefühl, frühkindliche Erfahrungen, Trennung, Verlust, Entwicklungsdefizite, Fressattacken, kompensatorische Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Bulimie bei Patientin 4 ("Hanna")
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Bulimie, Bindungsstilen und zwischenmenschlichen Beziehungen anhand des Fallbeispiels der Patientin 4, "Hanna". Ziel ist es, die psychischen und sozialen Faktoren zu beleuchten, die zu Hannas Bulimie beigetragen haben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss frühkindlicher Erfahrungen auf die Entwicklung von Essstörungen, den Zusammenhang zwischen Bulimie und Bindungsmustern, die Rolle zwischenmenschlicher Beziehungen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung, die Bedeutung des Selbstwertgefühls und die Auswirkungen von Trennungen und Verlusten auf die psychische Gesundheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Bulimie, ein Kapitel zu Hannas frühkindlichen Erfahrungen ("Das Kind in mir"), ein Kapitel zu Bulimie und Bindungsstilen sowie zwischenmenschlichen Beziehungen, eine persönliche Stellungnahme, ein Literaturverzeichnis und ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen.
Wie wird Bulimie in der Arbeit definiert?
Bulimie wird anhand der Diagnosekriterien des DSM IV definiert, die sich auf wiederholte Fressattacken und kompensatorische Maßnahmen wie Erbrechen oder Fasten beziehen. Der Begriff "Ochsenhunger" (griechische Wurzel) wird ebenfalls erwähnt.
Welche Rolle spielen frühkindliche Erfahrungen?
Die Arbeit betont die Bedeutung frühkindlicher Erfahrungen für die Entwicklung von Bulimie. Hannas Trennung von den Eltern und der Mangel an Liebe und Anerkennung werden als entscheidende Faktoren hervorgehoben. Die Ausführungen von Wardetzki (2006) über die Auswirkungen frühkindlicher Beeinträchtigungen werden zitiert.
Welche Rolle spielen Bindungsstile und zwischenmenschliche Beziehungen?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Hannas Bindungsstil, ihren zwischenmenschlichen Beziehungen und ihrer Bulimie. Der Fokus liegt auf dem Einfluss dieser Faktoren auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung.
Welche Rolle spielt das Selbstwertgefühl?
Das Selbstwertgefühl spielt eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie frühkindliche Traumata und negative Erfahrungen das Selbstwertgefühl beeinflusst haben und wie dies mit der Entwicklung der Bulimie zusammenhängt. Die Einleitung zitiert Kienzel (1999) bezüglich der Verbindung von Essstörungen mit Gefühlen wie Scham, Schuld und Angst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Bulimie, Essstörung, Bindungsstil, zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstwertgefühl, frühkindliche Erfahrungen, Trennung, Verlust, Entwicklungsdefizite, Fressattacken, kompensatorische Maßnahmen.
Wer ist Patientin 4 ("Hanna")?
Patientin 4, "Hanna", dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Konzepte der Arbeit zu illustrieren und zu konkretisieren. Ihre Geschichte wird verwendet, um den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Faktoren und der Entwicklung ihrer Bulimie aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Magister Martine Bache (Autor), 2007, Bulimie in Zusammenhang mit Bindungsstilen und Beziehungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114115