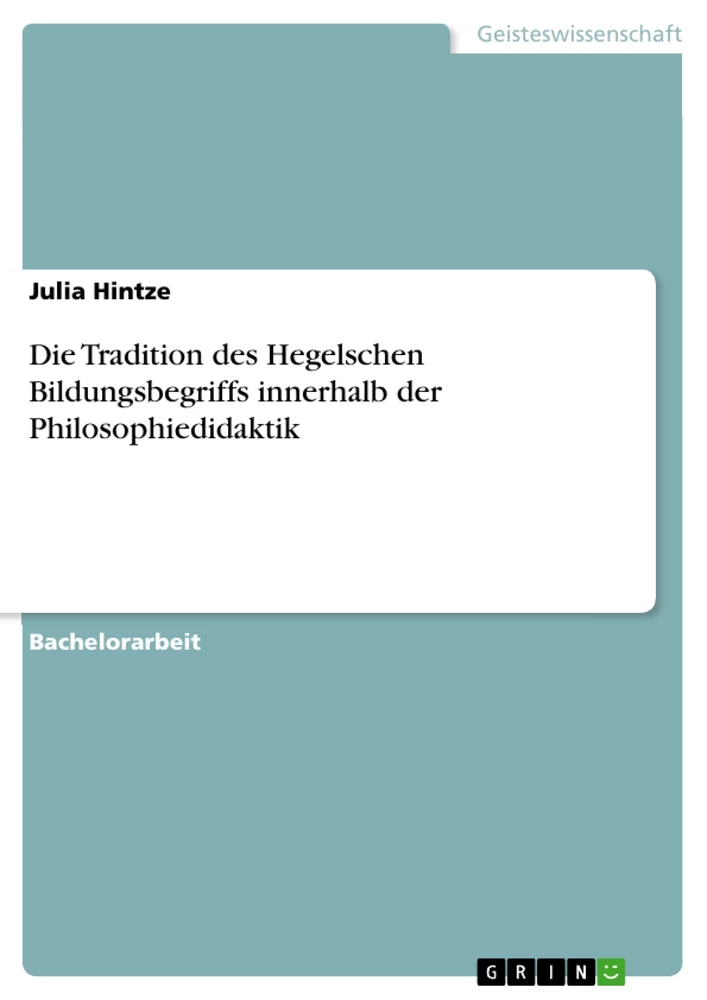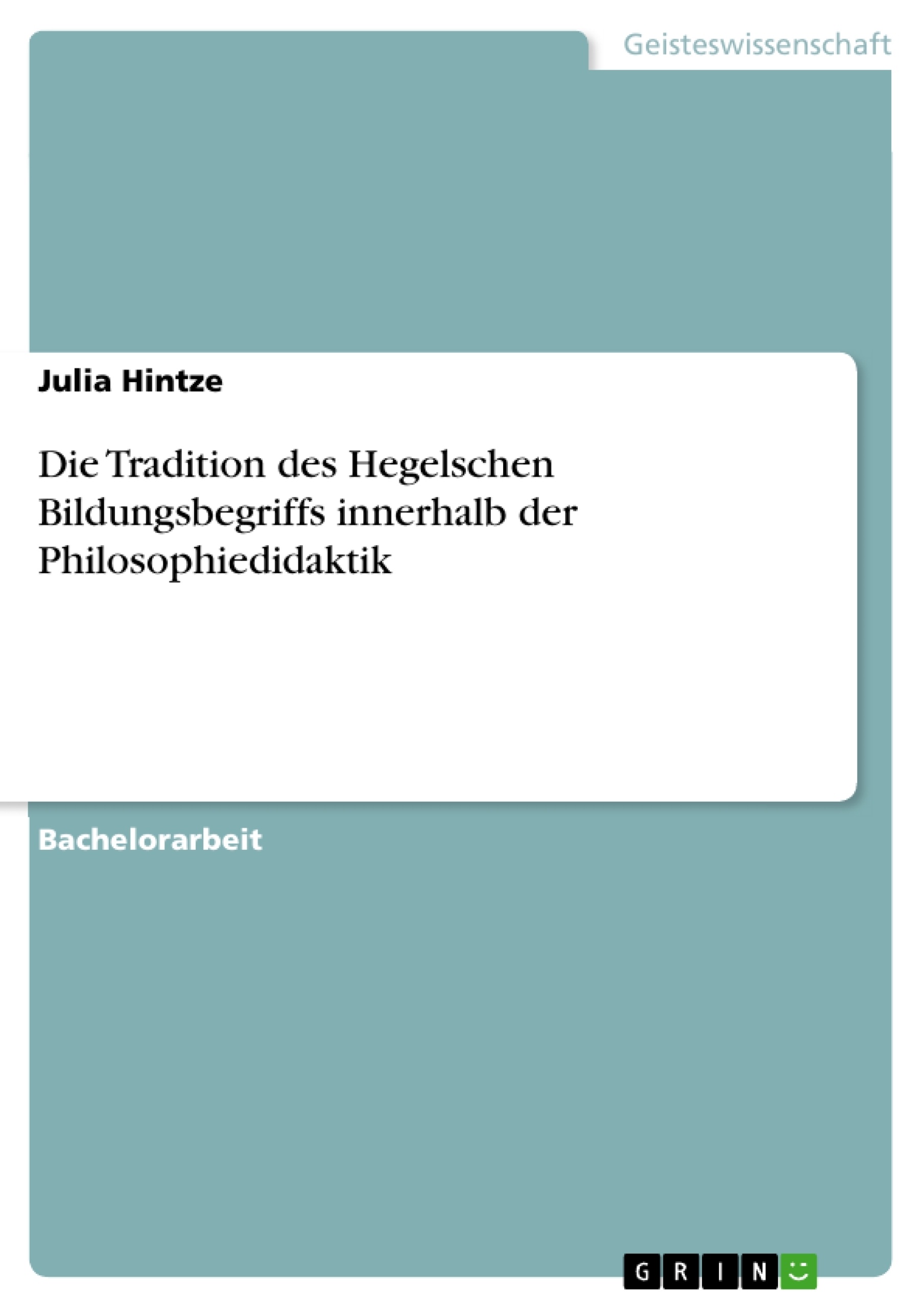In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, Hegels philosophischen Grundzüge pädagogischer Erkenntnis zu rekonstruieren und bildungsphilosophisch zu interpretieren, um sie in Zusammenhang mit den elementaren Lernzielen der heutigen Philosophie und ihrer Didaktik sowie den Fachanforderungen Schleswig-Holsteins zu setzen. Es wird die Frage diskutiert, inwiefern Hegel fruchtbar für die philosophische Fachdidaktik ist und welche Erkenntnisse seinerseits zur heutigen Didaktik beigetragen haben. Hegels pädagogische Wirksamkeit gründet wohl in der Gesamtheit seiner Werke - im Ganzen seiner Philosophie. Da die Erfassung und Analyse seines gesamten philosophischen Systems allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht erarbeitet werden kann, wird hier nicht auf diese Ganzheit seiner Philosophie und damit auf all seine Schriften eingegangen werden. Die Arbeit beschränkt sich demnach auf die Schriften Hegels, die einer pädagogischen am ähnlichsten kommen: Nürnberger und Heidelberger Schriften von 1808-1817.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Zur Tätigkeit Hegels in Nürnberg
- 3. Nürnberger Schriften 1808-1817
- 3.1. Zu den Lehrgegenständen
- 3.2. Zur Methode
- 4. Zur gegenwärtigen Philosophiedidaktik
- 4.1. Zum bildungstheoretisch-identitätstheoretischen Ansatz
- 4.2. Zum Unterrichtsprinzip Roland Henkes
- 4.3. Zum Kontext zu den aktuellen Fachanforderungen
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Tradition des Hegelschen Bildungsbegriffs innerhalb der Philosophiedidaktik. Sie untersucht Hegels Schriften im Hinblick auf bildungstheoretische Erkenntnisse und erörtert, inwiefern Hegels Gedankengänge fruchtbar für die heutige philosophische Fachdidaktik sind.
- Rekonstruktion von Hegels philosophischen Grundzügen pädagogischer Erkenntnis
- Bildungsphilosophische Interpretation von Hegels Schriften
- Zusammenhang zwischen Hegels Schriften und den elementaren Lernzielen der heutigen Philosophie
- Bedeutung von Hegels Werk für die aktuellen Fachanforderungen in Schleswig-Holstein
- Kontrast zwischen Hegels didaktischem Ansatz und der gegenwärtigen Philosophiedidaktik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung: Die Einführung beleuchtet Hegels Bedeutung als Philosoph und Pädagogen und führt in das Thema der Arbeit ein. Sie stellt die Frage nach der Relevanz von Hegels Werk für die heutige Philosophiedidaktik und erläutert den Fokus der Untersuchung auf die Nürnberger und Heidelberger Schriften von 1808-1817.
- Kapitel 2: Zur Tätigkeit Hegels in Nürnberg: Dieses Kapitel beschreibt Hegels Tätigkeit als Lehrer und Schuldirektor am Gymnasium in Nürnberg. Es beleuchtet den historischen Kontext und den Einfluss des Allgemeinen Normativ der Einrichtung der öffentlichen Unterrichtsanstalten auf Hegels Arbeit.
- Kapitel 3: Nürnberger Schriften 1808-1817: Dieses Kapitel analysiert Hegels Schriften aus der Nürnberger Zeit und stellt die Grundzüge seiner Philosophie im Hinblick auf den heutigen Philosophieunterricht dar. Es beleuchtet insbesondere seine didaktischen Ansätze und die Bedeutung von deduktivem Lernen.
- Kapitel 4: Zur gegenwärtigen Philosophiedidaktik: Dieses Kapitel diskutiert die Kontroverse zwischen Hegels didaktischem Ansatz und der heutigen Philosophiedidaktik. Es stellt verschiedene didaktische Ansätze vor, insbesondere den bildungstheoretisch-identitätstheoretischen Ansatz, das Unterrichtsprinzip von Roland Henke und den Kontext der aktuellen Fachanforderungen in Schleswig-Holstein.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Hegelsche Bildungstheorie, Philosophiedidaktik, deduktives Lernen, induktiver Ansatz, Unterrichtsprinzip, Fachanforderungen, Neuhumanismus, Nürnberger Schriften, Heidelberger Schriften.
- Quote paper
- Julia Hintze (Author), 2019, Die Tradition des Hegelschen Bildungsbegriffs innerhalb der Philosophiedidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1140900