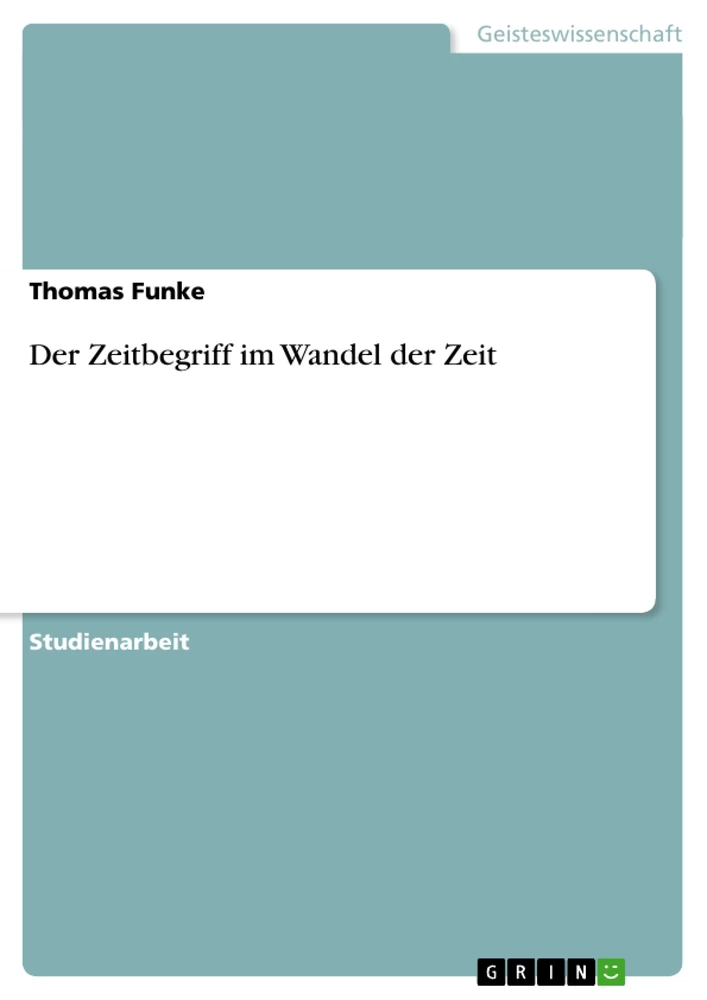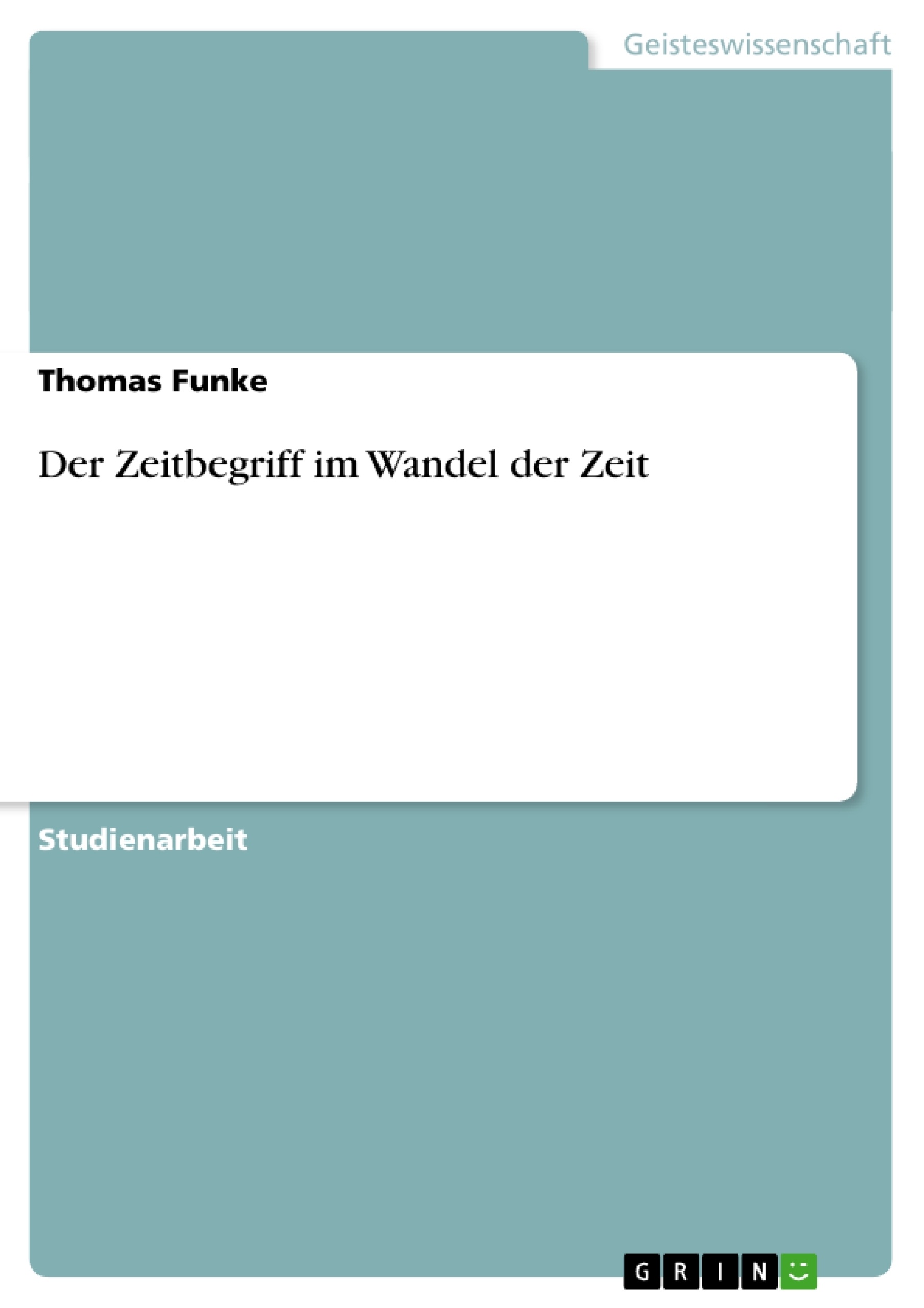Die Zeitposition ist keine intrinsische Position, sondern einer relationale. Nicht nur zwischen zwei Ereignissen, sondern zwischen einem dritten, unserem Bewußtsein oder einem anderen zeitgleich regelmäßig abgelaufenem Ereignis (einem Maßstab) das weiterläuft (Uhrcharakter), besteht eine Beziehung zueinander. Das früher als, später als würde als einziges übrig bleiben ohne Bewußtsein. Es kann aber nicht Zeit sein, wenn es nicht gemessen werden könnte.
Wichtig ist also die Anwesenheit des Bewußtseins, welches selbst noch kein Maßstab ist, da es selbst Anhaltspunkte braucht. Deshalb ist als Maßstab ein nicht chaotisches Universum notwendig. So haben wir zum Schluß ein Bewußtsein von etwas Zählbarem, wie auch bei Aristoteles. Und das ist Zeit.
Kant sagte schon damals, daß unser Bewußtsein ein Zeitbewußtsein ist und es Zeit an sich nicht gibt. Sondern Zeit gibt es nur für ein Bewußtsein. Das ist indexikalisch.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
II. Überblick Autor: Überblick von Aristoteles Leben und Werk
III. Primäliteratur: Zeit in der Physik
3.1. Das >>Jetzt<<
3.2. Ist Zeit Bewegung?
3.3. Gibt es Zeit ohne Veränderung?
3.4. Ist Zeit etwas an der Bewegung?
3.5. Ist Zeit zyklisch?
3.6. Aristoteles’ Zeitbegriff
IV. Andere Varianten des Zeitbegriffes
4.1. Die kulturelle Konstruktion der Zeit
4.2. Die Ägyptische Zeitkultur
V. Schlußkapitel
VII. Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Ausarbeitung dieses Themas wird anhand der Lektüre von
Aristoteles´ Physik: Vorlesung über Natur[1], die hier als Primärliteratur gelesen wird, und weiterer Sekundärliteratur, wie Mitschriften aus der Vortragsreihe:
Helmholz-Vorlesungen “Zeit” und Referaten aus dem Proseminar von Prof. Dr. Herbert Schnädelbach “Zeit und Zeiterfahrungen” vorgenommen.
Bei der Physik handelt es sich um zwei Halbbände, deren griechischer Ausgangstext aus: Aristotelis Physica, Recognovit brevique adnotatione critica instruxit (W. D. Ross, Oxford 1950, Nachdruck 1982) entnommen, deren deutsche Übersetzung jedoch völlig neu angefertigt wurde.
Als Begründung für dieses Vorgehen des Autors wurde die Unverständlichkeit der Übersetzung von Karl Prantl aus dem Jahre 1854 aufgrund seiner zu großen Polemik angeführt. Desweiteren verwirft Zekl auch die Übersetzung von Hans Wagner aus dem Jahre 1967, da diese wegen der gewaltigen Fülle interpretatorischen und kommentierenden Materials und aufgrund der Eindringlichkeit in der Auseinandersetzung mit moderner Aristotelesforschung den “garstige Graben der Geschichte”[2] übersprungen hat, was aber nicht zulässig ist.
Die Helmholtz-Vorlesungsreihe fand zu drei Terminen über die Jahre 1998 und 1999 statt. Das Proseminar von Prof. Dr. Schnädelbach wurde von ihm und Prof. Dr. Michael Heidelberger zum Sommersemester 1999 in der Humbolt Universität zusammen veranstaltet.
Meine Bemühung in dieser Hausarbeit wird es sein, einen kurzen aber detaillierten Überblick über den Wandel der Vorstellung und vom Verständnis über die Zeit aus heutiger Sicht dem Leser nahezubringen.
Als erstes folgt ein Überblick über den Autor Aristoteles, der das Primärwerk verfaßt hat. Zuerst einiges zu seinem Leben und Werk, um ihn und seine Theorien besser zu verstehen.
II. Überblick Autor: Überblick von Aristoteles Leben und Werk
”Alle Menschen streben nach Wissen von Natur aus.”[3] Das ist der Satz, welcher die Metaphysik von Aristoteles einleitet. Aristoteles spricht unmittelbar über den Menschen und sein Wissen, mittelbar auch über den Verfasser. Und da der Verfasser sehr wichtig ist für ein Werk, folgen biographische Angaben zu Aristoteles.
384 v. Chr. wird Aristoteles in Stageira (Starro), einer kleinen Stadtrepublik im Nordosten Griechenlands; geboren.
Er ist der Sohn einer angesehenen Familie. Sein Vater Nikomachos ist Leibarzt am makedonischen Königshof. Dieser stirbT jedoch früh; und so wird Aristoteles, der eine hervorragende Ausbildung genießt, von einem Vormund weiter betreut.
Im Jahre 367 v.Chr. geht er im Alter von siebzehn Jahren nach Athen, um bei Platon an dessen Akademie”, einem Vorbild für die Einheit von Lehre und Forschung”[4], zu studieren. Dort ist er nur Metöke (Beisasse), ein Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, aber ohne politische Rechte (Bürgerrechte).
Im Zeitraum von 367-347 v. Chr war Aristoteles ”erster Athen-Aufenthalt”[5]: Aristoteles beschäftigt sich mit den Problemen aus Platons Dialogen. Er studiert auch bei Speusipp, Xenokrates und Eudoxos von Knidos; die ebenfalls Mitglieder der Akademie sind.
Er entwickelt bald eigene Vorstellungen und tritt so aus dem Schülerstatus heraus.
Er hatte kein Saulus-Paulus-Erlebnis, eine plötzliche Erleuchtung; und es gab nie eine Wende in seiner intellektuellen Biographie. In dieser Zeit entstehen logische und wissenschaftstheoretische Schriften, die später zum Organon zusammenfaßt wurden; sowie auch erste Entwürfe der Naturphilosophie Physik und der Fundamentalphilosophie der Metaphysik, der Ethik, Poetik, Politik und Rhetorik.
Die Zeit von 347-335/4 sind die ”Wanderjahre”[6] von Aristoteles. Weil er makedonischer Abstammung ist, gilt er als Feind von Athen. Daher verläßt er die Stadt, um zu seinem ehemaligen Mitschüler Hermias von Atarneus, Fürst der kleinasiatischen Stadt Assos, zu flüchten. Dort philosophiert er weiter, lernt Theophrast von Eresos, seinen späteren Mitarbeiter und Freund kennen, und heiratet Pythias, die Schwester von Hermias, mit der er eine Tochter gleichen namens (Pythias) und einen Sohn namens Nikomachos zeugt.
Im Jahr 345 v. Chr. stirbt Hermias und Aristoteles geht nach Mytilene auf Lesbos. Nach zwei Jahren übernimmt er dort auf Bitten König Philipps die Erziehung von dessen dreizehnjährigem Sohn Alexander[7].
Der Zeitraum von 335/4 -322 v. Chr. ist Aristoteles ”Zweiter Aufenthalt”[8] in Athen. Durch die Zerstörung Thebens durch die Makedonier kehrt Aristoteles nach Athen zurück, lehrt aber am Lykeion in Lykabettos, einem jedermann zugänglichen Gymnasium, da Xenokrates an die Spitze der Akademie gewählt wurde, obwohl er Aristoteles an Kenntnis, Scharfsinn und geistiger Beweglichkeit weit unterlegen war.
Im Jahre 323 stirbt Alexanders der Große. Daraufhin verläßt Aristoteles Athen wieder, weil er befürchtet, Opfer der antimakedonischen Umtriebe zu werden.
Dies tat er mit gutem Grund, da auch er, wie bereits Sokrates, unter die Anklage der Gottlosigkeit (asebeia) fiel. Er zieht nach Chalkis auf Euboia in das Haus seiner Mutter.
Im Jahre 322 im Oktober, stirbt Aristoteles im Alter von 62 Jahren, an einer nicht näher bekannten Krankheit.
Sein Werk umfaßte ungefähr 45 Bände zu je 300 Seiten, wovon weniger als ein Viertel erhalten geblieben ist.
Sein Schrifttum gliedert sich in drei Gattungen:
1. exoterische, enzyklische Schriften für gebildete Laien.
Sie waren Werbeschriften für die Philosophie Protreptikos’ und Dialoge, wie Über die Philosophie, Über Gerechtigkeit, Politikos, Über Dichter.
2. Weiterhin in esoterische Schriften für Schüler und Kollegen.
Sie behandeln einige zentrale Themen nur sehr kurz.
3. Letzteres sind Sammlungen von Forschungsmaterialien.
Es waren Lehrmeinungen früherer Philosophen, Material zur Naturforschung (Zoologie), zur Politik, über Sprichwörter, Homerische Streitfragen usw.
Darüber hinaus entwickelt er eine neue Textgattung: die Abhandlungen.
Da wir nun einen Einblick in Aristoteles’ Leben und Werk erhalten haben, befassen wir uns jetzt speziell mit seinen Überlegungen und Vorstellungen von Zeit.
[...]
[1] Zekl, S.III
[2] Zekl, S. XIV
[3] Höffe, S. 13
[4] Ebd., S. 14
[5] Ebd.
[6] Ebd., S. 17
[7] Alexander der Große, Staatsmann von Makedonien, größter Feldherr der Antike
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text ist ein umfassender Sprachüberblick, der Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er befasst sich mit Aristoteles' Physik und seinem Zeitbegriff, wobei sowohl Primär- als auch Sekundärliteratur verwendet wird.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, einen kurzen, aber detaillierten Überblick über den Wandel der Vorstellung und des Verständnisses von Zeit aus heutiger Sicht zu geben.
Welche Primärliteratur wird verwendet?
Als Primärliteratur dient Aristoteles´ Physik: Vorlesung über Natur.
Welche Sekundärliteratur wird verwendet?
Als Sekundärliteratur werden Mitschriften aus der Vortragsreihe: Helmholtz-Vorlesungen “Zeit” und Referate aus dem Proseminar von Prof. Dr. Herbert Schnädelbach “Zeit und Zeiterfahrungen” verwendet.
Warum wurde eine neue Übersetzung der Physik von Aristoteles angefertigt?
Die Übersetzung von Karl Prantl aus dem Jahre 1854 wurde als unverständlich aufgrund seiner zu großen Polemik angesehen. Die Übersetzung von Hans Wagner aus dem Jahre 1967 wurde verworfen, da diese wegen der gewaltigen Fülle interpretatorischen und kommentierenden Materials und aufgrund der Eindringlichkeit in der Auseinandersetzung mit moderner Aristotelesforschung den "garstige Graben der Geschichte" übersprungen hat.
Was beinhaltet der Überblick über Aristoteles?
Der Überblick über Aristoteles behandelt sein Leben und Werk, um ihn und seine Theorien besser zu verstehen. Es werden biographische Angaben von seiner Geburt bis zu seinem Tod gemacht, sowie seine intellektuelle Entwicklung und sein Schrifttum beschrieben.
Wie gliedert sich Aristoteles' Schrifttum?
Sein Schrifttum gliedert sich in drei Gattungen: exoterische Schriften für gebildete Laien, esoterische Schriften für Schüler und Kollegen, und Sammlungen von Forschungsmaterialien.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Einleitung, Überblick über Aristoteles Leben und Werk, Zeit in der Physik (inklusive Aspekte wie das "Jetzt", ob Zeit Bewegung ist, ob es Zeit ohne Veränderung gibt, ob Zeit etwas an der Bewegung ist, ob Zeit zyklisch ist, und Aristoteles' Zeitbegriff), andere Varianten des Zeitbegriffes (inklusive die kulturelle Konstruktion der Zeit und die Ägyptische Zeitkultur), Schlusskapitel und Literaturverzeichnis.
- Arbeit zitieren
- Thomas Funke (Autor:in), 1999, Der Zeitbegriff im Wandel der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114075