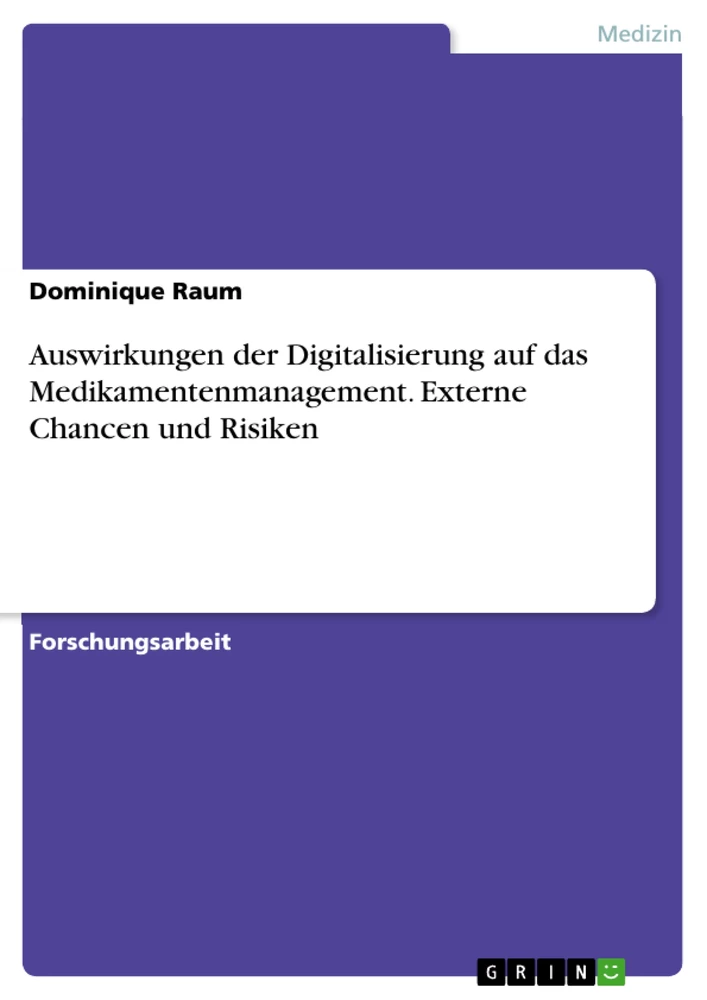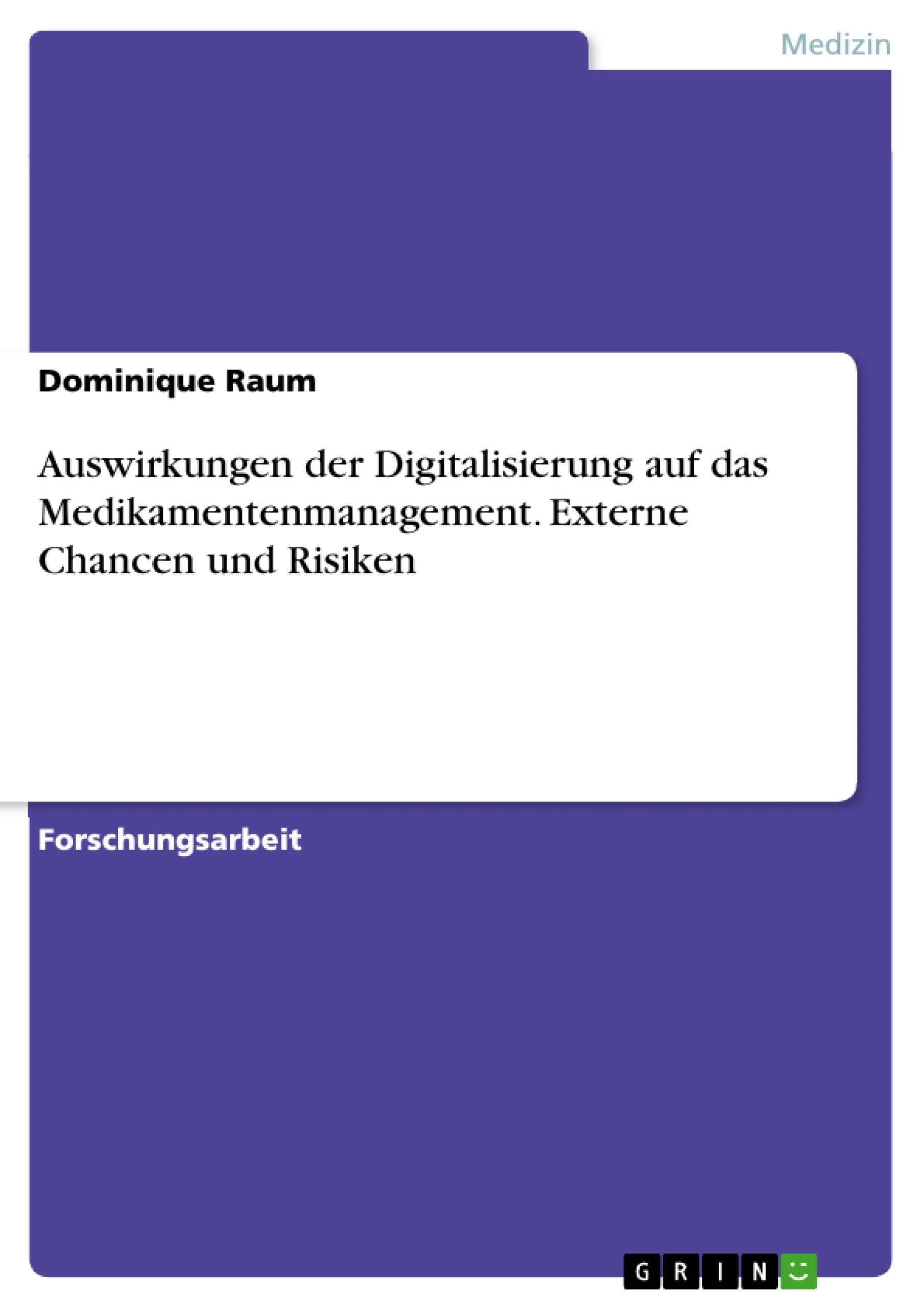Ende des 20. Jahrhunderts erlebte die Welt eine digitale Revolution in Form einer erhöhten Nutzung an Computern und digitalen Technik. Dieser Umschwung erlebt auch noch im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts seine Anwendung. Mit fortschreitenden technologischen Möglichkeiten und Neuerungen, gewinnt auch die Implementierung der informatischen Systeme immer mehr an Wichtigkeit. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Möglichkeit, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, sondern ebenfalls um bestehende Abläufe zu analysieren, zu adaptieren und zu optimieren.
Der Gesundheitssektor ist einer der Bereiche, in denen letzten Endes das digitale Zeitalter, trotz langer Renitenz, Einzug hält. Zwar verweilten Krankenhäuser lange mit der klassischen Papiernutzung, zumal es die juristische Absicherung vereinfachte (siehe hierzu anatomische Untersuchungen des Patientenaufenthaltes im Falle von Klagen), allerdings finden immer mehr Patienten Daten Management Systeme (im folgenden PDMS genannt) ihren Weg in den Stations- und Abteilungsalltag.
Auch in Luxemburg wurde eines der dortigen Krankenhäuser mit einem solchen PDMS Programm ausgestattet. Um möglichst viel Nutzen aus dieser neuen digitalen Plattform gewinnen zu können, wurde dieses PDMS mit weiteren Programmen und technischen Apparaturen verbunden. Diese Verkoppelung von Programmen und Maschinen führte unter anderen zur Nutzung eines digitalen Medikamentenmanagements (hiernach auch MEDMAN genannt). Es handelt sich dabei um einen elektronisch verschlossenen Medikamentenschrank, dessen Zugang zu den Medikamenten digital gesteuert ist.
In Anbetracht dieser Digitalisierung des Versorgungskonzepts stellt sich die Frage: Ist die Nutzung eines, mit dem PDMS kombinierten, digitalen Medikamentenmanagements nur als Chance anzusehen, oder bestehen durchaus auch Risiken?
Durch die Anzahl der auf dem Markt befindlichen PDMS und der Nutzung unterschiedlichster Programme und Apparate zur Durchführung der Beschaffungs- und Distributionslogistik, wird allein das System welches Anwendung in diesem Krankenhaus in Luxemburg findet betrachtet. Da auch innerhalb eines einzigen Krankenhauses die Abteilungen unterschiedlich organisiert sind und dadurch einen veränderten Ablauf zueinander aufweisen, wird zur Analyse die Intensivstation ausgewählt, da diese die breiteste Medikamentenverfügbarkeit und auch Nutzung aufweist.
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2. ERLÄUTERUNG DES DIGITALEN MEDIKAMENTENMANAGEMENTS
3. VORTEILE DIESES MANAGEMENTSYSTEMS
3.1. APOTHEKE
3.2. MEDIZINISCHES PERSONAL
3.3. PFLEGEPERSONAL
3.4. BUCHHALTUNG
3.5. EBENE KRANKENHAUS
4. NACHTEILE DIESES MANAGEMENTSYSTEMS
4.1. APOTHEKE
4.2. MEDIZINISCHES PERSONAL
4.3. PFLEGEPERSONAL
4.5. INFORMATIK
5. SWOT-ANALYSE
6 FAZIT
7. LITERATURVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
Ende des 20. Jahrhunderts erlebte die Welt eine digitale Revolution in Form einer erhöhten Nutzung an Computern und digitalen Technik. Dieser Umschwung erlebt auch noch im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts seine Anwendung. Mit fortschreitenden technologischen Möglichkeiten und Neuerungen, gewinnt auch die Implementierung der informatischen Systeme immer mehr an Wichtigkeit. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Möglichkeit, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, sondern ebenfalls um bestehende Abläufe zu analysieren, zu adaptieren und zu optimieren.
Der Gesundheitssektor ist einer der Bereiche, in denen letzten Endes das digitale Zeitalter, trotz langer Renitenz, Einzug hält. Zwar verweilten Krankenhäuser lange mit der klassischen Papiernutzung, zumal es die juristische Absicherung vereinfachte (siehe hierzu anatomische Untersuchungen des Patientenaufenthaltes im Falle von Klagen), allerdings finden immer mehr Patienten Daten Management Systeme (im folgenden PDMS genannt) ihren Weg in den Stations- und Abteilungsalltag.
Auch in Luxemburg wurde eines der dortigen Krankenhäuser mit einem solchen PDMS Programm ausgestattet. Um möglichst viel Nutzen aus dieser neuen digitalen Plattform gewinnen zu können, wurde dieses PDMS mit weiteren Programmen und technischen Apparaturen verbunden. Diese Verkoppelung von Programmen und Maschinen führte unter anderen zur Nut zung eines digitalen Medikamentenmanagements (hiernach auch MEDMAN genannt). Es handelt sich dabei um einen elektronisch verschlossenen Medikamentenschrank, dessen Zugang zu den Medikamenten digital gesteuert ist.
In Anbetracht dieser Digitalisierung des Versorgungskonzepts stellt sich die Frage: Ist die Nutzung eines, mit dem PDMS kombinierten, digitalen Medikamentenmanagements nur als Chance anzusehen, oder bestehen durchaus auch Risiken?
Durch die Anzahl der auf dem Markt befindlichen PDMS und der Nutzung unterschiedlichster Programme und Apparate zur Durchführung der Beschaffungs- und Distributionslogistik, wird allein das System welches Anwendung in diesem Krankenhaus in Luxemburg findet betrachtet. Da auch innerhalb eines einzigen Krankenhauses die Abteilungen unterschiedlich organisiert sind und dadurch einen veränderten Ablauf zueinander aufweisen, wird zur Analyse die Intensivstation ausgewählt, da diese die breiteste Medikamentenverfügbarkeit und auch Nutzung aufweist.
2. ERLÄUTERUNG DES DIGITALEN MEDIKAMENTENMANAGEMENTS
Im Gegensatz zum Ablauf in einem klassischen Krankenhaus (Bestellung der notwenigen Medikamente bei der krankenhauseigenen Apotheke durch die einzelnen Abteilungen und Befüllung eines Schrankes mit den gelieferten Medikamenten), basiert das Medikamentenmanagement auf einem digitalen System mit 4 Ebenen: Der Krankenhausapotheke, dem Computer (hier folgend auch PC genannt) mit PDMS1 und Ausgabeprogramm, dem elektronischen Medikamentenschrank und der Station (siehe Abb. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1
Wie aus der Abbildung 1 ersichtlich, steht die Apotheke nicht mehr in direkter Beziehung zur Krankenstation. Jeglicher Informationsfluss, außer bei der Bestellung außergewöhnlicher Medikamente (z.B. Zytostatika), wird über den PC und dem Medikamentenschrank durchgeführt.
Die Station (genauer gesagt der Stationsarzt) verordnet im PDMS die notwendigen Medikamente für jeden einzelnen Patienten (= Verordnung).
Das Pflegepersonal informiert sich in der Patientenakte über die etwaige Medikation des Patienten (das bedeutet, welches Medikament zu welcher Zeit). Um Zugang zu den Medikamenten zu erhalten, muss das Personal sich zunächst über ihren „Badge“2, mittels eines Passwortes, im Ausgabeprogramm einloggen. Durch das Einscannen eines Strichcodes (entspricht der Patientennummer) wird die Patientenidentität zur Abfrage festgelegt.
Das Programm prüft nun im PDMS ob die Uhrzeit mit der Medikationsverordnung des Patienten übereinstimmt (eine Diskrepanz von 15 Minuten ist dabei erlaubt) und öffnet eine Auswahlliste der zu gebenden Medikamente (= Freigabe).
Durch auswählen des Medikamentes kann nun die Öffnung des Fachs erfolgen (= Distribution). Ist das Medikament herausgenommen, so wird dies im Programm bestätigt, das Fach wird geschlossen und das Medikament kann nicht nochmal angefragt werden. Dies geschieht für jedes einzelne Medikament bis die Liste abgearbeitet ist oder vorzeitig geschlossen (beendet) wird.
Die Apotheke führt mehrmals in der Woche eine Abfrage über den elektronischen Medikamentenschrank aus um die verbrauchten Medikamente zu erfassen und wieder aufzufüllen zu können (= Beschaffung).
Hierzu verfügt der Mitarbeiter der Apotheke über einen speziellen Zugang um die Anzahl der wiederaufgefüllten und verfügbaren Medikamente auf das Standardmaß zurückzusetzen (= Distribution). Zu diesem Moment kann auch eine Kontrolle des Bestands durchgeführt werden.
Zwischen Apotheke und PC erfolgt lediglich eine indirekte Kommunikation durch den Abgleich der Medikamentenliste des Krankenhauses (= Information).
3. VORTEILE DIESES MANAGEMENTSYSTEMS
Die Implementierung eines solchen Systems auf einer Abteilung erfordert und bewirkt grundsätzliche Veränderungen in den Arbeitsweisen und Prozessen dieser Station. Da im Allgemeinen die Disponibilität zu Veränderungen gering ausfällt, stellt sich die Frage: Welche Chancen bietet ein solches digitales Versorgungskonzept?
3.1. APOTHEKE
Klassische Krankenhausapotheken versuchen Ihren betrieblichen Ablauf zu verbessern indem auch sie sich das digitale Zeitalter zu Nutze machen. Hier wurde die Distributionslogistik dahingehend verändert, dass der Bestellvorgang nicht mehr physisch abgelegt werden muss. Die Apotheke erspart sich dadurch einen Mitarbeiter der in der Zeit der Statusaufnahme nicht direkt zur Verfügung für andere Tätigkeiten steht. Diese Statusaufnahme beinhaltet das Absolvieren der Distanz bis zur Abteilung und zurück zur Apotheke und die Erfassung der benötigten, sowie die Kontrolle der Verfallsdaten der verbliebenen Medikamente.
Da die Apotheke, wie in den meisten Krankenhäusern, sich nahe des Liefereingangs befindet, ist der Weg zur Intensivstation relativ weit. Die Intensivstation, liegt in kurzer Distanz zum Helikopterlandeplatz. Dieser muss von ausliefernden Lastern und/oder Lieferwagen entfernt sein. Es wird demnach einiges an Zeit (Manpower) eingespart.
Dieses Krankenhaus benutzte zuvor ein Doppelstocksystem. Das bedeutet, das alle Medikamente doppelt in Fächern geführt wurden. Wurde das erste Fach leer, zog man eine Registerkarte hoch (auf dieser stand der Name, die Dosierung, und Applikationsform des Medikaments), was die Notwendigkeit zur Bestellung anzeigte. Über die zyklische Zeitabfrage des Zustands des Medikamentenschranks, wird die Erfassung der benötigten, und demnach administrierten, Medikamente in Echtzeit durchgeführt. Diese Durchführung geschieht innerhalb von Sekunden und beinhaltet keinerlei Fehler bei der Erfassung der hochgezogenen Registerkarten, da nicht immer alle Karten gesehen wurden. Auch hier ist die wesentliche Zeitersparnis nicht zu ignorieren.
Bei der Auslieferung durch den Apothekenmitarbeiter gestaltet sich die Kontrolle der Verfallsdaten einfacher. Alle Verfallsdaten werden digital erfasst, das Ausgabeprogramm kann bei der Informationssammlung durch die Apotheke, jene Medikamente anzeigen, welche ein Exemplar beinhalten das bald abläuft. Der Mitarbeiter braucht nur noch diese Fächer zu kontrollieren und das jeweils nähere Datum im Programm eintragen. Neben einer erneuten Zeitersparnis resultiert auch ein verbessertes Qualitätsmanagement (hier folgend auch als QM bezeichnet) aus diesem neuen Tool3, zumal zusätzlich eine gesteigerte Sicherheit vor Verwechslungen besteht. Die Apotheke kann die sich optisch ähnelnden Medikamente in unterschiedlichen Fächern unterbringen.
3.2. MEDIZINISCHES PERSONAL
Auch für die Ärzteschaft ist die Nutzung eines solchen digitalen Medikamentenmanagements von Vorteil. So können nur Medikamente verordnet werden, die auch im System der Apotheke gepflegt werden. Rückfragen, ob ein verordnetes Medikament, welches nicht gepflegt wird, einem Medikament entspricht welches in der Liste vorhanden ist, entfallen. Lediglich „stationsfremde“ Medikamente müssen gesondert bestellt werden. Hierfür könnten allerdings separate Fächer im Schrank vorgesehen werden um auch diese Nutzung der „Sondermedikamente“ in einem gewissen Rahmen zu kontrollieren.
Verordnete Medikationen können nur innerhalb der Toleranz von 15 Minuten um die verordnete Uhrzeit der Gabe aus dem Schrank entnommen werden. Wird ein Medikament nicht entnommen, kann es auch nicht als gegeben im PDMS abgehakt werden. Dieses Managementsystem dient den Ärzten also auch als Kontrolle.
Durch die Tatsache, dass Ausgabe mit der Identifikation des Patienten verbunden ist (abscannen des Strichcodes), wird die Verwechslungsgefahr zumindest ein bisschen reduziert.
3.3. PFLEGEPERSONAL
Das Pflegepersonal profitiert ebenso von der Nutzung eines solchen MEDMAN. Die Problematik nicht schriftlich verordnete Medikamente geben zu müssen (durch mündliche Anordnung), ohne Sicherheit, dass dies vom Arzt „nachverordnet“ wird, ist nun nicht mehr gegeben. Die Ausgabe des Medikamentes ist schlichthin nicht mehr möglich, der Arzt muss das Medikament unverzüglich anordnen.
Genauso wie es für die Apotheke als Vorteil erscheint, so kann auch das Pflegepersonal von der Tatsache profitieren, sicher zu sein, dass die ausgegebenen Medikamente noch der Mindesthaltbarkeit entsprechen, da dies nun von der Apotheke „abgesichert“ wird. Verwechslungen der Medikamente durch sich ähnelnde Optik, sind durch die Nutzung des Medikamentenschrankes und der darin getrennten Aufbewahrung der sich ähnelnden Medikamente, so gut es geht verhindert.
Die Nachbestellung der Medikamente geschieht automatisch. Die Pflegekräfte müssen nicht mehr daran denken den Reiter der Registerkarte zu ziehen um die Bestellung aufzugeben.
Da die Medikamentenanzahl nun automatisch berechnet wird (Differenz zwischen Lieferung und Gabe) sollte die „Ist-Bestückung“ immer bekannt sein. Das jährliche, zeitintensive, durchzählen der Medikamente entfällt. Erneut können wir hier eine Zeitersparnis feststellen, sie kommt hier den Patienten zugute, da die Pflegekraft mehr Zeit für die Pflege oder die Dokumentation hat.
3.4. BUCHHALTUNG
Zu guter Letzt portiert auch die Abrechnung von einem solchen System. Zwar werden nicht alle Medikamente direkt auf dem Patienten abgerechnet, aber zumindest wird durch ein solches MEDMAN die Fremdmedikation (darunter versteht man die Selbstmedikation des Personals aus dem Bestand des Krankenhauses) weitestgehend verhindert.
Die jährliche Bestandsaufnahme um die Jahresbilanz zu erstellen wird ebenfalls durch die Nutzung des MEDMAN Systems vereinfacht. Es benötigt lediglich die Kontrolle ob der Bestand korrekt ist. Das durchzählen vom fehlerhaften Doppelstock entfällt.
3.5. EBENE KRANKENHAUS
Auf Krankenhausebene birgt ein solches System vor allem in der Qualitätssicherung Vorteile (siehe auch Beschreibung unter Punkt „3.1. Apotheke“). Durch die Nutzung eines MEDMAN können einzelne Kriterien für eine eventuelle Zertifizierung verwirklicht werden. So würde ein MEDMAN z.B. das 6 Niveau der HIMSS EMRAM4 Zertifizierung ermöglichen.
4. NACHTEILE DIESES MANAGEMENTSYSTEMS
Nach den zuvor aufgelisteten Vorteilen stellt sich die Frage, ob für diese Art von Versorgungssystem nur Vorteile existieren, oder ob es auch Risiken bezüglich dieser Nutzung gibt.
4.1. APOTHEKE
Für die Apotheke beinhaltet ein solches System zunächst nur wenige Nachteile (Umstrukturierung der Prozesse und Schulung des Personals). Ein großer Nachteil besteht allerdings im Falle eines Ausfalls des Systems. Zwar ist ein solcher MEDMAN am Sicherheitsgenerator angeschlossen, jedoch besteht die Gefahr eines informatischen Problems (Software oder Hardware). Sollte das Programm selbst, das Betriebssystem oder der Computer selbst nicht mehr funktionieren, so ist ein Teil, oder das gesamte MEDMAN stillgelegt (je nachdem auf welcher Ebene und Abteilung das Problem auftritt).
Ein Lösungsansatz wäre in diesem Fall, den Medikamentenschrank nicht mit einem mechanischen Verschlusssystem zu versehen, sondern mit einem elektronischen Magnetverschluss. Auf diese Art und Weise würde bei einem informatischen Fehler zwar das System festfahren, aber das Trennen vom Stromnetz würde den Zugang zu den advisor Medikamenten frei geben. Eine handschriftliche Dokumentation der entnommenen Medikamente würde die Arbeit der Apotheke zum Auffüllen erleichtern und ein Minimum an Nachvollziehbarkeit garantieren.
Eine weitere Problematik betrifft die falschen Dosierungen und die jedoch richtige Verabreichung. Werden falsche Dosierungen im PDMS verordnet, so erkennt dies das System nicht. Entnimmt nun die Pflegefachkraft allerdings die richtige Quantität des notwendigen Medikamentes, so erhält zwar der Patient die notwendige Dosis, aber das System übermittelt die falsche Anzahl der entnommenen Medikamente.
Dies wird dann bei der Prüfung zwar festgestellt, bis dahin kann allerdings die vorhandene Anzahl des Medikamentes nicht ausreichend sein. Es entsteht hier ein Mehraufwand an zusätzlichen und außerplanmäßigen Arbeitsschritten.
Eine Lösung dieses Problems ist die Integration im PDMS von Fehlermeldungen, bzw. Warnhinweisen, bei Medikamenten die bekannt sind solche Probleme zu verursachen. Nehmen wir z.B. das Medikament Aspegic® in der intravenösen Darreichungsform. Eine Ampulle beinhaltet 500mg Acetylsalicylsäure, aber 900mg Acetylsalicyl-Lysin. Verordnet der Arzt 900mg Aspegic® wird eine Warnmeldung angezeigt um die Dosierung zu bestätigen. Die Normdosis beträgt 500mg da nach dem Inhaltsstoff, Acetylsalicylsäure, verordnet wird. Es wird also verhindert, dass 1 Ampulle entnommen wird (um die richtige Dosierung zu verabreichen), das System aber 2 entnommen Ampullen registriert.
4.2. MEDIZINISCHES PERSONAL
Neben den Zahlreichen Vorteilen bestehen allerdings auch Nachteile für das ärztliche Personal. So können Medikamente nur Verabreicht werden, wenn diese auch im PDMS verordnet wurden. Mündliche Anordnungen (z.B. per Telefon) können so nicht mehr ausgeführt werden und müssen demnach zuvor im System vorhanden sein. Dies stellt vor allem ein Problem beim Notfallmanagement dar. Medikamente sind nicht mehr direkt zugänglich.
Das Erstellen eines, unter Verschluss stehenden, Notfallschrankes mit den Notfallmedikamenten wäre hier eine Möglichkeit zur Behebung dieses Problems. Der Schrank könnte eine Auswahl an Medikamenten beinhalten die zuvor in Absprache zwischen Stationsärzten und Apotheke definiert wurden. Die schnelle Zugänglichkeit zu den lebenswichtigen Medikamenten wäre so garantiert.
Zusätzlich, wurde das System fälschlicherweise mit einer Unverträglichkeitsprüfung missverstanden. Ärzte gingen z.T. davon aus, dass die Unverträglichkeitsprüfung nicht nur die Medikamente untereinander prüfte, sondern auch die Kontraindikationen betreffend die Unverträglichkeit des Patienten mit dem Wirkstoff (siehe Allergie).
4.3. PFLEGEPERSONAL
Das Pflegepersonal hat mit den gleichen Nachteilen zu kämpfen wie das ärztliche Personal. Auf der einen Seite profitieren Sie von der zwangsmäßigen Dokumentation der Verordnungen im PDMS, auf der anderen Seite müssen sie das ärztliche Personal immer wieder an genau diese Dokumentation erinnern.
Auch im Notfall hat das Pflegepersonal, welches auch ohne physisch anwesenden Arzt arbeiten muss, keine Möglichkeit an die lebensrettenden Medikamente wie Adrenalin oder auch Anti-Histaminika zu gelangen. In Luxemburg erteilt die Großherzogliche Verordnung vom 8 März 2009 einem in Anästhesie und Intensivmedizin spezialisierten Fachpfleger, invasive Maßnahmen bei einer Reanimation zu unternehmen, sofern ein zuvor geschriebenes Protokoll besteht und der Anästhesist von diesem Notfall informiert wurde. Die Nutzung der Notfallmedikamente fällt hierbei unter diese Erlaubnis und begründet die Thematik der Nutzung von Medikamenten durch das Pflegepersonal auch ohne direkte Anordnung durch den Arzt.
Die Lösung wäre auch hier das Erstellen eines „Notfallschrankes“ der die Medikamente zum Notfallmanagement bereit stellt. Nachteil ist hier allerdings die notwendige Kontrolle der Verfallsdaten sowie des Inhalts auf Vollständigkeit durch die Apotheke oder Pflegepersonal. Auch der Schlüssel stellt ein Problem dar, er muss an einem zentralen Ort gelagert sein, ist dann allerdings jedem zugänglich (ohne Kontrolle). Ein Ziffernschloss verschafft zwar Abhilfe, bietet aber keinen 100% Schutz vor Fremdzugang.
Zusätzlich begegnet das Pflegepersonal das Problem der halben Dosierungen. Ist von einem Medikament nur die Hälfte der vorlegenden Darreichungsform verordnet, muss das System dennoch die ganze Tablette freigeben. Es liegt nun am Personal dies zu erkennen und die richtige Dosierung zu verabreichen. Erhöhte Vigilanz ist notwendig.
Die Platzierung dieses Punktes unter den Nachteilen für das Pflegepersonal ist sicherlich diskutierbar, es könnte auch im Punkt „Informatik“ seine Berechtigung finden. Jedoch sind die Auswirkungen vor allem für die Pflegekräfte von Bedeutung, weshalb es hier aufgeführt wird.
Im Falle eines Verlustes oder eines Vergessens seines digitalen Dienstausweises (welcher auch die Zugangskarte zum PDMS ist) ist die Pflegekraft gezwungen sich einen provisorischen Badge5 zu besorgen. Dieser berechtigt allerdings nicht den Zugang zum MEDMAN, da die Pflegekraft nicht namentlich hinterlegt werden kann. Sie ist in diesem Fall gezwungen einen Kollegen zur Hilfe zu bitten. Dieser ist dann allerdings auch rechtlich für die Ausgabe und dementsprechend die Verabreichung des Medikamentes verantwortlich, und dies obwohl es sich nicht um seinen Patienten handelt. Alternativ kann die Pflegekraft auch den anwesenden Arzt zur Ausgabehilfe bitten.
4.4. BUCHHALTUNG
Auch für die Buchhaltung, bzw. für die Finanzabteilung, gibt es Nachteile bei der Nutzung eines solchen Systems. So ist nicht nur der Kauf eines solchen Systems mit Kosten verbunden, sondern auch der Unterhalt ist mit Kosten verbunden. Im Unterhalt befinden sich neben den Kosten der Softwarepflege (meistens über jährliche Interventionen im Vertrag geregelt) auch die Kosten zur Umsetzung des gesamten Projektes (von der Planung bis zur effektiven und geregelten Nutzung), sowie die Kosten der Schulung des betroffenen Personals.
4.5. INFORMATIK
Im Gegensatz zum klassischen Medikamentenschranksystem, birgt das MEDMAN ein Risiko welches in jüngster Zeit nicht zu ignorieren war. Durch die Vernetzung im lokalen Netzwerk des Krankenhauses besteht eine Brücke zum externen Netzwerk. Eine solche Verbindung (so klein und indirekt diese auch sein mag) wird zwar durch Firewalls6 geschützt, allerdings sind auch solche Sicherungssysteme kein absoluter Schutz. In der Vergangenheit wurden von sogenannten „Hackern“, Lücken in solchen Systemen ausgenutzt und die informatischen Programme stillgelegt und sozusagen als Geisel genommen. Die betroffenen Firmen wurden gezwungen eine größere Summe als Lösegeld in Form vom kryptischer Währung (und dadurch nicht nachzuverfolgen) zu überweisen um weder die Daten, noch die Funktion dieser Programme zu verlieren.
Neben dieser externen Risikoquelle, besteht allerdings auch ein internes Risiko. Sollte die Informatik vor Netzwerksprobleme gestellt werden, so betreffen diese die gesamten MEDMAN des Krankenhauses da diese auf einem funktionierenden Netzwerk basieren. Ohne Netzwerk, gibt es keine Kommunikation zwischen den einzelnen Bestandteilen (oder Akteure) und demnach keinen Informationsaustausch. Das MEDMAN kann dann nicht mehr funktionieren.
5. SWOT-ANALYSE
Nachdem wir die Vor- und Nachteile betrachtet haben können wir eine SWOT-Analyse erstellen um die einzelnen Punkte gegeneinander aufzuwiegen. Die Gewichtung der Punkte bleibt dabei allerdings rein subjektiv und dient hier nur der Darstellung. Sie ist individuell zu erwägen und fällt je nach Betrachter anders aus.
Als externer Faktor zur positiven Verstärkung, also als Chance, ist die Zertifizierungsmöglichkeit der Klinik anzusehen. Dabei kommen folgende Punkte als relative Stärken zu tragen:
- Die automatische Bestellung und die vereinfachte Kontrolle
- Das Wegfallen eines Doppelstocksystems.
- Der Vorteil betreffend die Patientensicherheit (sowohl die zeitliche Komponente, Verabreichung des Medikamentes, als auch das Medikament an sich).
- Mündliche Verordnungen sind nicht mehr möglich.
- Fremdmedikationen werden stärker vermieden.
Als Risiko ist die Möglichkeit eines Systemausfalls zu betrachten. Er betrifft sowohl den Ausfall des Systems auf informatischer Seite als auch durch Stromausfall.
Beide sind als externe Faktoren anzusehen, da hier die internen Handlungsmöglichkeiten äußerst beschränkt sind.
Die einhergehenden Schwächen sind:
- Keine mündliche Verordnung mehr möglich.
- Die Zugriffsicherheit vor Unbefugten.
- Das Notfallmanagement.
- Die Dosierungsprobleme
- Die einhergehenden Kosten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die zu befolgende Strategie, was die relativen Schwächen betrifft, wurde bereits in den Abschnitten der möglichen Lösungsansätze unter den einzelnen Punkten behandelt.
Eine Strategie zur Bekämpfung des Risikos Systemausfall wäre eine Handlungsabfolge zusammen mit der Informatik und dem Hersteller des Systems zu erstellen um interne Handlungsmöglichkeiten zur Problembehebung zeitnah ausschöpfen zu können. In unseren Breiten- und Längengraden verfügt jedes Krankenhaus über einen Generator. Das System sollte dementsprechend an den gesicherten Stromkreis angeschlossen werden.
Was die relativen Stärken betrifft, so könnte als Strategie, das Verstärken dieser positiven Punkte gegenüber dem Personal genutzt werden. Die Akzeptanz und Bereitschaft zur Nutzung würde dadurch stark erhöht.
6. FAZIT
Das Potenzial eines solchen digitalen Medikamentenmanagements ist noch nicht ganz ausgeschöpft. Die sich damit eröffnenden Möglichkeiten sind für die Zukunft schwer einzuschätzen. Jedoch zeigt sich in der heutigen Form dieses Managementkonzeptes, die Grenze zwischen dem technisch und digital Machbaren und der praktischen Durchführung.
So wie dieses System momentan in diesem Krankenhaus auf der Intensivstation eingesetzt wird, hinderte es das Personal mehr als es ihnen half und konnte sogar in bestimmten Situationen den Patienten in Gefahr bringen. Eine Ausfallmöglichkeit für den Notfall musste, um allen beteiligten einer solchen Abteilung mit kritischen Patientengut erwartungsgerecht zu versorgen, umgesetzt werden. So wurde finanziell investiert um einen Umbau des Verschlussverfahrens auf magnetische Schließmechanismen zu ermöglichen und einen Notfallschrank in der Abteilung zu platzieren.
Andererseits, kann ein solches System die Patientensicherheit um ein Vielfaches erhöhen. Auf einer normalen Versorgungsstation, wäre ein solches Medikamentenmanagement wahrscheinlich angebrachter. Die Hauptmängel die zuvor erörtert wurden, beziehen sich auf Notfallsituationen in denen ein schnelles Handeln notwendig ist. Entscheidet man sich für ein solches Medikamentenausgabesystem, wäre die Nutzung eines separaten Notfallschrankes de facto, nur auf hochspezialisierten Stationen mit Fachpersonal vertretbar.
Wie mit den meisten Neuerungen, ist mit Vorteilen und Nachteilen zu rechnen. Dies ist allerdings ein Prozedere welches durchlaufen werden muss um am Ende einen richtigen Vorteil bieten zu können. Ich bin persönlich vom positiven Nutzen eines solchen MEDMAN Systems überzeugt. Es dient nicht nur dem Schutz des Patienten, sondern ermöglicht in Zukunft auch ein möglichst reibungsloses Arbeiten des gesamten medizinischen Personals und trägt zum Qualitätsmanagement eines Krankenhauses bei.
7. LITERATURVERZEICHNIS
- BARSCH Thomas; „Stand der Digitalisierung im B2B-Neukundenvertrieb“; Entwicklung von Beurteilungskriterien und Erstellung eines Reifegradmodells; Springer Verlag; 2019; 82 Seiten
- BEHRENDT I., KÖNIG H-J. und KRYSTEK U.; „Zukunftsorientierter Wandel im Krankenhausmanagement; „Outsourcing, IT-Nutzenpotenziale; Kooperationsformen, Changemenagement; Springer Science & Business Media; 2009; 389 Seiten
- PUFAHL M. und HAPPE G.; „Innovatives Vertriebsmanagement“; Trends, Branchen, Lösungen; Springer Verlag; 2013; 221 Seiten
- Prof. Dr. SCHUBERT H-J; Studienbrief MGS 710a; „Innovationsmanagement“; 3. Auflage; Technische Universität Kaiserslautern; Unveröffentlicht; 2017; 90 Seiten
- Dr. TOPHOVEN S., BOHM S. und KNÖPPLER K; Studienbrief MGS 740a; „Sektorübergreifende Betreuungs- und Versorgunskonzepte“; 3. Auflage; Technische Universität Kaiserslautern; Unveröffentlicht; 2011; 137 Seiten
- Dr. WIBBELING S.; Studienbrief MGS 720a; „Logische Prozesse im Krankenhaus“; 2. Auflage; Technische Universität Kaiserslautern; Unveröffentlicht; 103 Seiten
[...]
1 Patienten Daten Management System
2 Englisches Wort für Dienstausweis.
3 Englisches Wort für Werkzeug.
4 Zertifizierungsprogramm von Himms Analytics, eine US-amerikanische Firma.
5 Englisches Wort für Dienstausweis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Analyse?
Diese Analyse befasst sich mit dem Einsatz eines digitalen Medikamentenmanagementsystems (MEDMAN) in Krankenhäusern, insbesondere in Kombination mit einem Patienten Daten Management System (PDMS). Sie untersucht die Vor- und Nachteile eines solchen Systems, wobei der Fokus auf der Nutzung auf einer Intensivstation in Luxemburg liegt.
Was sind die Vorteile eines digitalen Medikamentenmanagements für die Apotheke?
Die Apotheke profitiert von einer verbesserten Distributionslogistik, da Bestellvorgänge digital abgewickelt werden und somit Personalressourcen eingespart werden. Die Erfassung des Medikamentenbedarfs erfolgt in Echtzeit, wodurch Fehler vermieden und Zeit gespart wird. Die Kontrolle der Verfallsdaten wird vereinfacht, und das Qualitätsmanagement wird durch die Möglichkeit verbessert, sich optisch ähnelnde Medikamente getrennt zu lagern.
Welche Vorteile ergeben sich für das medizinische Personal durch das digitale Medikamentenmanagement?
Ärzte können nur im System der Apotheke geführte Medikamente verordnen, wodurch Rückfragen vermieden werden. Verordnete Medikationen können nur innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens entnommen werden, was als zusätzliche Kontrolle dient. Die Verwechslungsgefahr wird durch die Verbindung der Ausgabe mit der Patientenidentifikation reduziert.
Wie profitiert das Pflegepersonal von diesem System?
Das Pflegepersonal kann sich darauf verlassen, dass die ausgegebenen Medikamente noch haltbar sind und dass Verwechslungen durch die getrennte Aufbewahrung ähnlicher Medikamente minimiert werden. Die Nachbestellung von Medikamenten erfolgt automatisch. Die jährliche, zeitaufwendige Medikamenteninventur entfällt.
Welche Vorteile ergeben sich für die Buchhaltung?
Die Abrechnung wird durch die weitgehende Verhinderung von Fremdmedikation (Selbstmedikation des Personals) verbessert. Die jährliche Bestandsaufnahme zur Erstellung der Jahresbilanz wird vereinfacht.
Welche Vorteile ergeben sich auf Krankenhausebene?
Auf Krankenhausebene bietet das System Vorteile in der Qualitätssicherung. Die Nutzung eines MEDMAN kann die Erfüllung von Kriterien für eine Zertifizierung, wie z.B. das 6. Niveau der HIMSS EMRAM Zertifizierung, ermöglichen.
Was sind die Nachteile des digitalen Medikamentenmanagements für die Apotheke?
Ein großer Nachteil ist die potenzielle Stilllegung des Systems im Falle eines Ausfalls (Software oder Hardware). Falsche Dosierungen im PDMS werden nicht automatisch erkannt, was zu Fehlern in der Medikamentenerfassung führen kann.
Welche Nachteile ergeben sich für das medizinische Personal?
Medikamente können nur verabreicht werden, wenn sie im PDMS verordnet wurden, was mündliche Anordnungen (z.B. per Telefon) erschwert. Dies stellt insbesondere im Notfallmanagement ein Problem dar.
Welche Nachteile betreffen das Pflegepersonal?
Das Pflegepersonal ist auf die Dokumentation der Verordnungen im PDMS durch das ärztliche Personal angewiesen. Im Notfall haben Pflegekräfte keinen direkten Zugriff auf lebensrettende Medikamente. Es können Probleme bei der Verabreichung halber Dosierungen auftreten. Bei Verlust des Dienstausweises kann die Medikamentenentnahme erschwert sein.
Welche Nachteile gibt es für die Buchhaltung?
Die Anschaffung und der Unterhalt des Systems sind mit Kosten verbunden, einschließlich Softwarepflege, Projektumsetzung und Personalschulung.
Welche Nachteile betreffen die Informatik?
Durch die Vernetzung im Krankenhausnetzwerk besteht ein Risiko durch externe (Hackerangriffe) und interne (Netzwerkprobleme) Faktoren. Ein Ausfall des Netzwerks kann die gesamte MEDMAN-Funktionalität beeinträchtigen.
Was ist die SWOT-Analyse und wie wird sie angewendet?
Die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) wird verwendet, um die Vor- und Nachteile des digitalen Medikamentenmanagementsystems gegenüberzustellen. Die Gewichtung der einzelnen Punkte ist subjektiv und dient der Darstellung. Strategien zur Bekämpfung der Schwächen und Risiken sowie zur Verstärkung der Stärken werden diskutiert.
Was ist das Fazit dieser Analyse?
Das digitale Medikamentenmanagement hat ein großes Potenzial, ist aber in seiner aktuellen Form nicht vollständig ausgereift. Es bietet Vorteile hinsichtlich Patientensicherheit und Qualitätsmanagement, kann aber auch Herausforderungen im Notfallmanagement und bei Systemausfällen mit sich bringen. Die Einführung eines solchen Systems sollte sorgfältig geplant und an die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Station angepasst werden. Es ist wichtig, das System so anzupassen, dass es das Personal unterstützt und nicht behindert und sogar Patienten in Gefahr bringt.
- Quote paper
- Dominique Raum (Author), 2021, Auswirkungen der Digitalisierung auf das Medikamentenmanagement. Externe Chancen und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1139029