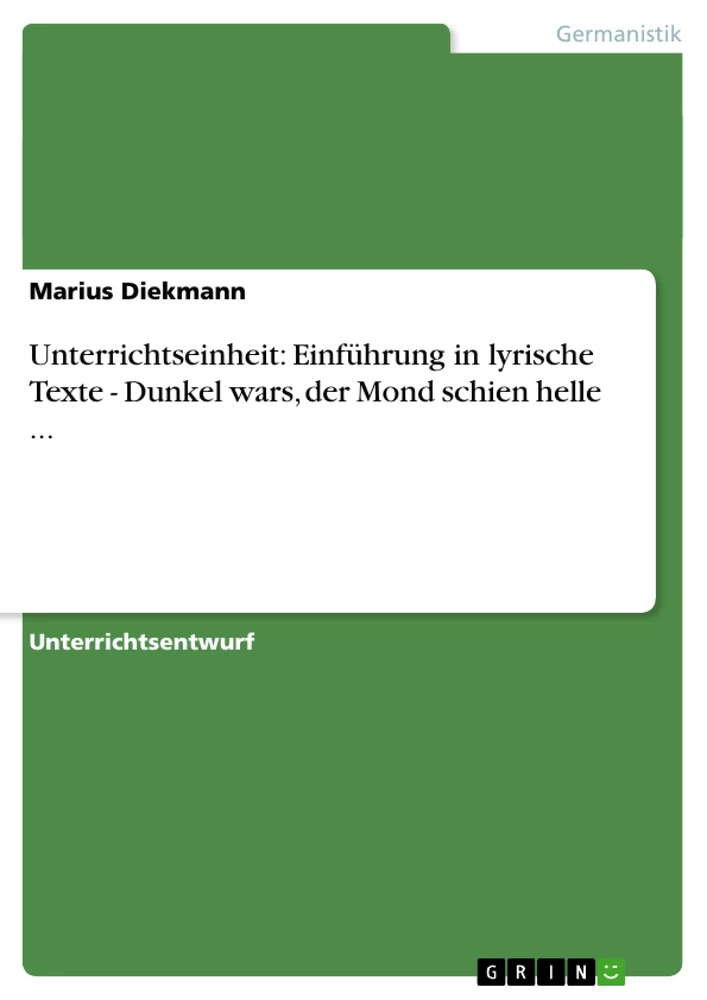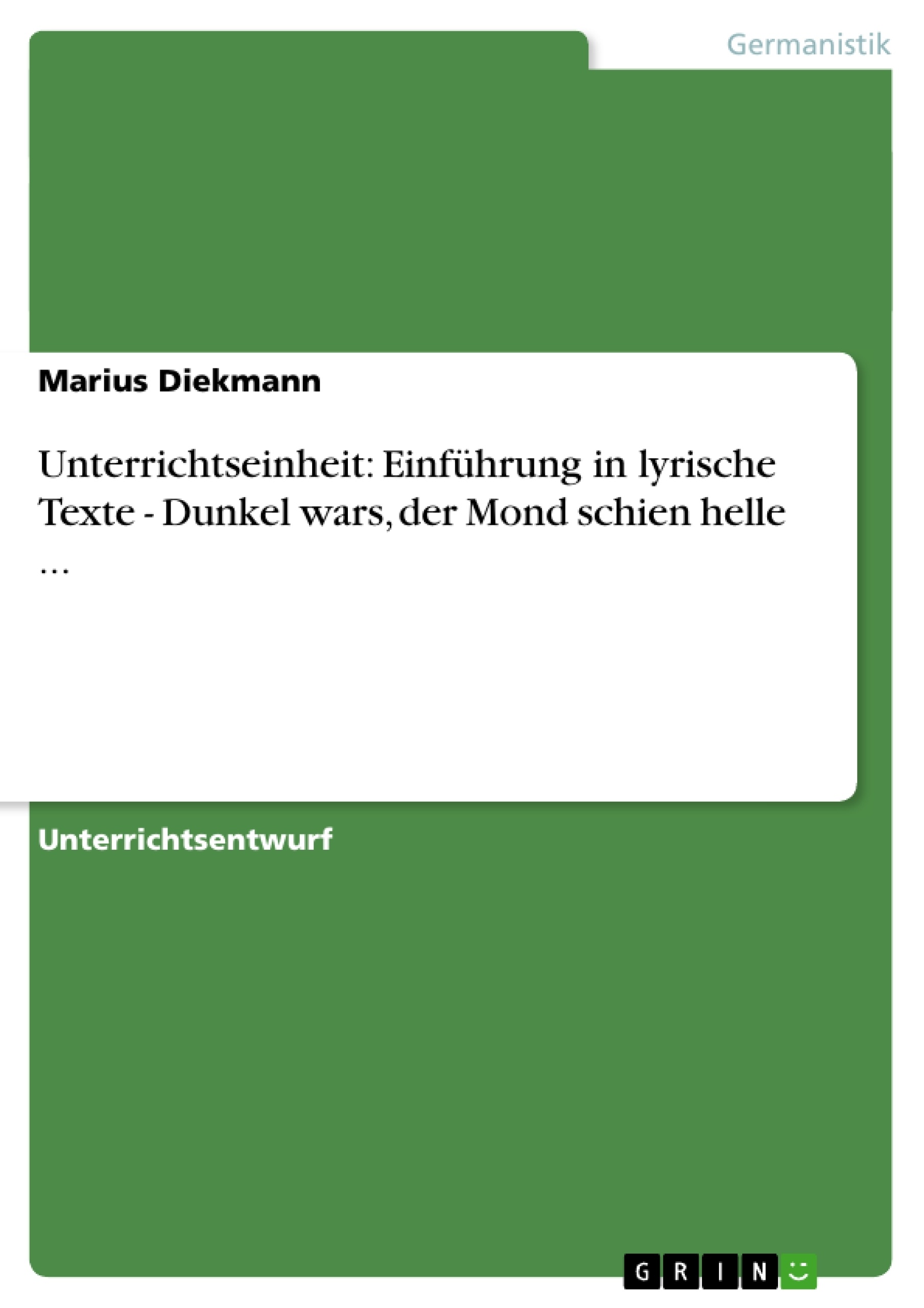Humor ist Geschmackssache und hat viele Gesichter. Eines davon ist der Witz.
Dieser gehört nach A. Jolles zu den „einfachen Formen“1 - d. h. zu den
Grundformen sprachlichen Gestaltens, die keinem historischen Wandel unterliegen.
Es sind sprachliche Ereignisse, zu verorten in bestimmten Situationen und
Lebensbereichen, „vorgegebene Gestalten, die sich, sozusagen ohne Zutun eines
Dichters, in der Sprache selbst ereignen."2
Gerade der Witz als Grundform ermöglicht eine Kommunikationsebene, die den
Austausch zwischen SuS und der/dem Lehrenden erleichtert, so kann den SuS der
Weg geebnet werden, Texten auf einer ihnen vertrauten Gefühlsebene zu
begegnen. Durch die Pointe wird plötzlich eine unerwartete Richtung eröffnet. Die
bisher aufgebaute Spannung bzw. der erwartete Verlauf muss neu überdacht
werden. Zwar ist mit der Pointe auch der Witz für immer verloschen, doch bleibt ein
Gefühl zurück.
Genau an dieser Stelle kann ein Einstieg in lyrische Texte greifen. Bei dem
Erzeugen von Spannung und Verwirrung im Sinne eines „alltäglichen“ Witzes und
den in lyrischen Texten zu findenden Rhetorischen Figuren gibt es
Überschneidungen. Es können „Lernprozesse in Gang gesetzt werden“ indem an
„die Sprache, die den Kindern vertraut ist“3 angeknüpft wird. Häufig wird die
Spannung in einem Witz in einem unerwarteten Gegensatz aufgelöst - contradictio
in adiecto. Das Oxymoron und das Paradoxon beschreiben genau diesen Vorgang.
Metonymien laden geradezu zur Übertreibung oder Vereinfachung (Verballhornung)
ein. Kombinationen verschiedener, unpassender Wörter, zusammengefügt zu
einem neuen Sinn, können belustigen und verwirren. Und das können sie ebenfalls
in Form der Metapher. Auch die Verbindung unterschiedlicher Wörter durch
Reimschemata ermöglicht eine humorige Kombination. Nicht zu Letzt das von
Heinz Erhardt so häufig eingesetzte Zeugma, lässt einen völlig neuen Blick auf das
Gesagte und Gesprochene zu. Genau dieser neue, andere Blick ist es, den ich mit dem Thema der
Unterrichtsreihe "Sprache und Humor" anstrebe.
1 Vgl.: Belke, Horst: Einfache Formen. In: Arnold, H. L., Sinemus, v. (Hg.): Grundzüge der Literatur- und
Sprachwissenschaft München 1973, S. 269 - 274.
2 Ebd.: S. 269.
3 Richtlinien und Lehrpläne NRW. Gesamtschule, Deutsch Sekundarstufe I, S. 27.
Inhaltsverzeichnis
- Die Unterrichtsreihe
- Thema der Unterrichtsreihe
- Ziele und Voraussetzungen der Unterrichtsreihe
- Umfang und Sequenzen der Unterrichtsreihe
- Die Unterrichtsstunde
- Thema der Unterrichtsstunde
- Stellung der Unterrichtsstunde im Rahmen der Reihe
- Didaktische Analyse
- Stundenkonzept und methodische Entscheidungen
- Stundenziel und Teilziele
- Anhang
- Verlaufsskizze
- Mögliches Tafelbild
- Unterrichtstext - „Dunkel war's der Mond schien helle...“
- Hausaufgabentext - „Die kaiserliche Botschaft“
- Weitere mögliche Texte der Unterrichtsreihe
- Zweite Sequenz der Reihe
- Dritte Sequenz der Reihe
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtsreihe zielt darauf ab, bei Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 5 Interesse und Verständnis für Lyrik zu wecken und sie an die selbständige Analyse und Interpretation lyrischer Texte heranzuführen. Der Fokus liegt auf einem motivierenden Zugang über den Humor und die Sprache, um die Schüler auf einer vertrauten Gefühlsebene an die Thematik heranzuführen.
- Einführung in die Lyrik auf motivierende Weise durch den Einsatz von Humor.
- Vermittlung grundlegender Begriffe der Gedichtanalyse (Reim, Strophe, Vers, Reimschema).
- Förderung der selbständigen Textanalyse und Interpretation.
- Reflexion über Sprache als variables Ausdrucksmittel.
- Verbindung von Alltagswissen (Humor) mit literarischen Mitteln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unterrichtsreihe: Diese Reihe befasst sich mit der Einführung in lyrische Texte, wobei der Humor als motivierendes Element im Vordergrund steht. Sie analysiert den Witz als "einfache Form" sprachlichen Gestaltens und zeigt dessen Überschneidungen mit rhetorischen Figuren in der Lyrik. Ziel ist es, Lernprozesse anzustoßen, indem an die vertraute Sprache der Schüler angeknüpft wird und die Spannung und Verwirrung, wie sie in Witzen vorkommen, mit den in lyrischen Texten verwendeten Mitteln in Verbindung gebracht werden. Die Reihe soll Interesse an Lyrik wecken und die Schüler an die eigenständige Analyse heranführen.
Ziele und Voraussetzungen der Unterrichtsreihe: Die Ziele dieser Reihe sind das Wecken von Interesse und Verständnis für Lyrik sowie die Heranführung an die selbstständige Analyse und Interpretation lyrischer Texte. Vorausgesetzt wird lediglich ein grundlegendes Verständnis von Sprache als variablem Ausdrucksmittel. Die Schüler sollen bereits die Fähigkeit zur Sprachreflexion besitzen und Sprache als Medium begreifen, mit dem derselbe Sachverhalt unterschiedlich dargestellt werden kann.
Umfang und Sequenzen der Unterrichtsreihe: Die Unterrichtsreihe umfasst etwa zwölf Stunden und ist in drei Sequenzen unterteilt. Die erste Sequenz dient der Einführung in die Lyrik, wobei "Sprache und Humor" den Zugang bilden, um die Motivation der Schüler zu fördern. Neben der Freude an den Texten sollen die Schüler grundlegende Begriffe der Gedichtanalyse kennenlernen (Reim, Strophe, Vers, Reimschema). Die darauffolgenden Sequenzen bauen auf dieser Basis auf und vertiefen die Analysefähigkeiten der Schüler.
Schlüsselwörter
Lyrik, Gedichtanalyse, Humor, Sprache, Rhetorische Figuren, Witz, Reim, Strophe, Vers, Reimschema, Textinterpretation, Leseförderung, Lesevergnügen, Didaktik, Unterrichtsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsreihe: Lyrik mit Humor
Was ist das Thema der Unterrichtsreihe?
Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 5 Interesse und Verständnis für Lyrik zu vermitteln und sie an die selbständige Analyse und Interpretation lyrischer Texte heranzuführen. Der Fokus liegt auf einem motivierenden Zugang über den Humor und die Sprache.
Welche Ziele werden in der Unterrichtsreihe verfolgt?
Die Ziele sind das Wecken von Interesse und Verständnis für Lyrik sowie die Heranführung an die selbstständige Analyse und Interpretation lyrischer Texte. Die Schüler sollen grundlegende Begriffe der Gedichtanalyse (Reim, Strophe, Vers, Reimschema) erlernen und Sprache als variables Ausdrucksmittel reflektieren. Die Verbindung von Alltagswissen (Humor) mit literarischen Mitteln spielt eine wichtige Rolle.
Wie ist die Unterrichtsreihe aufgebaut?
Die Reihe umfasst etwa zwölf Stunden und ist in drei Sequenzen unterteilt. Die erste Sequenz dient der Einführung in die Lyrik mit dem Schwerpunkt "Sprache und Humor". Die folgenden Sequenzen bauen darauf auf und vertiefen die Analysefähigkeiten der Schüler. Die Reihe beinhaltet die Analyse von Witzen als "einfache Form" sprachlichen Gestaltens und deren Überschneidungen mit rhetorischen Figuren in der Lyrik.
Welche Voraussetzungen müssen die Schüler mitbringen?
Es wird lediglich ein grundlegendes Verständnis von Sprache als variablem Ausdrucksmittel vorausgesetzt. Die Schüler sollen bereits die Fähigkeit zur Sprachreflexion besitzen und Sprache als Medium begreifen, mit dem derselbe Sachverhalt unterschiedlich dargestellt werden kann.
Welche Texte werden in der Unterrichtsreihe verwendet?
Die Reihe beinhaltet den Unterrichtstext „Dunkel war's der Mond schien helle...“ und den Hausaufgabentext „Die kaiserliche Botschaft“. Zusätzlich werden weitere Texte in den zweiten und dritten Sequenzen der Reihe behandelt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Unterrichtsreihe?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Lyrik, Gedichtanalyse, Humor, Sprache, Rhetorische Figuren, Witz, Reim, Strophe, Vers, Reimschema, Textinterpretation, Leseförderung, Lesevergnügen, Didaktik, Unterrichtsgestaltung.
Wie wird der Humor in der Unterrichtsreihe eingesetzt?
Der Humor dient als motivierendes Element, um den Schülern einen vertrauten und interessanten Zugang zur Lyrik zu ermöglichen. Die Analyse von Witzen soll die Schüler an die in lyrischen Texten verwendeten sprachlichen Mittel heranführen.
Wie ist der Umfang der Unterrichtsreihe?
Die Unterrichtsreihe umfasst ca. zwölf Unterrichtsstunden.
Welche methodischen Entscheidungen wurden getroffen?
Die konkreten methodischen Entscheidungen sind im Stundenkonzept der einzelnen Stunden detailliert beschrieben (im Anhang enthalten, hier nicht explizit aufgeführt).
Welche Kapitel umfasst die Unterrichtsreihe?
Die Unterrichtsreihe umfasst Kapitel zu: Der Unterrichtsreihe (Thema, Ziele, Umfang, Sequenzen), der Unterrichtsstunde (Thema, Stellung, didaktische Analyse, Stundenkonzept, Ziele), einem Anhang (Verlaufsskizze, Tafelbild, Unterrichtstexte, Hausaufgabentext), weiteren möglichen Texten und Literatur.
- Quote paper
- Marius Diekmann (Author), 2002, Unterrichtseinheit: Einführung in lyrische Texte - Dunkel wars, der Mond schien helle ..., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11389