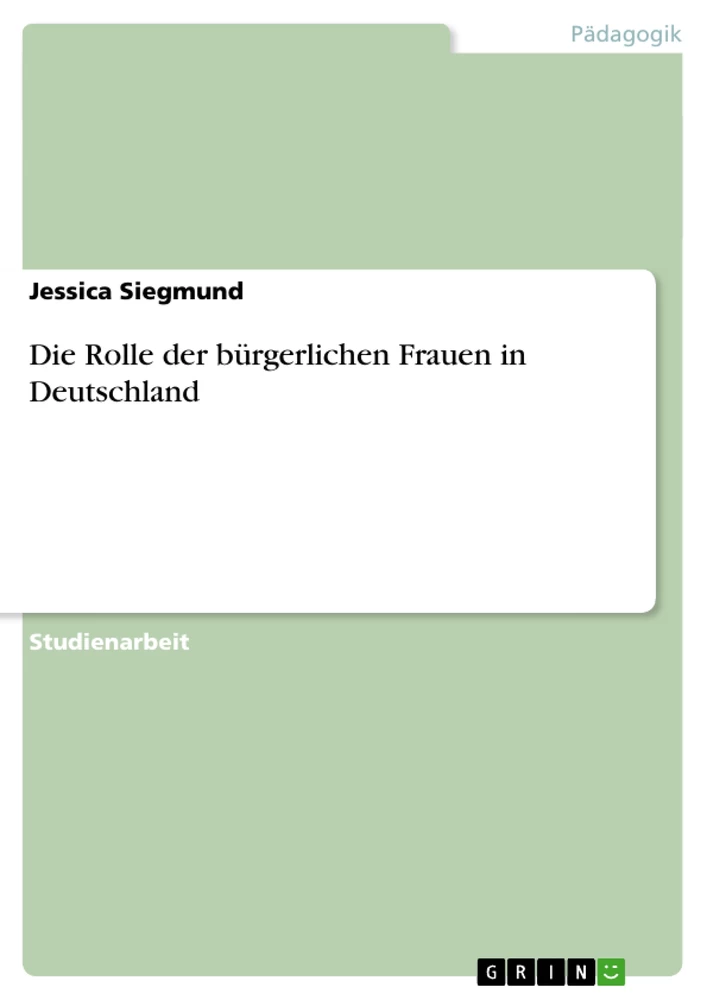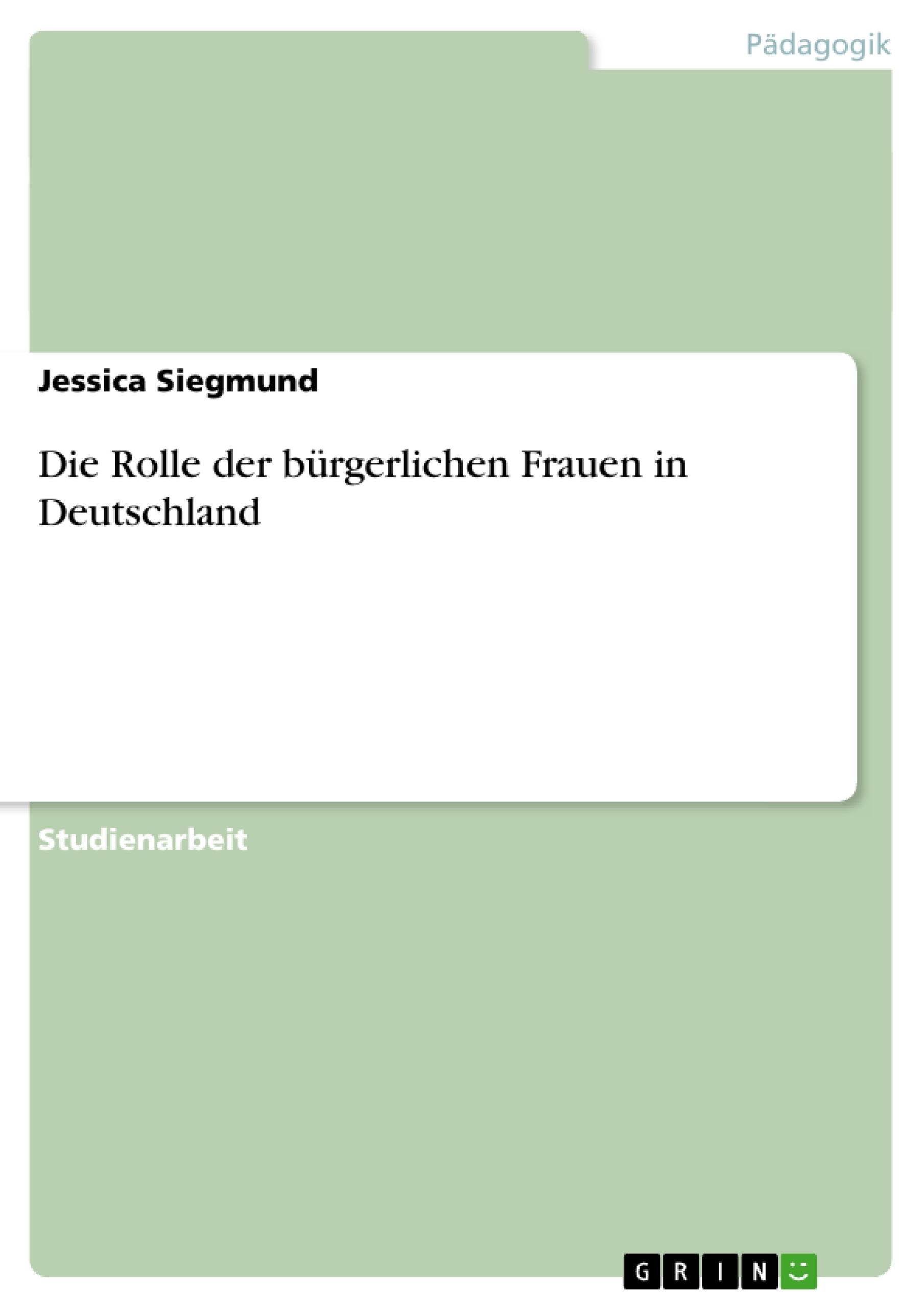Im 19. Jahrhundert schwankte das Bürgertum zwischen dem Festhalten an alten Werten, aber wollte auch einen Ausbruch aus diesem alten, überholten und verfestigten System erlangen. In dieser Hausarbeit möchte ich aufzeigen, welche Rolle die Frauen zu der damaligen Zeit in dieser Umbruchphase spielten und welche Möglichkeiten sie suchten, um ihre Vorstellungen und Pläne, wie zum Beispiel das Recht auf Bildung und Arbeit, durchzusetzen.
Als typisch bürgerliche Gesellschaft soll hier die Form gelten, in der eine gesellschaftliche und soziale Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern vorherrscht, wobei die Frauen sich mit ihrer zugewiesenen Rolle der passiven und unmündigen Ehefrau abfanden.
Zunächst soll die Rolle der Frau in gesellschaftlicher Hinsicht beschrieben werden. Sie verhalf dem Mann und der Familie durch standesgemäße Lebens- und Haushaltsführung zu ihrem Ansehen, welches auch mit ihrer Tüchtigkeit steigen und sinken konnte. Aufgrund des häufig vorherrschenden Geldmangels in den Familien waren die Frauen gezwungen, sich Mittel und Wege zu suchen, wie sie den standesgemäßen Schein, ohne finanzielle Mittel, aufrechterhalten konnten. Neben diesen Tätigkeiten werde ich zudem über die Lebensumstände der Dienstmädchen und der Frauen schreiben, die nicht verheiratet waren.
Anschließend soll auf die Ehre der Frauen eingegangen werden, welche für die damalige Zeit besonders wichtig für den gesellschaftlichen Stellenwert war. Die Ehre war das Einzige, was auch die Frauen in der damaligen Zeit erreichen konnten, wobei auch diese immer mit dem Ehemann gekoppelt wurde. Aber dennoch war es damals das einzige Kapital, dass eine Frau haben konnte. Die möglichen Auswirkungen des Verlustes der Ehre möchte ich an dem Beispiel des Ehebruchs aufweisen.
Im dritten Teil der Arbeit soll die Geschichte der Frauenbewegungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt werden, wobei sowohl die Schwierigkeiten der Frauen bei ihren Emanzipationsversuchen, als auch die Gründung der ersten Frauenvereine in Deutschland angesprochen werden sollen. Dabei soll darauf eingegangen werden, ob die Frauen wirklich eine Gleichbehandlung und Gleichstellung nach bürgerlichem Ideal erreichen konnten oder ob die Frauen nach den Frauenbewegungen noch immer in der klassischen Rollenverteilung von Mann und Frau verblieben sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands im 19. Jahrhundert
- Die Situation der Hausfrauen
- Die Situation der Dienstmädchen
- Die Situation der unverheirateten Frauen des Bürgertums
- Die Ehre der Frau
- Die Ehre als ihr größtes Kapital
- Verlust der Ehre am Beispiel des Ehebruchs
- Die deutsche Frauenbewegung von ihren Anfängen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
- Die Ausgangslage
- Die Schwierigkeiten der deutschen Frauenbewegung
- Die Gründung der ersten deutschen Frauenvereine
- Die Frauenbewegung von 1894 – 1933
- Die bürgerliche Frauenbewegung
- Die proletarische Frauenbewegung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle der bürgerlichen Frauen in Deutschland im 19. Jahrhundert. Sie analysiert die gesellschaftlichen Erwartungen und die Lebensbedingungen von Frauen in dieser Zeit, wobei der Fokus auf der Hausfrau, dem Dienstmädchen und der unverheirateten Frau liegt. Die Arbeit untersucht auch die Bedeutung der Ehre für Frauen und die Herausforderungen, die sie im Kontext der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert bewältigen mussten.
- Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft
- Die Bedeutung der Ehre für Frauen
- Die Herausforderungen der Frauenbewegung
- Die Lebensbedingungen von Hausfrauen, Dienstmädchen und unverheirateten Frauen
- Die Entwicklung der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Rolle der Frau im 19. Jahrhundert dar und skizziert die Ziele der Hausarbeit. Sie beleuchtet den Wandel des Bürgertums und die Suche der Frauen nach Möglichkeiten, ihre Vorstellungen und Pläne durchzusetzen.
Das zweite Kapitel beschreibt die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die Situation der Hausfrauen, Dienstmädchen und unverheirateten Frauen des Bürgertums. Die Hausfrau hatte eine Dreifachrolle als Gattin, Mutter und Haushälterin zu erfüllen. Sie war für den Haushalt zuständig und musste die Bedürfnisse des Ehemannes und der Kinder erfüllen. Dienstmädchen waren oft gezwungen, in prekären Arbeitsbedingungen zu arbeiten, während unverheiratete Frauen des Bürgertums oft gesellschaftlich isoliert waren.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Ehre der Frau im 19. Jahrhundert. Die Ehre war das wichtigste Kapital einer Frau und war eng mit dem Ehemann verbunden. Der Verlust der Ehre, beispielsweise durch Ehebruch, hatte schwerwiegende gesellschaftliche Folgen.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Geschichte der Frauenbewegungen ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Es beschreibt die Schwierigkeiten der Frauen bei ihren Emanzipationsversuchen und die Gründung der ersten Frauenvereine in Deutschland. Die Arbeit untersucht, ob die Frauen eine Gleichbehandlung und Gleichstellung nach bürgerlichem Ideal erreichen konnten oder ob sie nach den Frauenbewegungen noch immer in der klassischen Rollenverteilung von Mann und Frau verblieben sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert, die bürgerliche Gesellschaft, die Hausfrau, das Dienstmädchen, die unverheiratete Frau, die Ehre, die Frauenbewegung, die Emanzipation und die Gleichstellung.
- Quote paper
- Jessica Siegmund (Author), 2004, Die Rolle der bürgerlichen Frauen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113797