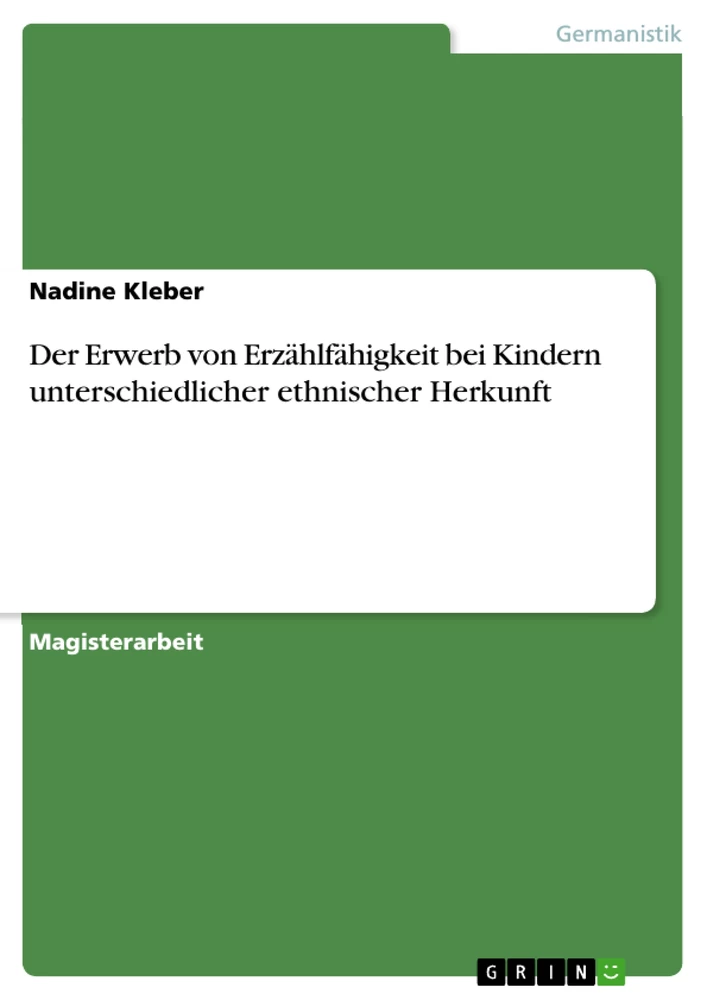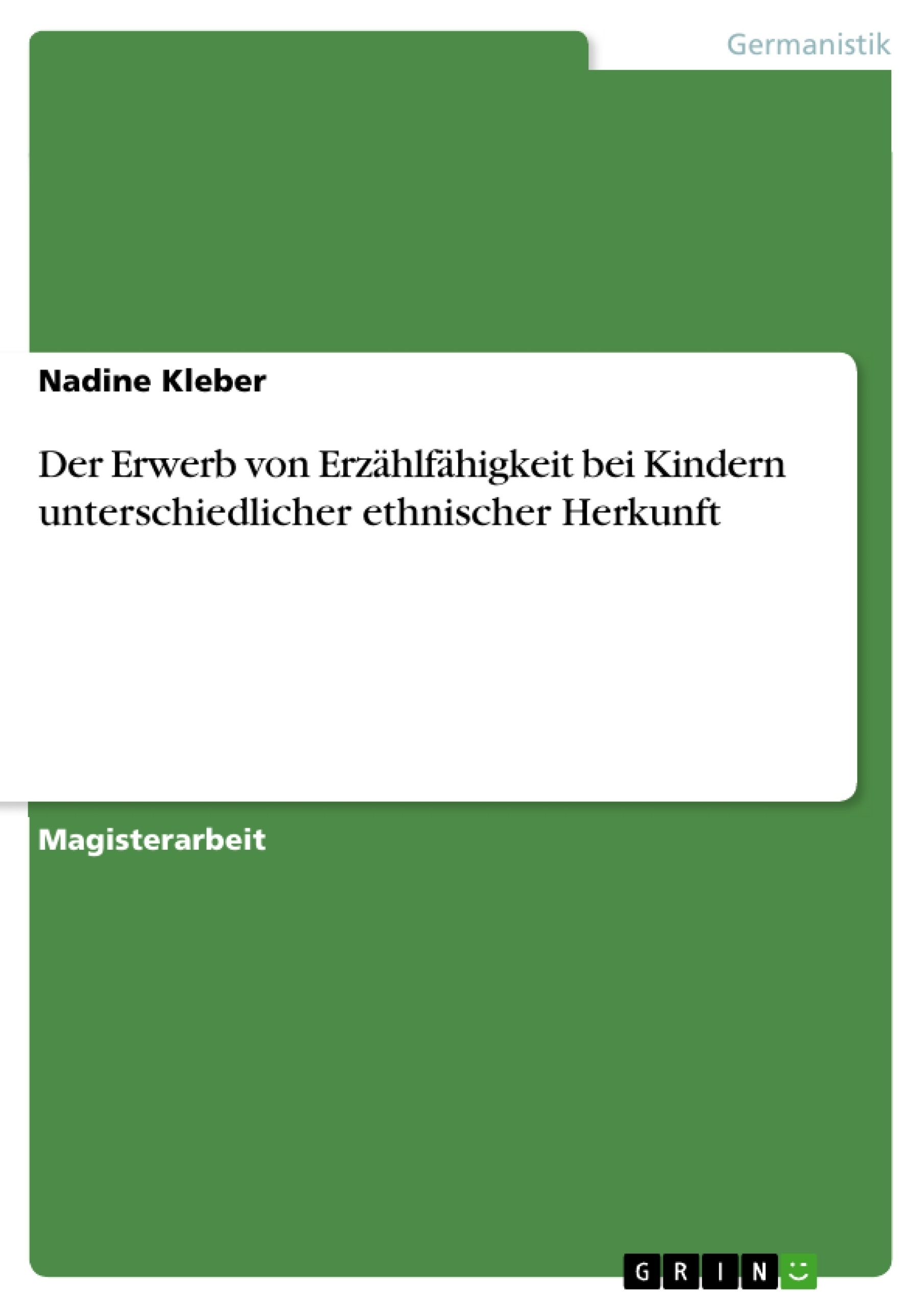Das Ziel der vorliegenden Studie ist, die linguistischen Defizite von Kindern mit Migrationshintergrund gegenüber ihren Mitschülern deutscher Herkunft aufzuzeigen und in ihrer Ausprägungsstärke wiederzugeben. Ob überhaupt, und wenn ja, wie sie in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen, sollte anhand verschiedener Messgrößen untersucht werden.
Zu diesem Zweck wird zunächst der aktuelle Stand der Forschung im Hinblick auf die Funktionen und Strukturen von Erzählungen sowie auf den Erwerb der Erzählfähigkeit dargestellt. Ebenso wird kurz eine Abgrenzung des Erzählens vom Berichten und Beschreiben vorgenommen. Um Unterschiede in der Erzählfähigkeit von Kindern mit Migrationshintergrund zu Kindern deutscher Herkunft aufzeigen und sprachliche Differenzen und Besonderheiten ausarbeiten zu können, werden im Anschluss daran Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren unterschiedlicher ethnischer Herkunft im Hinblick auf ihre Erzählfähigkeit, die Lexemverwendung, die Mittel der Kohäsion und Kohärenz, die Strukturiertheit und die Zuordenbarkeit zu einer kognitiven Entwicklungsstufe nach Boueke et al. untersucht. Abschließend wird ein Resümee gezogen und ein Ausblick gewagt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Dimensionen des Erzählens: Der Stand der Forschung
- Zur Definition von Erzählen
- Funktionen des Erzählens
- Sprecher-, hörer- und kontext-orientierte Funktionen (Quasthoff 1980)
- Funktionalisiertes Erzählen, innere und Tiefenfunktionen (Ehlich 1983)
- Erzählen als Handlungsmodus (Rath 1981)
- Zusammenfassung
- Erzählstrukturen
- Das Höhepunktmodell (Labov/Waletzky 1967)
- Höhepunkterzählung vs. Geflechterzählung (Wagner 1986)
- Das Modell der fünf Jobs (Hausendorf/Quasthoff 1989)
- Das Konzept der „story grammars“ (Rumelhart 1975)
- Die narrative Superstruktur (van Dijk 1980)
- Die Relationsstruktur (Quasthoff 1980)
- Das Modell der Markierungen (Boueke et al. 1995)
- Zusammenfassung
- Der Erwerb von Erzählfähigkeit
- Erzählerwerb beim Spracherwerb
- Erzählerwerb als interaktiver Prozess
- Erzählerwerb als Entwicklung der Textkonstitution
- Erzählerwerb als Entwicklung eines kognitiven Schemas
- Erzählerwerb als Entwicklung einer Höhepunktstruktur
- Das Modell der sieben „patterns“ (Peterson/McCabe 1983)
- Das Vier-Stufen-Modell (Boueke et al. 1995)
- Diskussion
- Zusammenfassung
- Die Studie
- Der Berliner Ortsteil Wedding
- Das Erzählprojekt
- Die Kinder
- Methodik
- Linguistische Analyse der Nacherzählungen
- Strukturanalyse
- Analyse nach dem Vier-Stufen-Modell (Boueke et al. 1995)
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den Erwerb von Erzählfähigkeit bei Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Ziel ist es, die sprachlichen Fähigkeiten im Kontext des Erzählens zu analysieren und Unterschiede in Bezug auf Erzählstruktur, Lexik und Kohärenz aufzuzeigen.
- Der Einfluss der ethnischen Herkunft auf den Erzählerwerb
- Analyse von Erzählstrukturen und deren Entwicklung
- Untersuchung des Wortschatzes und der lexikalischen Diversität
- Die Rolle von Kohäsion und Kohärenz im Erzählen
- Vergleich der Nacherzählungen mit den Originalgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Erzählerwerbs bei Kindern mit Migrationshintergrund ein. Sie betont die Bedeutung des Spracherwerbs für Integration und Kommunikation und hebt die besonderen Herausforderungen des Erzählens hervor, da dieses mehr als die bloße Wiedergabe von Abläufen erfordert. Es werden die komplexen Anforderungen an Zeitstrukturen, fantasievolle Ausschmückungen und kohärente Erzählstrukturen herausgestellt, die selbst bei Kindern mit gutem Wortschatz Defizite offenbaren können.
Die Dimensionen des Erzählens: Der Stand der Forschung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand zum Thema Erzählen. Es definiert den Begriff „Erzählen“, untersucht dessen Funktionen aus verschiedenen Perspektiven (Sprecher, Hörer, Kontext) und analysiert verschiedene Modelle der Erzählstruktur, darunter das Höhepunktmodell, Geflechterzählungen, "story grammars", und die narrative Superstruktur. Der Fokus liegt auf dem Erwerb von Erzählfähigkeit als komplexer Entwicklungsprozess, der verschiedene Aspekte wie den Spracherwerb, interaktive Prozesse, Textkonstitution und kognitive Schemata umfasst. Verschiedene Modelle der Entwicklung der Höhepunktstruktur werden detailliert vorgestellt und diskutiert.
Die Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Studie. Es wird der Berliner Ortsteil Wedding als Untersuchungsort vorgestellt, die beteiligte Schule und die Auswahl der Kinder erläutert. Die ethnische Herkunft der Kinder und die Ergebnisse eines Sprachstandtests werden dargestellt. Die Methodik der Datenerhebung und -analyse wird detailliert beschrieben, inklusive der linguistischen Analyse der Nacherzählungen (Erzähldauer, Lexemverwendung, Kohäsion und Kohärenz) und der Strukturanalyse nach verschiedenen Modellen. Die Kapitel beschreibt die verschiedenen Methoden der Datenauswertung und deren Begründung.
Schlüsselwörter
Erzählfähigkeit, Spracherwerb, Migrationshintergrund, Erzählstrukturen, Lexik, Kohäsion, Kohärenz, empirische Studie, Kinder, linguistische Analyse, Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Erzählfähigkeit bei Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Erwerb von Erzählfähigkeit bei Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft im Berliner Ortsteil Wedding. Der Fokus liegt auf der Analyse sprachlicher Fähigkeiten im Kontext des Erzählens und dem Aufzeigen von Unterschieden in Erzählstruktur, Lexik und Kohärenz.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der ethnischen Herkunft auf den Erzählerwerb, analysiert die Entwicklung von Erzählstrukturen, untersucht den Wortschatz und die lexikalische Diversität, betrachtet die Rolle von Kohäsion und Kohärenz im Erzählen und vergleicht die Nacherzählungen mit den Originalgeschichten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Methodik. Es wurden Kinder im Berliner Ortsteil Wedding untersucht. Die Datenerhebung umfasste die Analyse von Nacherzählungen, wobei die linguistische Analyse Aspekte wie Erzähldauer, Lexemverwendung, Kohäsion und Kohärenz berücksichtigte. Die Strukturanalyse erfolgte nach verschiedenen etablierten Modellen (z.B. dem Vier-Stufen-Modell von Boueke et al. 1995).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Theorien und Modelle des Erzählens, einschließlich der Definition von Erzählen, seiner Funktionen aus verschiedenen Perspektiven (Sprecher, Hörer, Kontext), und verschiedener Modelle der Erzählstruktur (Höhepunktmodell, Geflechterzählungen, "story grammars", narrative Superstruktur etc.). Der Erwerb von Erzählfähigkeit wird als komplexer Entwicklungsprozess betrachtet, der Spracherwerb, interaktive Prozesse, Textkonstitution und kognitive Schemata umfasst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Stand der Forschung zum Thema Erzählen, ein Kapitel zur Beschreibung der Studie (Methodik, Teilnehmer, Datenerhebung und -analyse) und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erzählfähigkeit, Spracherwerb, Migrationshintergrund, Erzählstrukturen, Lexik, Kohäsion, Kohärenz, empirische Studie, Kinder, linguistische Analyse, Mehrsprachigkeit.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet, Unterschiede in der Erzählfähigkeit von Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft aufzuzeigen. Diese Unterschiede betreffen voraussichtlich die Erzählstruktur, den Wortschatz, die lexikalische Diversität, die Kohäsion und die Kohärenz der Erzählungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sprachwissenschaftler, Pädagogen, Logopäden und alle, die sich mit Spracherwerb, Mehrsprachigkeit und der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund befassen.
- Quote paper
- Nadine Kleber (Author), 2008, Der Erwerb von Erzählfähigkeit bei Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113725