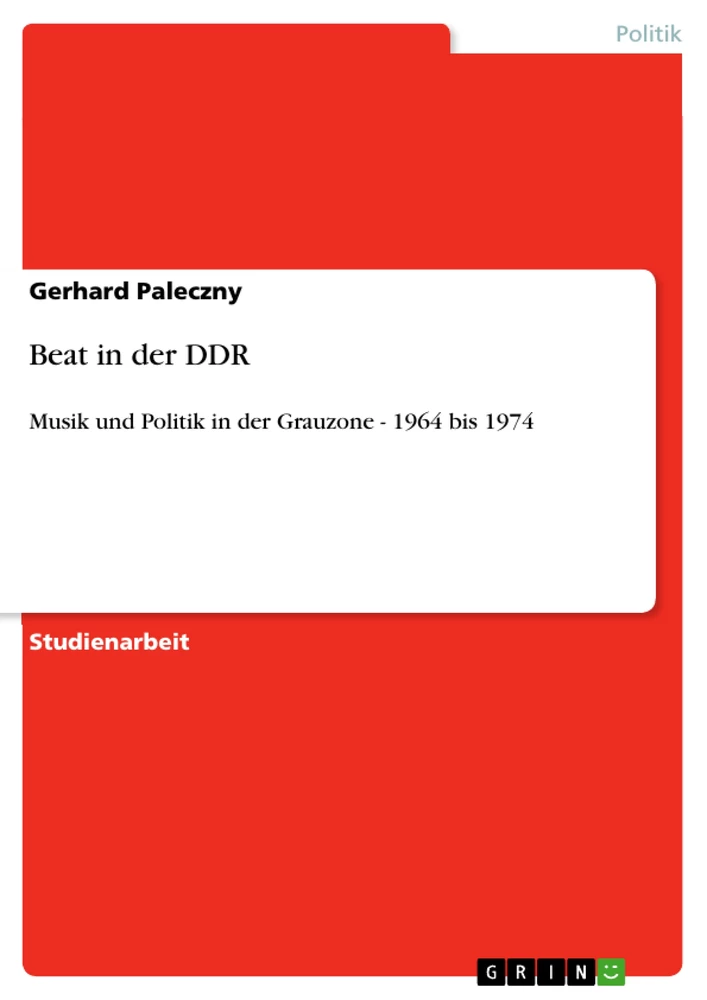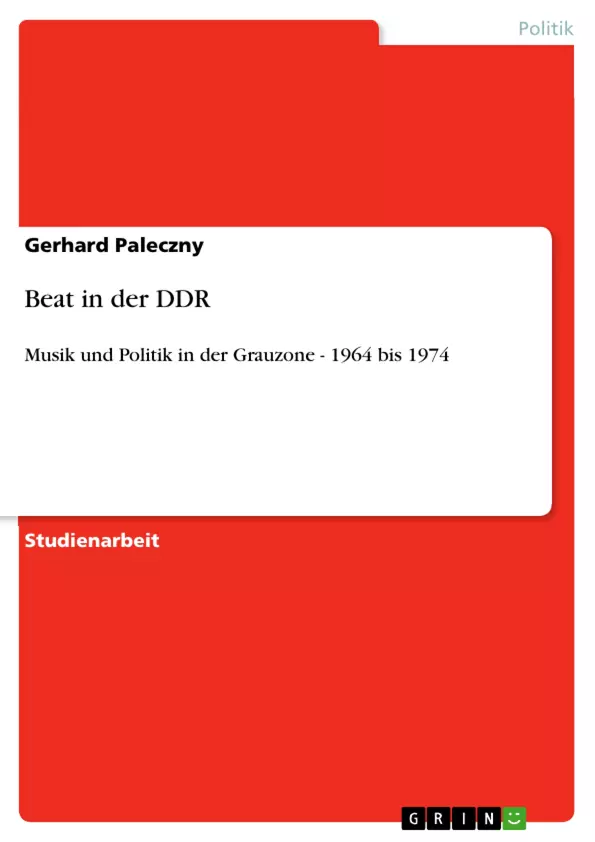Die Leitfrage der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit den politischen Handlungen, die die SED im Bezug auf den Anfang der 1960er Jahren aufkommenden Beatboom setzte und versucht herauszustreichen, wie und warum es letztlich zu einem ständigen Auf und Ab zwischen staatlicher Förderung und massiver Ablehnung gekommen ist. Ich versuche im Hauptteil der Arbeit den politischen Zick-Zack-Kurs der SED einigermaßen chronologisch, im Fokus die Jahre 1964 bis 1972, herauszuarbeiten und zu begründen, warum einer Musikkultur wie dem Beat eine derart hohe politische Brisanz beigemessen wurde. Um die Handlungen der Führungsriege verständlicher zu machen, stelle ich zuvor im ersten Teil das ideologische Kulturverständnis der DDR sowie, im Konsens dazu, ihre Haltung zur Jugend vor.
Für die Ausarbeitungen des Hauptteils dienten vorrangig die Literatur von Michael Rauhut und Peter Wicke, für den Kultur-und-Jugend-Teil insbesondere die Arbeiten von Katharina Silo und Brigitte Leißner. Weiters stellte in medienpolitischen Fragen auch das Buch „Zwischen Pop und Propaganda“, herausgegeben von Klaus Arnold und Christoph Classen, eine große Hilfe für das Verständnis der sozialistischen Agitation der DDR dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kultur und Jugend in der DDR
- Kultur und die sozialistische Persönlichkeit
- Der Kulturimperialismus des Westens
- Beatmusik als Kunst
- Der Aufstieg des Beat - 1949 bis 1965
- Rock N' Roll und Brauselimonade - Die 1950er Jahre
- Der Beat kommt! - Die erste Hälfte der 1960er Jahre
- Arbeit mit Gitarrengruppen - Jugendpolitische Liberalisierung
- Klare Köpfe und wackelnde Hintern - Beat in den Medien
- Der Beat als Politikum - 1965 bis 1967
- Beat in der Kontroverse
- Auf offenem Anti-Beatkurs
- Die Monotonie des yeah, yeah, yeah - Die 11. Tagung des ZK der SED
- Die Druckwelle der 11. Tagung
- Tanzmusikalisches Tauwetter – 1967 bis 1972
- Die Pilzkopfstudien – das Ende der Restriktionen
- Die Rückkehr des Beat
- Die Profilierung des DDR-Rock
- Rock und Politik in den 1970er Jahren
- Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die politische Reaktion der SED auf den Beatboom in der DDR von Anfang der 1960er bis 1972. Die Arbeit analysiert den ambivalenten Umgang der Regierung mit Beatmusik, den Wechsel zwischen Förderung und Verbot und die Gründe für die hohe politische Brisanz, die dem Beat zugeschrieben wurde. Die Arbeit beleuchtet den ideologischen Kontext, indem sie das Kulturverständnis der DDR und deren Verhältnis zur Jugend untersucht.
- Die ideologischen Funktionen von Kunst und Kultur in der DDR
- Der Umgang der SED mit dem "Kulturimperialismus" des Westens
- Die politische Instrumentalisierung von Beatmusik
- Der Einfluss von Jugendkultur auf die Politik der SED
- Die Entwicklung der Rockmusik in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den umfassenden staatlichen Einfluss in der DDR und hebt die Bedeutung von Unterhaltungskunst und Populärmusik hervor. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem ambivalenten Umgang der SED mit Beatmusik und dem daraus resultierenden ständigen Wechsel zwischen Förderung und Verbot in den Vordergrund. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der einen chronologischen Überblick über den politischen Umgang mit Beatmusik (1964-1972) bietet und die Gründe für die hohe politische Brisanz dieser Musikrichtung beleuchtet. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit, das ideologische Kulturverständnis der DDR und ihre Haltung zur Jugend zu untersuchen.
Kultur und Jugend in der DDR: Dieses Kapitel analysiert das ideologische Verständnis von Kultur und Kunst in der DDR. Kunst, einschließlich Unterhaltungskunst, sollte zur Bildung der sozialistischen Persönlichkeit und zur Stärkung des Sozialismus beitragen und als Waffe im Klassenkampf eingesetzt werden. Der zunehmende Konsum westlicher Kultur, insbesondere Beatmusik, wurde als "Kulturimperialismus" betrachtet und die Notwendigkeit, sozialistische Kunst von westlicher Kultur abzugrenzen, wurde betont. Das Kapitel beleuchtet die ambivalente Haltung der SED gegenüber Beatmusik: Einerseits wurde sie als Mittel der Beeinflussung der Jugend angesehen, andererseits wurde deren westlicher Ursprung und potenzieller Einfluss kritisch betrachtet.
Der Aufstieg des Beat - 1949 bis 1965: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Beat in der DDR von den 1950er bis Mitte der 1960er Jahre. Es zeichnet nach, wie Rock'n'Roll und Beatmusik trotz anfänglicher Zurückhaltung immer größere Popularität erlangten, und wie die Regierung versuchte, diese Entwicklung zu kontrollieren und zu lenken. Die staatliche Arbeit mit Gitarrengruppen und die zunehmende mediale Aufmerksamkeit für Beatmusik werden analysiert. Das Kapitel beschreibt die ersten Schritte der staatlichen Einflussnahme und die Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Popularität von Beatmusik ergaben.
Der Beat als Politikum - 1965 bis 1967: Dieses Kapitel fokussiert auf die zunehmende politische Kontroverse um Beatmusik in der Mitte der 1960er Jahre. Es analysiert die steigende Ablehnung durch die SED, die sich in offenem Anti-Beatkurs manifestierte und durch die 11. Tagung des ZK der SED verstärkt wurde. Der Druck auf Künstler und Jugendliche wird untersucht und die Auswirkungen dieser politischen Maßnahmen werden beleuchtet. Das Kapitel verdeutlicht, wie die SED versuchte, die Verbreitung von Beatmusik einzuschränken und zu kontrollieren.
Tanzmusikalisches Tauwetter – 1967 bis 1972: Dieses Kapitel beschreibt eine Veränderung der Politik gegenüber Beatmusik ab 1967. Die "Pilzkopfstudien" und das darauffolgende Ende der Restriktionen führten zu einer Rückkehr des Beat und zur Entwicklung einer spezifischen DDR-Rockszene. Das Kapitel analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich für die Musiker in diesem Kontext ergaben, und zeigt, wie sich Rockmusik und Politik in den 1970er Jahren weiterentwickelten. Der Fokus liegt auf der Anpassung und der staatlichen Regulierung im Kontext des kulturellen Wandels.
Schlüsselwörter
Beatmusik, DDR, SED, Kulturpolitik, Jugendkultur, Kulturimperialismus, sozialistische Persönlichkeit, Propaganda, Rockmusik, politische Kontrolle, Medien, Zensur, Liberalisierung, Repression.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der Beat in der DDR: Politische Reaktionen der SED auf den Beatboom (1960-1972)"
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die politische Reaktion der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) auf den Beatboom in der DDR zwischen 1960 und 1972. Im Mittelpunkt steht der ambivalente Umgang der Regierung mit Beatmusik – der Wechsel zwischen Förderung und Verbot – und die Gründe für die hohe politische Brisanz, die der Beat zugeschrieben wurde.
Welche Aspekte werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert den ideologischen Kontext, indem sie das Kulturverständnis der DDR und deren Verhältnis zur Jugend untersucht. Konkrete Themen sind die ideologischen Funktionen von Kunst und Kultur in der DDR, der Umgang der SED mit dem "Kulturimperialismus" des Westens, die politische Instrumentalisierung von Beatmusik, der Einfluss von Jugendkultur auf die Politik der SED und die Entwicklung der Rockmusik in der DDR.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kultur und Jugend in der DDR, Der Aufstieg des Beat (1949-1965), Der Beat als Politikum (1965-1967), Tanzmusikalisches Tauwetter (1967-1972) und eine zusammenfassende Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel beleuchtet einen spezifischen Aspekt der Entwicklung und des politischen Umgangs mit Beatmusik in der DDR.
Wie wird der methodische Ansatz der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit verfolgt einen chronologischen Ansatz, der einen Überblick über den politischen Umgang mit Beatmusik von 1964 bis 1972 bietet. Sie beleuchtet die Gründe für die hohe politische Brisanz dieser Musikrichtung und untersucht das ideologische Kulturverständnis der DDR und ihre Haltung zur Jugend.
Welche Rolle spielte der "Kulturimperialismus" im Kontext der Beatmusik?
Der zunehmende Konsum westlicher Kultur, insbesondere Beatmusik, wurde von der SED als "Kulturimperialismus" betrachtet. Die Arbeit analysiert die Bemühungen der SED, sozialistische Kunst von westlicher Kultur abzugrenzen und die ambivalente Haltung gegenüber Beatmusik: einerseits als Mittel der Beeinflussung der Jugend, andererseits kritisch betrachtet wegen des westlichen Ursprungs und des potenziellen Einflusses.
Wie reagierte die SED auf den wachsenden Einfluss von Beatmusik?
Die Reaktion der SED war ambivalent. Anfangs versuchte die Regierung, die Entwicklung zu kontrollieren und zu lenken, indem sie mit Gitarrengruppen arbeitete und die mediale Aufmerksamkeit für Beatmusik steuerte. Später, in den 1960er Jahren, kam es zu einer zunehmenden Ablehnung und einem offenen Anti-Beatkurs, verstärkt durch die 11. Tagung des ZK der SED. Ab 1967 vollzog sich ein Wandel hin zu einem "tanzenmusikalischen Tauwetter" mit der Rückkehr des Beat und der Entwicklung einer DDR-Rockszene unter staatlicher Regulierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Themen der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beatmusik, DDR, SED, Kulturpolitik, Jugendkultur, Kulturimperialismus, sozialistische Persönlichkeit, Propaganda, Rockmusik, politische Kontrolle, Medien, Zensur, Liberalisierung, Repression.
Welche zentralen Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist der ambivalente Umgang der SED mit Beatmusik und der daraus resultierende ständige Wechsel zwischen Förderung und Verbot. Die Arbeit untersucht die Gründe für die hohe politische Brisanz, die dem Beat zugeschrieben wurde.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Kulturpolitik der DDR, die Geschichte der Rockmusik, den Umgang mit Jugendkultur in autoritären Systemen und die ideologischen Auseinandersetzungen im Kalten Krieg interessieren. Sie ist besonders nützlich für Studierende der Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Kulturwissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Gerhard Paleczny (Autor:in), 2008, Beat in der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113656