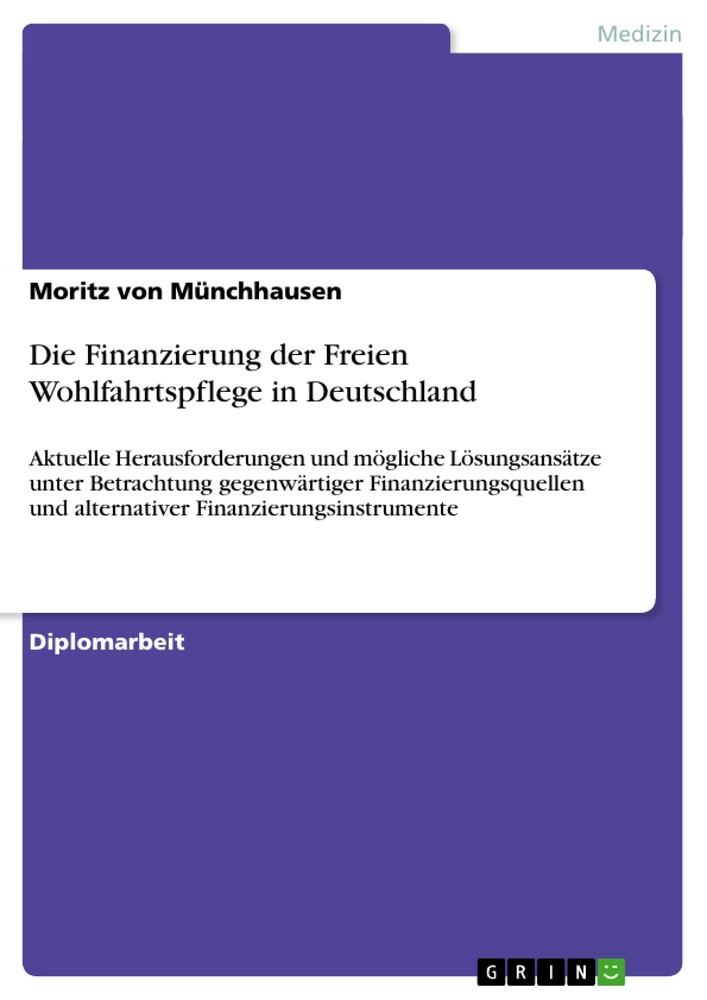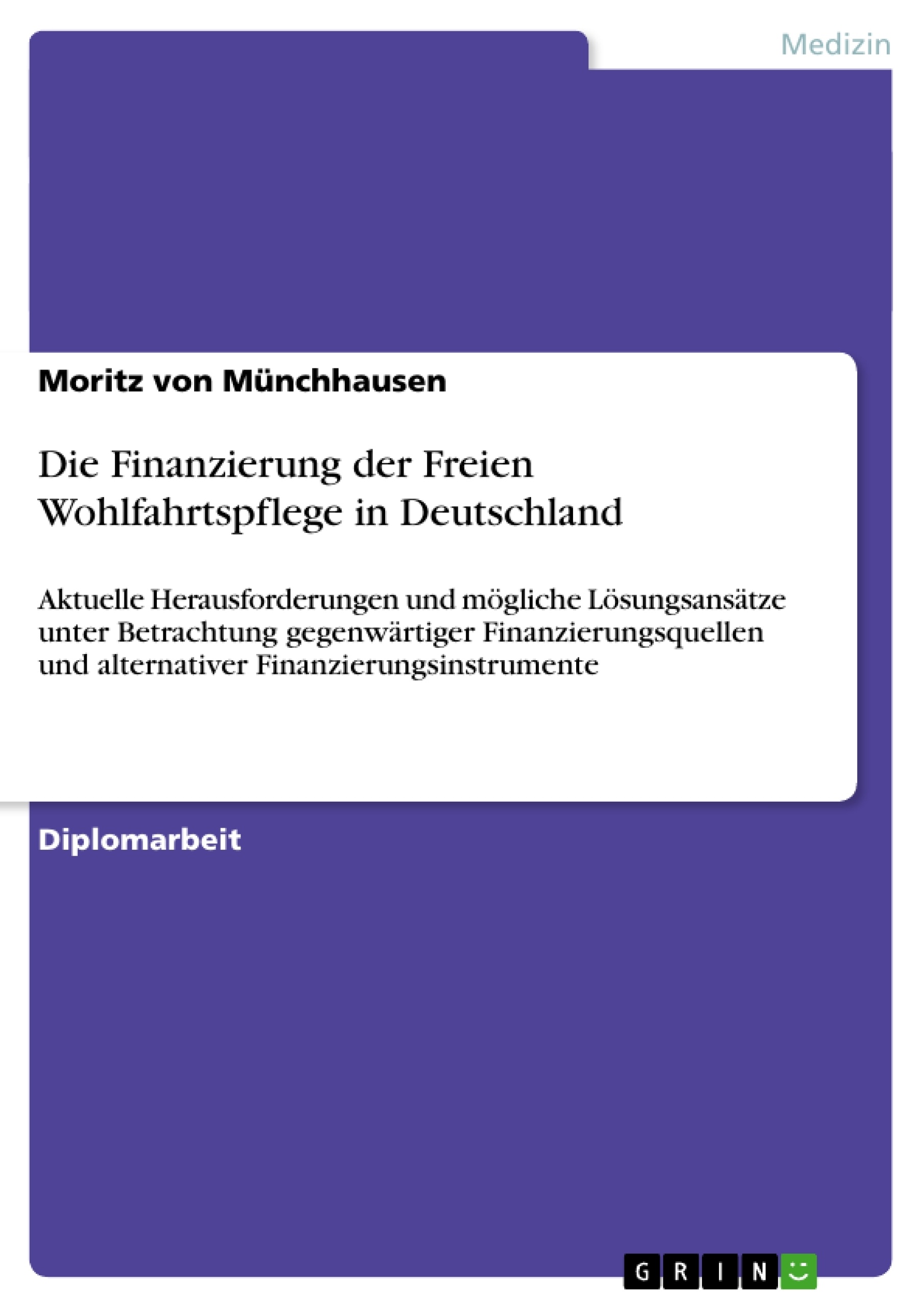In der Bundesrepublik Deutschland spielen bei der Erbringung von sozialen Dienstleistungen die gemeinnützigen Anbieter in Gestalt der Freien Wohlfahrtsverbände eine zentrale Rolle. Sie sind kein Bestandteil staatlicher Institutionen und arbeiten nicht profitorientiert. Mit der Verabschiedung der Pflegeversicherung im SGB XI 1994 und der Umstellung von der Objekt- auf die Subjektförderung wurde eine neue Phase der Ökonomisierung der sozialen Dienste eingeleitet und privat-gewerblichen Anbietern der Zugang in dieses Marktsegment geöffnet. Damit verändern sich auch die bisher korporatistisch geprägten Beziehungen zwischen den Akteuren, an deren Stelle ein Wettbewerb zwischen privaten, freigemeinnützigen und kommunalen Trägern tritt. Diese Umstände machen für die Freie Wohlfahrtspflege die Erschließung und Nutzung alternativer Finanzierungsquellen und –instrumente notwendig, um ihr Leistungsportfolio in Umfang und Qualität zu erhalten, gegen die gewerbliche Konkurrenz bestehen zu können und umletztlich auch den eigenen ideellen Ansprüchen zu genügen. Die vorliegende Arbeit geht im Kern zwei Fragen nach:
Welche Finanzierungsquellen stehen der Freien Wohlfahrtspflege im Moment zur Verfügung, und welche Problematiken weisen sie unter Betrachtung der o.g. substanziellen Veränderungen der letzten Jahre auf?
Welche alternativen Finanzierungsinstrumente, die besonders geeignet für wohlfahrtsverbandliche Bedürfnisse sind, können zukünftig genutzt werden?
Aufbau der Arbeit
Einstieg in die Theorie: ein ökonomischer Erklärungsansatz erläutert anhand von Versagenstheorien aus Nachfragersicht die Existenz von Wohlfahrtsorganisationen.
Historische Perspektive wohlfahrtlicher Entwicklung: die Existenz der deutschen Wohlfahrtsverbände wird in einen Kontext mit ihren Handlungsmotiven gebracht. Dazu werden Zusammenhänge zwischen staatlicher Sozialpolitik und freigemeinnützigem Handeln über mehrere Epochen hinweg dargestellt.
Rahmenbedingungen und traditionelle Finanzierungsquellen in Verbindung mit den damit verbundenen Problematiken.
Betrachtung alternativer Finanzierungsinstrumente, ausgehend von der Analyse der vorliegenden Literatur und den Aussagen der Interviewpartner. Ein weiterreichendes Augenmerk wird dabei auf den Einsatz kapitalwirtschaftlicher Anlageformen, Instrumente des Sozialmarketings und Kooperationsformen gelegt.
Schluss der Arbeit bildet ein Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Methodik der Arbeit
- 2. Ökonomie von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege
- 2.1 Organisationen der Freien Wohlfahrt im Dritten Sektor
- 2.2 Markt
- 2.3 Arten von Gütern
- 2.4 Marktversagen
- 2.5 Staatsversagen
- 2.6 Organisationen des Dritten Sektors – Kompensation oder Konflikt zwischen Markt und Staat?
- 3. Begriffliche und historische Dimensionen der Freien Wohlfahrtspflege
- 3.1 Charakterisierung der Spitzenverbände
- 3.2 Fürsorge in der Zeit des Mittelalters bis zum 19. Jahrhundert
- 3.3 Entwicklung verbandlicher Wohlfahrt vom 19. Jahrhundert bis zum Nationalsozialismus
- 3.4 Wohlfahrtspflege im Nationalsozialismus und der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg
- 3.5 Entwicklung der Freien Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik Deutschland
- 3.6 Das Subsidiaritätsprinzip als Grundlage wohlfahrtsverbandlicher Tätigkeit
- 3.7 Gegenwärtige Anforderungen an die Freie Wohlfahrtspflege
- 3.8 Vergleich internationaler Wohlfahrtstraditionen
- 3.9 Fazit
- 4. Traditionelle Finanzierungsquellen der Freien Wohlfahrtspflege
- 4.1 Rahmenbedingungen wohlfahrtlicher Finanzierung
- 4.2 Finanzierungsträger
- 4.2.1 Öffentliche Finanzierung
- 4.2.2 Fremdfinanzierung
- 4.2.3 Eigenmittelfinanzierung
- 4.3 Probleme der traditionellen Finanzierungsquellen
- 4.3.1 Probleme der öffentlichen Finanzierungsquellen
- 4.3.2 Probleme der Fremdfinanzierung
- 4.3.3 Probleme der Eigenfinanzierung
- 4.4 Fazit
- 5. Alternative Finanzierungsinstrumente für die Freie Wohlfahrtspflege
- 5.1 Grundsätzliche Anforderungen
- 5.2 Marketinginstrumente für die Finanzierung Freier Wohlfahrtspflege
- 5.2.1 Fundraising
- 5.2.2 Sponsoring
- 5.3 Kapitalwirtschaftliche Instrumente für die Freie Wohlfahrtspflege
- 5.3.1 Verbandsinterne Finanzierungsgesellschaft
- 5.3.2 Mezzanine Kapitalform
- 5.3.3 Fondsfinanzierungen
- 5.3.4 Stiftungen
- 5.4 Kooperationsformen
- 5.4.1 Investor-Betreiber-Modelle
- 5.4.2 Public-Social-Private-Partnerships
- 5.5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Finanzierung der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Ziel ist es, die aktuellen Herausforderungen der Finanzierung aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu präsentieren. Dabei werden sowohl gegenwärtige Finanzierungsquellen als auch alternative Instrumente betrachtet.
- Analyse der traditionellen Finanzierungsquellen der Freien Wohlfahrtspflege
- Bewertung der Herausforderungen und Probleme bestehender Finanzierungsmodelle
- Präsentation und Evaluierung alternativer Finanzierungsinstrumente
- Untersuchung des Einflusses von Markt und Staat auf die Finanzierung
- Diskussion des Subsidiaritätsprinzips im Kontext der Finanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein, beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit sowie die angewandte Methodik. Es skizziert die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz zur Bearbeitung der Thematik.
2. Ökonomie von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege: Dieses Kapitel analysiert die Freien Wohlfahrtsorganisationen aus ökonomischer Perspektive. Es beleuchtet ihren Platz im Dritten Sektor, die Besonderheiten des Marktes für ihre Leistungen, mögliche Marktversagen und das Verhältnis von Markt und Staat. Der Schwerpunkt liegt auf der ökonomischen Einordnung und den daraus resultierenden Herausforderungen für die Finanzierung.
3. Begriffliche und historische Dimensionen der Freien Wohlfahrtspflege: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland, beginnend vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es charakterisiert die Spitzenverbände, beschreibt die historischen Kontextualisierungen und analysiert die Rolle des Subsidiaritätsprinzips. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der historischen Entwicklung und ihren Auswirkungen auf die heutige Situation.
4. Traditionelle Finanzierungsquellen der Freien Wohlfahrtspflege: Dieses Kapitel untersucht detailliert die bestehenden Finanzierungsquellen der Freien Wohlfahrtspflege, einschließlich öffentlicher Mittel, Fremdkapital und Eigenmitteln. Es analysiert die jeweiligen Rahmenbedingungen, identifiziert bestehende Probleme und bewertet die Wirksamkeit dieser traditionellen Finanzierungsansätze. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Limitationen der etablierten Finanzierungsstrukturen.
5. Alternative Finanzierungsinstrumente für die Freie Wohlfahrtspflege: Dieses Kapitel präsentiert und evaluiert verschiedene alternative Finanzierungsinstrumente, wie Fundraising, Sponsoring, Kapitalmarktfinanzierungen und Kooperationsmodelle (z.B. PPP und PSPP). Es bewertet die Anwendbarkeit und das Potenzial dieser Instrumente für die Freie Wohlfahrtspflege, wobei die jeweiligen Vor- und Nachteile im Detail diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Freie Wohlfahrtspflege, Finanzierung, Deutschland, öffentliche Finanzierung, alternative Finanzierungsinstrumente, Fundraising, Sponsoring, Marktversagen, Staatsversagen, Subsidiaritätsprinzip, Dritter Sektor, Kapitalmarkt, Kooperationen, Herausforderungen, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Finanzierung der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Finanzierung der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Sie analysiert die aktuellen Herausforderungen der Finanzierung und präsentiert mögliche Lösungsansätze. Dabei werden sowohl traditionelle Finanzierungsquellen als auch alternative Instrumente betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der traditionellen Finanzierungsquellen, die Bewertung der Herausforderungen bestehender Modelle, die Präsentation und Evaluierung alternativer Finanzierungsinstrumente, den Einfluss von Markt und Staat auf die Finanzierung und die Diskussion des Subsidiaritätsprinzips in diesem Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Zielsetzung, Aufbau, Methodik), Ökonomie der Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege (Platz im Dritten Sektor, Markt, Markt- und Staatsversagen), Begriffliche und historische Dimensionen der Freien Wohlfahrtspflege (Entwicklung, Spitzenverbände, Subsidiaritätsprinzip), Traditionelle Finanzierungsquellen (öffentliche Mittel, Fremd- und Eigenkapital) und Alternative Finanzierungsinstrumente (Fundraising, Sponsoring, Kapitalmarktfinanzierungen, Kooperationen).
Welche traditionellen Finanzierungsquellen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die bestehenden Finanzierungsquellen der Freien Wohlfahrtspflege: Öffentliche Finanzierung, Fremdfinanzierung und Eigenmittelfinanzierung. Sie untersucht die Rahmenbedingungen, identifiziert Probleme und bewertet die Wirksamkeit dieser traditionellen Ansätze.
Welche alternativen Finanzierungsinstrumente werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und evaluiert alternative Finanzierungsinstrumente wie Fundraising, Sponsoring, verbandsinterne Finanzierungsgesellschaften, Mezzanine-Kapital, Fondsfinanzierungen, Stiftungen, Investor-Betreiber-Modelle und Public-Social-Private-Partnerships (PSPP).
Wie wird die ökonomische Perspektive der Freien Wohlfahrtspflege behandelt?
Die Arbeit analysiert die Freien Wohlfahrtsorganisationen aus ökonomischer Sicht, beleuchtet ihren Platz im Dritten Sektor, die Besonderheiten des Marktes für ihre Leistungen und das Verhältnis von Markt und Staat. Marktversagen und Staatsversagen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt das Subsidiaritätsprinzip?
Die Arbeit diskutiert die Rolle des Subsidiaritätsprinzips als Grundlage wohlfahrtsverbandlicher Tätigkeit und analysiert seinen Einfluss auf die Finanzierung der Freien Wohlfahrtspflege.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Freie Wohlfahrtspflege, Finanzierung, Deutschland, öffentliche Finanzierung, alternative Finanzierungsinstrumente, Fundraising, Sponsoring, Marktversagen, Staatsversagen, Subsidiaritätsprinzip, Dritter Sektor, Kapitalmarkt, Kooperationen, Herausforderungen, Lösungsansätze.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Einleitung beschreibt die angewandte Methodik zur Bearbeitung der Thematik. Die genaue Methodik wird im Text der Diplomarbeit detailliert erläutert.
Wo finde ich den vollständigen Text der Diplomarbeit?
Der vollständige Text der Diplomarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Diese Zusammenfassung dient lediglich als Überblick.
- Quote paper
- Dipl. Verwaltungswissenschaftler Moritz von Münchhausen (Author), 2007, Die Finanzierung der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113558