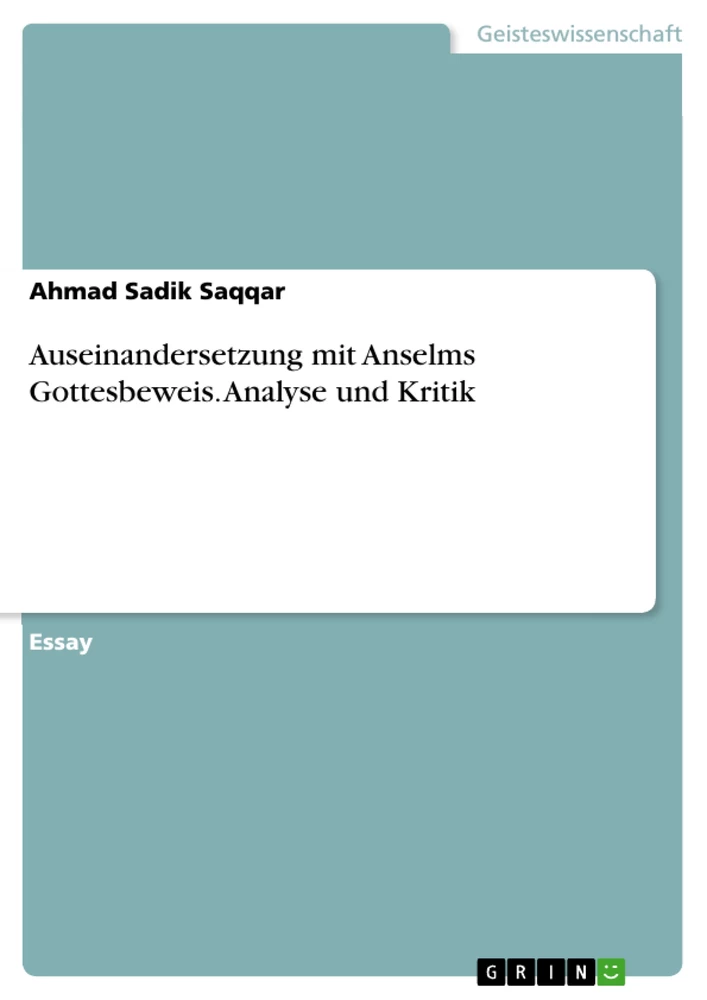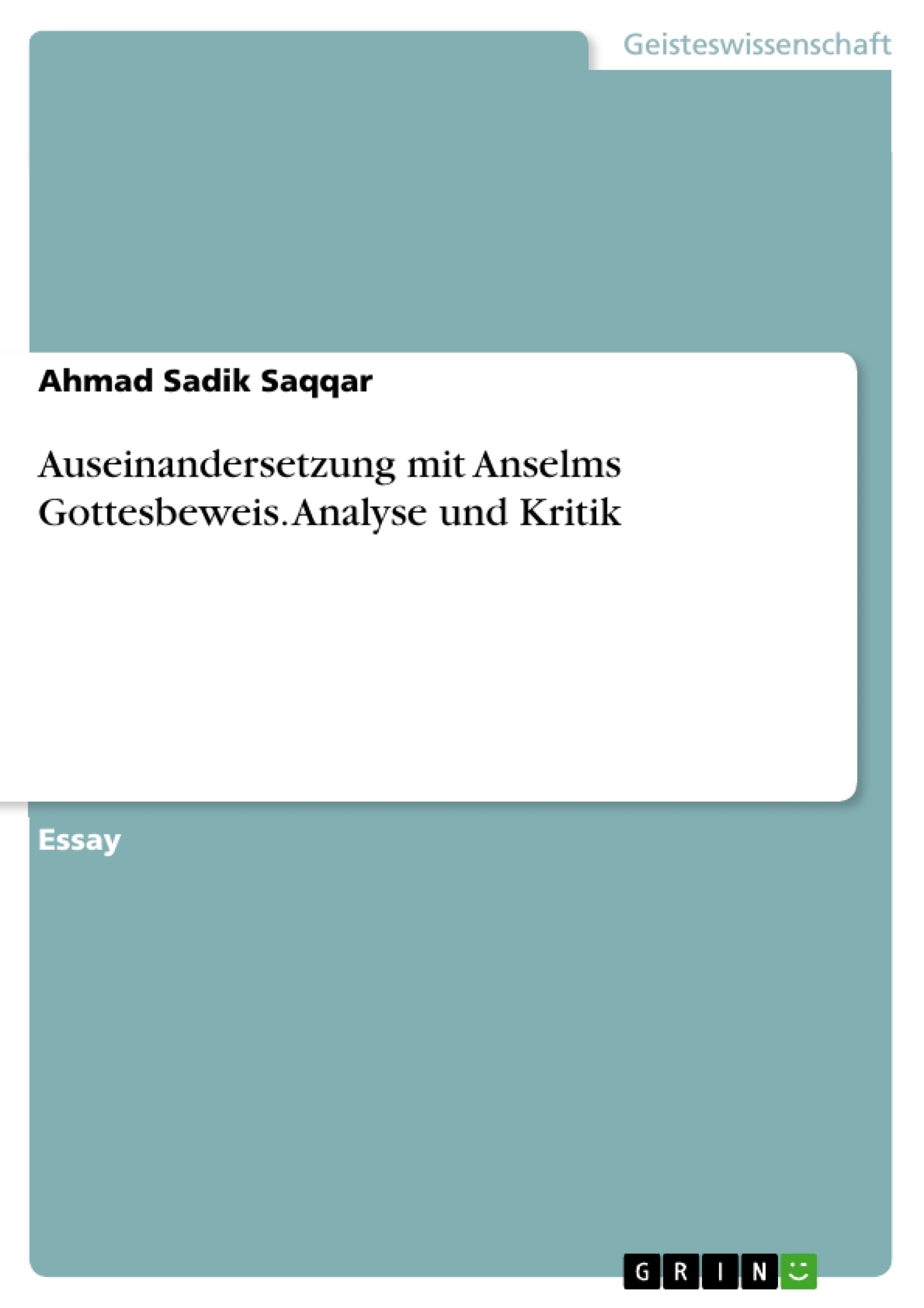In diesem Essay soll zunächst auf die Struktur des anselmischen Gottesbeweises eingegangen werden und infolgedessen die Kritik an ihm dargestellt werden. Die ausgeführte Kritik wird einerseits von Seiten wichtiger philosophischer/theologischer Denker näher beleuchtet, andererseits aber findet meine eigene Kritik an gesonderter Stelle Platz. Am Ende des Essays werden alle wichtigen Argumente zusammenfassend dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auseinandersetzung mit Anselms Gottesbeweis
- Erläuterung des Beweises
- Die Kritik an Anselms Gottesbeweis
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Anselms ontologischen Gottesbeweis im Proslogion. Die Zielsetzung besteht darin, die Struktur des Beweises darzulegen und die darauf gerichtete Kritik zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den Argumentationslinien Anselms und der Bewertung dieser durch bedeutende Philosophen und Theologen.
- Anselms ontologischer Gottesbeweis
- Kritik an Anselms Beweis durch verschiedene Denker
- Der „größte-denkbaren-Insel“-Einwand von Gaunilo
- Die Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft bei Anselm
- Die Bedeutung des Begriffs „aliquid quo maius cogitari non potest“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in Anselms ontologischen Gottesbeweis im Proslogion ein und stellt dessen Bedeutung in der Geschichte der Gottesbeweise heraus. Anselm, der als Vater der Scholastik gilt, sucht mit seinem Beweis nach einer zwingenden, von empirischen Fakten unabhängigen Argumentation für die Existenz Gottes. Der Essay kündigt die bevorstehende Analyse des Beweises und der darauf folgenden Kritik an.
Auseinandersetzung mit Anselms Gottesbeweis: Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil erläutert Anselms Beweis, indem er auf dessen platonisch-augustinische Wurzeln und die zentrale Formel "aliquid quo maius cogitari non potest" eingeht. Anselm argumentiert, dass das, worüber nichts Größeres gedacht werden kann, nicht nur im Verstand existieren kann, sondern auch in der Realität, da sonst etwas Größeres gedacht werden könnte – ein Widerspruch. Der zweite Teil behandelt die Kritik an Anselms Beweis. Erwähnt werden Kritiker wie Thomas von Aquin, Duns Scotus, Immanuel Kant und Gaunilo von Marmoutier. Gaunilos "größte-denkbaren-Insel"-Einwand wird als zentraler Kritikpunkt hervorgehoben, der die potentielle Trivialisierung des Arguments aufzeigt. Die Diskussion der verschiedenen Kritikpunkte illustriert die anhaltende Relevanz und die Debatten, die Anselms Beweis bis heute auslöst.
Schlüsselwörter
Anselm von Canterbury, Proslogion, ontologischer Gottesbeweis, „aliquid quo maius cogitari non potest“, Gaunilo von Marmoutier, Scholastik, Glaube und Vernunft, Existenz Gottes, a priori Argumentation.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Anselms Ontologischer Gottesbeweis
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay analysiert Anselms ontologischen Gottesbeweis, wie er im Proslogion dargelegt ist. Er untersucht sowohl die Struktur des Beweises als auch die darauf gerichtete Kritik bedeutender Philosophen und Theologen.
Welche Aspekte von Anselms Gottesbeweis werden behandelt?
Der Essay beleuchtet Anselms Argumentationslinien im Detail, inklusive der zentralen Formel „aliquid quo maius cogitari non potest“ (etwas, als das nichts Größeres gedacht werden kann). Er untersucht die platonisch-augustinischen Wurzeln des Beweises und bewertet die verschiedenen Kritikpunkte, die im Laufe der Geschichte an diesem Beweis geäußert wurden.
Welche Kritikpunkte an Anselms Beweis werden diskutiert?
Der Essay behandelt die Kritik von Denkern wie Thomas von Aquin, Duns Scotus, Immanuel Kant und insbesondere Gaunilo von Marmoutier. Gaunilos „größte-denkbaren-Insel“-Einwand wird als zentraler Kritikpunkt hervorgehoben, der die potentielle Trivialisierung des Arguments aufzeigt. Die Diskussion umfasst die anhaltende Relevanz und die bis heute andauernden Debatten um Anselms Beweis.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Essay erläutert?
Schlüsselkonzepte sind Anselms ontologischer Gottesbeweis selbst, die Bedeutung von „aliquid quo maius cogitari non potest“, die Beziehung zwischen Glaube und Vernunft bei Anselm, sowie die Einordnung des Beweises in den Kontext der Scholastik.
Wie ist der Essay aufgebaut?
Der Essay gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Auseinandersetzung mit Anselms Gottesbeweis (mit Unterkapiteln zur Erläuterung des Beweises und zur Kritik daran) und ein Resümee. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung von Anselms Beweis heraus. Das Hauptkapitel analysiert den Beweis und die Kritikpunkte. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel helfen beim Verständnis.
Welche Zielsetzung verfolgt der Essay?
Der Essay zielt darauf ab, Anselms ontologischen Gottesbeweis verständlich darzulegen und die darauf gerichtete Kritik umfassend zu untersuchen. Der Fokus liegt auf einer klaren Darstellung der Argumentationslinien und einer fundierten Bewertung dieser.
Für wen ist dieser Essay gedacht?
Dieser Essay ist für Leser gedacht, die sich akademisch mit Anselms ontologischem Gottesbeweis auseinandersetzen möchten. Er eignet sich für Studierende der Philosophie und Theologie sowie für alle Interessierten, die sich ein tieferes Verständnis dieses wichtigen philosophischen Arguments aneignen wollen.
- Quote paper
- Ahmad Sadik Saqqar (Author), 2014, Auseinandersetzung mit Anselms Gottesbeweis. Analyse und Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1134839