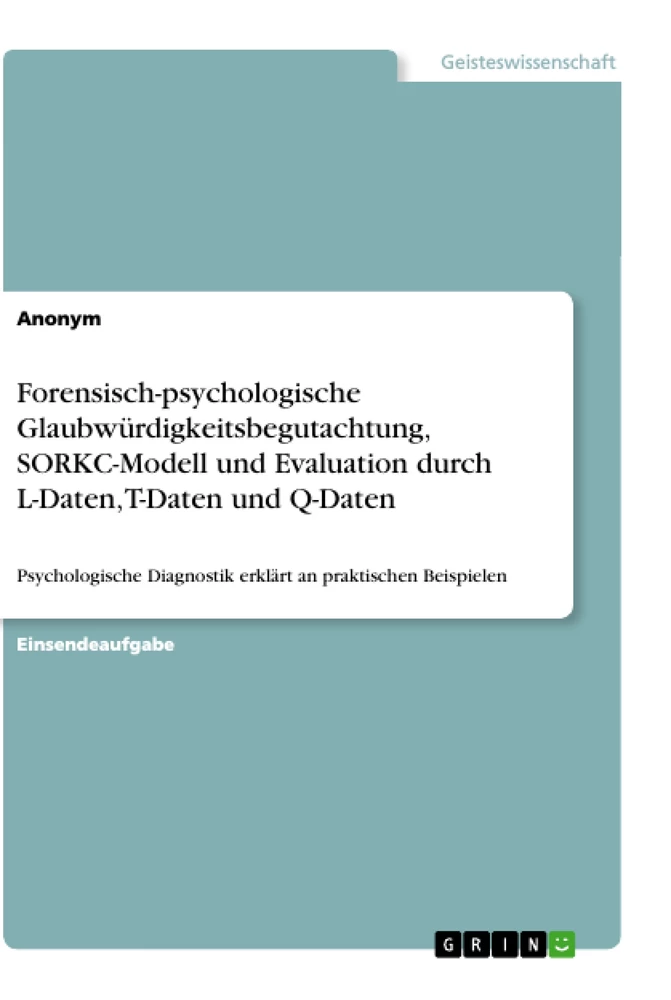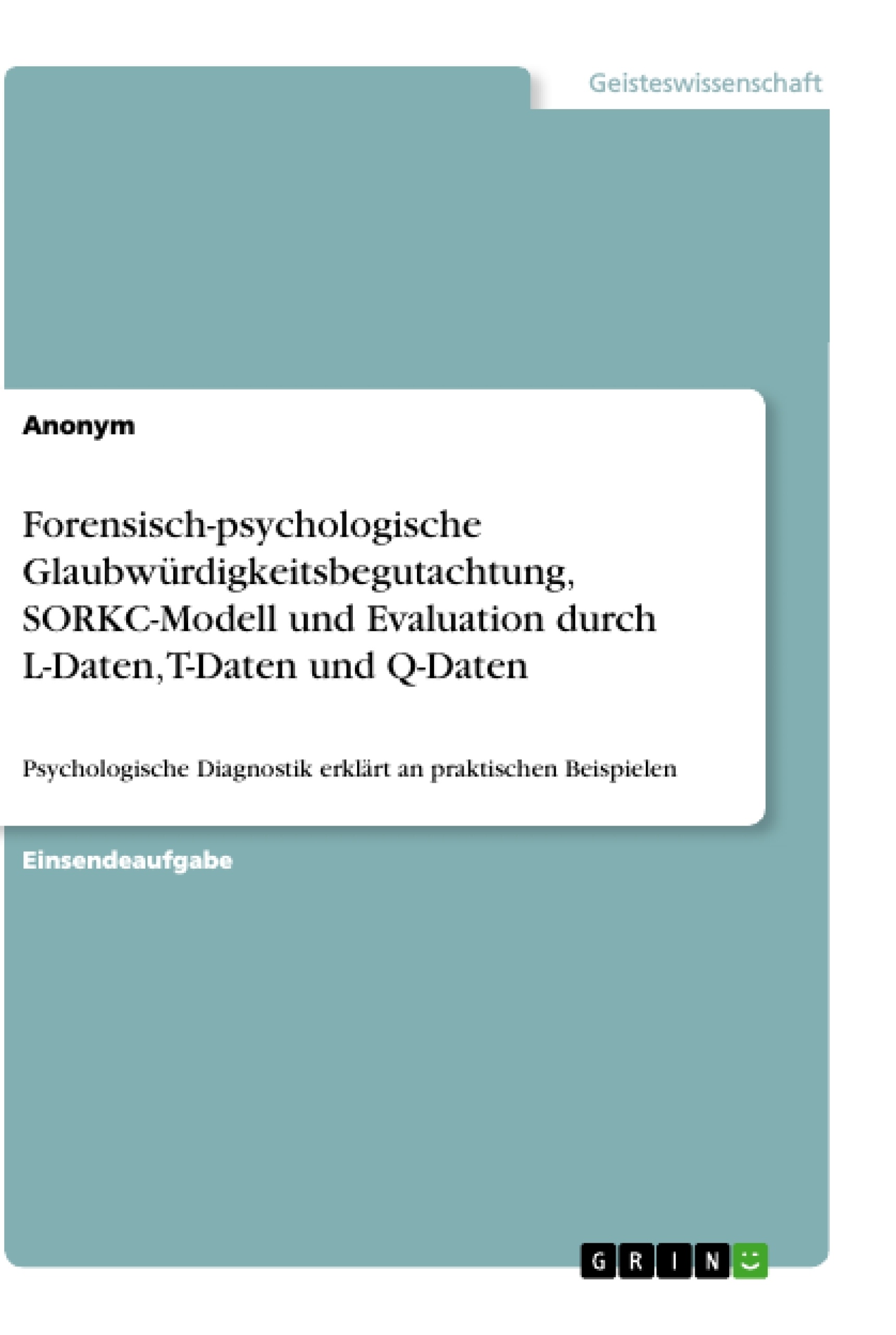Im ersten Kapitel dieser Einsendeaufgabe wird der Zweck einer forensisch-psychologischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung erklärt. Zu diesem Verfahren wird ein praktisches Beispiel formuliert, um die Vorgänge zu verdeutlichen.
Im zweiten Kapitel werden Annahmen und Aussagen des S-O-R-K-C-Modells beschrieben. Auch dabei findet ein praktisches Beispiel Anwendung.
Das dritte Kapitel beschreibt beispielhaft einen konkreten Sachverhalt im Gebiet der Evaluation. Es wird dargestellt und begründet, welche L-Daten, T-Daten, Q-Daten und gegebenenfalls P-Daten im definierten Sachverhalt ausgewählt wurden. Die Auswahl wird begründet.
Inhaltsverzeichnis
- Die Glaubwürdigkeitsbegutachtung
- Das SORKC-Modell
- Die Stimuluskomponente S
- Die Organismuskomponente O
- Die Verhaltenskomponente R
- Die Kontingenzkomponente K
- Die Konsequenzkomponente C
- Beispiel
- Evaluation
- Stichprobenplanung
- Instrumente der Evaluationsstudie
- Daten
- Beispiel
- Führungsstil
- Betriebsklima
- Verbesserung der Fertigkeiten einzelner Mitarbeitenden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychologischen Glaubwürdigkeitsbegutachtung, insbesondere im Kontext von Fällen sexuellen Missbrauchs. Ziel ist es, die methodischen Herausforderungen und das Vorgehen bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen zu erläutern, wobei das SORKC-Modell als theoretischer Rahmen dient. Die Evaluation der Glaubwürdigkeitsbeurteilung wird ebenfalls thematisiert.
- Methoden der Glaubwürdigkeitsbegutachtung
- Das SORKC-Modell und seine Anwendung
- Herausforderungen bei der Beurteilung von Kinderzeugen
- Analyse von Aussagequalität
- Die Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Glaubwürdigkeitsbegutachtung: Dieses Kapitel beschreibt den Zweck und die Anwendung psychologischer Gutachten, insbesondere der Glaubwürdigkeitsbegutachtung, in verschiedenen juristischen Kontexten. Es betont die Rolle des Gutachters als unabhängiger Beurteiler, der die Rechtsfrage nicht selbst beantwortet. Der methodische Aufwand variiert je nach Kontext, und die Glaubwürdigkeitsbegutachtung findet vor allem in Fällen ohne Zeugenaussagen statt, beispielsweise bei sexuellem Missbrauch. Die Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit (Wahrheit einer Aussage) und Glaubwürdigkeit (generelle Wahrheitstreue einer Person) wird hervorgehoben. Das Kapitel führt in die Thematik ein und legt die Basis für die detaillierten Ausführungen in den folgenden Kapiteln.
Das SORKC-Modell: Dieses Kapitel beschreibt das SORKC-Modell als theoretischen Rahmen für die Analyse von Verhalten und Aussagen im Kontext der Glaubwürdigkeitsbegutachtung. Es werden die einzelnen Komponenten (Stimulus, Organismus, Reaktion, Kontingenz, Konsequenz) detailliert erläutert, und es wird dargestellt, wie dieses Modell hilft, den Entstehungsprozess von Aussagen zu verstehen und alternative Erklärungen für eine Aussage zu prüfen (z.B. Lügenhypothese vs. Suggestionshypothese). Das Kapitel betont die Bedeutung der Berücksichtigung individueller Faktoren und möglicher Einflüsse auf die Aussagebildung.
Evaluation: Das Kapitel skizziert die Planung und Durchführung einer Evaluationsstudie zur Glaubwürdigkeitsbegutachtung. Es beschreibt die Auswahl von Stichproben, die verwendeten Instrumente und die Art der erhobenen Daten. Beispiele wie die Analyse von Führungsstil, Betriebsklima und der Verbesserung von Fertigkeiten einzelner Mitarbeitender werden kurz erwähnt, um den Anwendungsbereich der Evaluationsmethoden zu illustrieren. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise bei der Evaluation und der Interpretation der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Glaubwürdigkeitsbegutachtung, Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, SORKC-Modell, Zeugenaussage, Kinderzeugen, Aussageanalyse, Inhaltsanalyse, Lügenhypothese, Suggestionshypothese, Pseudoerinnerung, kognitive Leistungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Glaubwürdigkeitsbegutachtung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die psychologische Glaubwürdigkeitsbegutachtung, insbesondere im Kontext von Fällen sexuellen Missbrauchs. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel (Glaubwürdigkeitsbegutachtung, SORKC-Modell, Evaluation) sowie eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit erläutert die methodischen Herausforderungen und das Vorgehen bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen, wobei das SORKC-Modell als theoretischer Rahmen dient. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Evaluation der Glaubwürdigkeitsbeurteilung.
Was ist das SORKC-Modell und wie wird es angewendet?
Das SORKC-Modell (Stimulus, Organismus, Reaktion, Kontingenz, Konsequenz) dient als theoretischer Rahmen zur Analyse von Verhalten und Aussagen. Es hilft, den Entstehungsprozess von Aussagen zu verstehen und alternative Erklärungen (z.B. Lügenhypothese vs. Suggestionshypothese) zu prüfen. Die einzelnen Komponenten des Modells werden detailliert erklärt.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Glaubwürdigkeitsbegutachtung: Beschreibt Zweck und Anwendung psychologischer Gutachten, insbesondere die Rolle des Gutachters und die Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit (Wahrheit einer Aussage) und Glaubwürdigkeit (generelle Wahrheitstreue).
Das SORKC-Modell: Detaillierte Erläuterung des Modells und seiner Anwendung zur Analyse von Aussagen.
Evaluation: Planung und Durchführung einer Evaluationsstudie zur Glaubwürdigkeitsbegutachtung, inklusive Stichprobenplanung, Instrumente und Datenerhebung. Beispiele umfassen die Analyse von Führungsstil, Betriebsklima und Verbesserung von Fertigkeiten einzelner Mitarbeitender.
Welche Herausforderungen werden bei der Glaubwürdigkeitsbegutachtung angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die methodischen Herausforderungen bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, insbesondere bei Kinderzeugen. Die Analyse der Aussagequalität und die Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit spielen eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Glaubwürdigkeitsbegutachtung, Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, SORKC-Modell, Zeugenaussage, Kinderzeugen, Aussageanalyse, Inhaltsanalyse, Lügenhypothese, Suggestionshypothese, Pseudoerinnerung, kognitive Leistungsfähigkeit.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Personen, die sich akademisch mit der psychologischen Glaubwürdigkeitsbegutachtung auseinandersetzen, insbesondere im Kontext der Rechtswissenschaften und der Psychologie. Es dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Forensisch-psychologische Glaubwürdigkeitsbegutachtung, SORKC-Modell und Evaluation durch L-Daten, T-Daten und Q-Daten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1134666