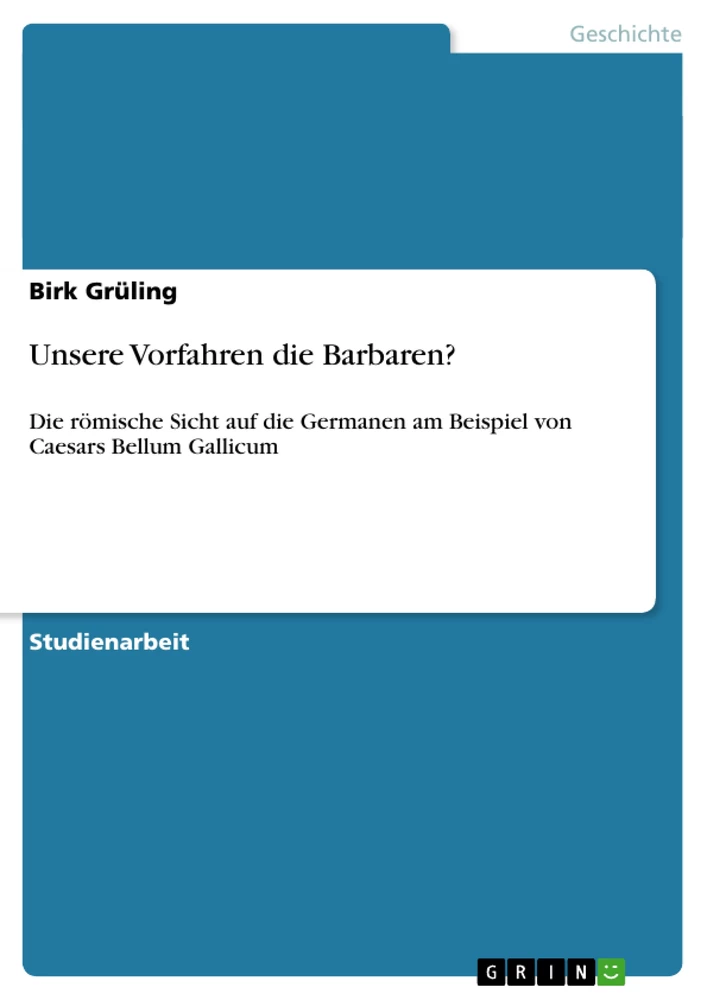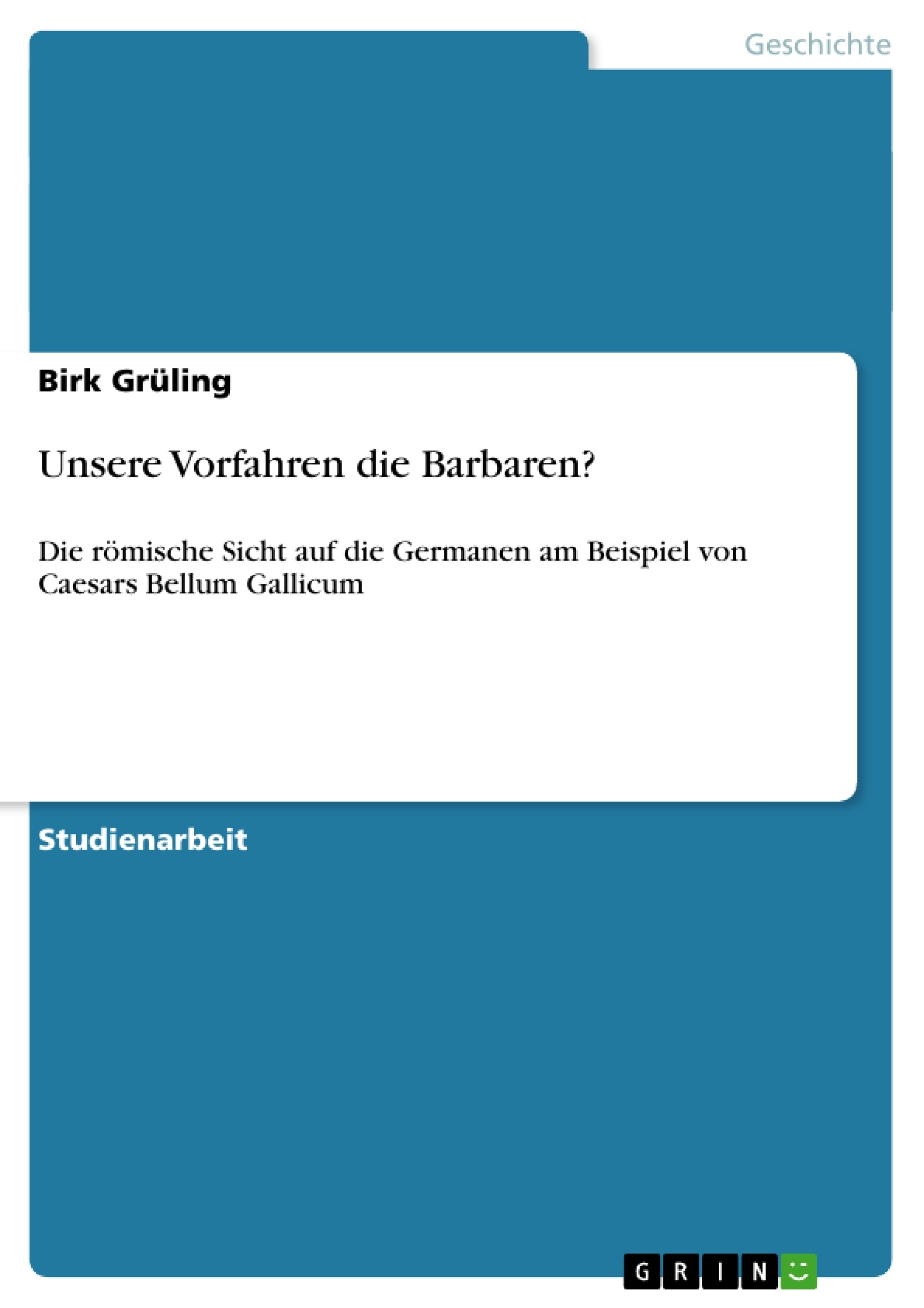Im Rahmen meiner Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Germanenbild der Römer in der Antike. Ich lege dabei meinen Fokus auf die Darstellung der Germanen in Caesars Werk zum „Bellum Gallicum“. Diese Beschränkung erscheint mir besonders sinnvoll, da Caesars Ausführung über seine Zeit in Gallien eins der meist gelesenen Werke der Antike ist und ein politisch hochbrisantes dazu. Generationen von Schülern mussten die Beschreibung des gallischen Krieges im Lateinunterricht übersetzen. Die Germanendarstellung war im 19. und 20. Jahrhundert stark verklärt, das zeigen besonders Schulbücher aus dieser Zeit. Es fand ein geradezu Glorifizierung der Germanen statt, erst in den letzten 30 Jahren begann eine rationalere Debatte, in der nationale Ideologien ausgeblendet werden konnten. Ich möchte mich zuerst mit den im Seminar erarbeiteten Merkmalen vom Barbarentum beschäftigen und diese auf Caesars Beschreibungen beziehen. Dabei soll auch eine Destruktion der Berichte stattfinden, durch zum Beispiel archäologische Erkenntnisse. Hinter Caesars Werk stand eine politische Intention. Caesar brauchte eine Rechtfertigung für seine Legionen. Wie könnte man den Besitz von Soldaten besser in Rom begründen, als mit einer akuten Bedrohung für das Reich? Der Destruktion des Germanenbildes Caesars soll der Vergleich mit einer weiteren berühmten Darstellung der Antike, allerdings aus unserer Zeit, folgen und zwar mit Asterix und Obelix. In „Asterix und die Goten“ wird ein sehr schönes Germanenbild gezeichnet. Mögliche Parallelen und ihre Hintergründe sollen hierbei aufgezeigt werden. Hauptziel meiner Arbeit ist es, die Vorurteile und ihre Konstruktion am Beispiel der Germanen nachvollziehbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellen zu den Germanen
- Wer sind überhaupt Germanen?
- Barbarentopos und seine Theorien
- Caesars Germanenbild und sein politischer Hintergrund
- Rhein als ethnische Grenze
- Der moderne Germanenbegriff seit dem 19. Jahrhundert
- Asterix und die Goten – Ein Beispiel für moderne Germanendarstellung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das römische Germanenbild der Antike, fokussiert auf Caesars Darstellung im „Bellum Gallicum“. Ziel ist es, die Konstruktion von Vorurteilen anhand des Germanenbeispiels nachzuvollziehen und die politische Intention hinter Caesars Schilderungen aufzudecken. Ein Vergleich mit der modernen Germanendarstellung in Asterix und Obelix soll zusätzliche Perspektiven eröffnen.
- Das römische Germanenbild im „Bellum Gallicum“
- Der Barbarentopos und seine Anwendung auf die Germanen
- Die politische Instrumentalisierung des Germanenbildes durch Caesar
- Der Rhein als ethnische und politische Grenze
- Moderne Rezeption des Germanenbildes im Vergleich zu antiken Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert das Germanenbild Caesars im „Bellum Gallicum“, unterstreicht dessen Bedeutung als einflussreiche Quelle und setzt sie in den Kontext der modernen Rezeption und der nationalistischen Verklärung des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Arbeit beabsichtigt eine kritische Auseinandersetzung mit Caesars Darstellung und deren politischer Funktion, sowie einen Vergleich mit einer zeitgenössischen, populärkulturellen Darstellung.
Quellen zu den Germanen: Dieses Kapitel diskutiert die begrenzten Quellen zur germanischen Kultur in der Antike, die sich auf schriftliche Zeugnisse griechischer und römischer Autoren und archäologische Funde beschränken. Es hebt die Probleme der Glaubwürdigkeit antiker Schriften und die Herausforderungen der Interpretation archäologischer Artefakte hervor. Caesars „Bellum Gallicum“ wird als die wichtigste zusammenhängende Quelle über die Germanen hervorgehoben, obwohl Caesars Kenntnisse teilweise auf indirekten Quellen beruhten.
Wer sind überhaupt Germanen?: Das Kapitel hinterfragt die Identität der Germanen als ethnische Einheit. Es argumentiert, dass der Begriff „Germane“ ein von den Römern geprägter Sammelbegriff ist, der keine einheitliche Sprache, Kultur oder politischen Verband der verschiedenen germanischen Gruppen repräsentiert. Die wissenschaftliche Diskussion um den Begriff der Ethnogenese und die Herausforderungen der Definition eines „germanischen Volkes“ werden angesprochen. Der Einfluss von Caesars Werk auf die nachfolgende Wahrnehmung und die Festlegung des Rheins als Grenze wird diskutiert.
Barbarentopos und seine Theorien: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Barbar“ in der griechischen und römischen Antike und dessen Anwendung auf die Germanen. Es erläutert die Klimaktheorie von Vitruv, die physikalische Unterschiede zwischen den Völkern im Norden und Süden erklärt, um die vermeintliche „Barbarei“ der Germanen zu begründen. Die Arbeit zeigt, wie Fremdheit und das Unbekannte als Kriterien für „Barbarei“ verwendet wurden, und untersucht, wie diese Konzepte Caesars Beschreibung der Germanen beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Germanen, Römer, Caesar, Bellum Gallicum, Barbarentopos, Ethnogenese, Vorurteile, politische Propaganda, Antike, Moderne Rezeption, Asterix.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Römisches Germanenbild im Bellum Gallicum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das römische Germanenbild, insbesondere Caesars Darstellung im „Bellum Gallicum“. Sie untersucht die Konstruktion von Vorurteilen, die politische Intention hinter Caesars Schilderungen und vergleicht diese mit modernen Rezeptionen des Germanenbildes (z.B. Asterix).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das römische Germanenbild im „Bellum Gallicum“, den Barbarentopos und seine Anwendung auf die Germanen, die politische Instrumentalisierung des Germanenbildes durch Caesar, den Rhein als ethnische und politische Grenze sowie die moderne Rezeption des Germanenbildes im Vergleich zu antiken Quellen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist Caesars „Bellum Gallicum“. Zusätzlich werden andere antike schriftliche Zeugnisse griechischer und römischer Autoren sowie archäologische Funde diskutiert. Die Arbeit thematisiert auch die Probleme der Glaubwürdigkeit antiker Schriften und die Herausforderungen der Interpretation archäologischer Artefakte.
Wer waren die Germanen?
Die Arbeit hinterfragt die Identität der Germanen als ethnische Einheit. Es wird argumentiert, dass „Germane“ ein von den Römern geprägter Sammelbegriff ist, der keine einheitliche Sprache, Kultur oder politischen Verband repräsentiert. Die Herausforderungen der Definition eines „germanischen Volkes“ und der Einfluss von Caesars Werk auf die nachfolgende Wahrnehmung werden diskutiert.
Was ist der Barbarentopos?
Das Kapitel beleuchtet den Begriff „Barbar“ in der griechischen und römischen Antike und dessen Anwendung auf die Germanen. Es erläutert Theorien wie die Klimaktheorie von Vitruv, die physikalische Unterschiede zwischen den Völkern im Norden und Süden erklärt, um die vermeintliche „Barbarei“ der Germanen zu begründen. Die Arbeit zeigt, wie Fremdheit und das Unbekannte als Kriterien für „Barbarei“ verwendet wurden.
Welche Rolle spielt der Rhein?
Der Rhein wird als ethnische und politische Grenze zwischen Römern und Germanen untersucht. Die Arbeit analysiert, wie Caesar den Rhein in seiner Darstellung instrumentalisiert und wie dieser als Grenze in der späteren Wahrnehmung der Germanen eine Rolle spielte.
Wie wird das moderne Germanenbild dargestellt?
Die Arbeit vergleicht das antike Germanenbild mit der modernen Rezeption, insbesondere am Beispiel der Comic-Reihe Asterix und Obelix. Dies soll zusätzliche Perspektiven auf die Konstruktion und Veränderung des Germanenbildes eröffnen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Caesars Darstellung der Germanen stark von politischen Intentionen geprägt ist und ein konstruiertes Bild vermittelt, welches Vorurteile und Stereotype beinhaltet. Der Vergleich mit dem modernen Germanenbild zeigt die anhaltende Wirkung dieser antiken Konstruktion und deren Veränderung im Laufe der Geschichte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Germanen, Römer, Caesar, Bellum Gallicum, Barbarentopos, Ethnogenese, Vorurteile, politische Propaganda, Antike, Moderne Rezeption, Asterix.
- Quote paper
- Birk Grüling (Author), 2008, Unsere Vorfahren die Barbaren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113443