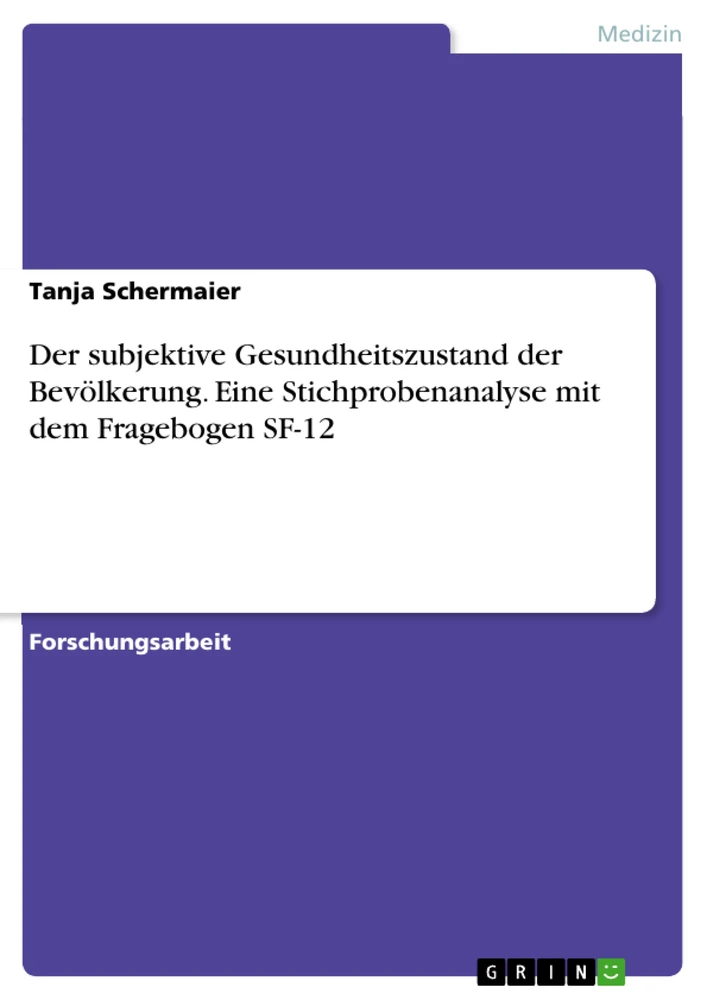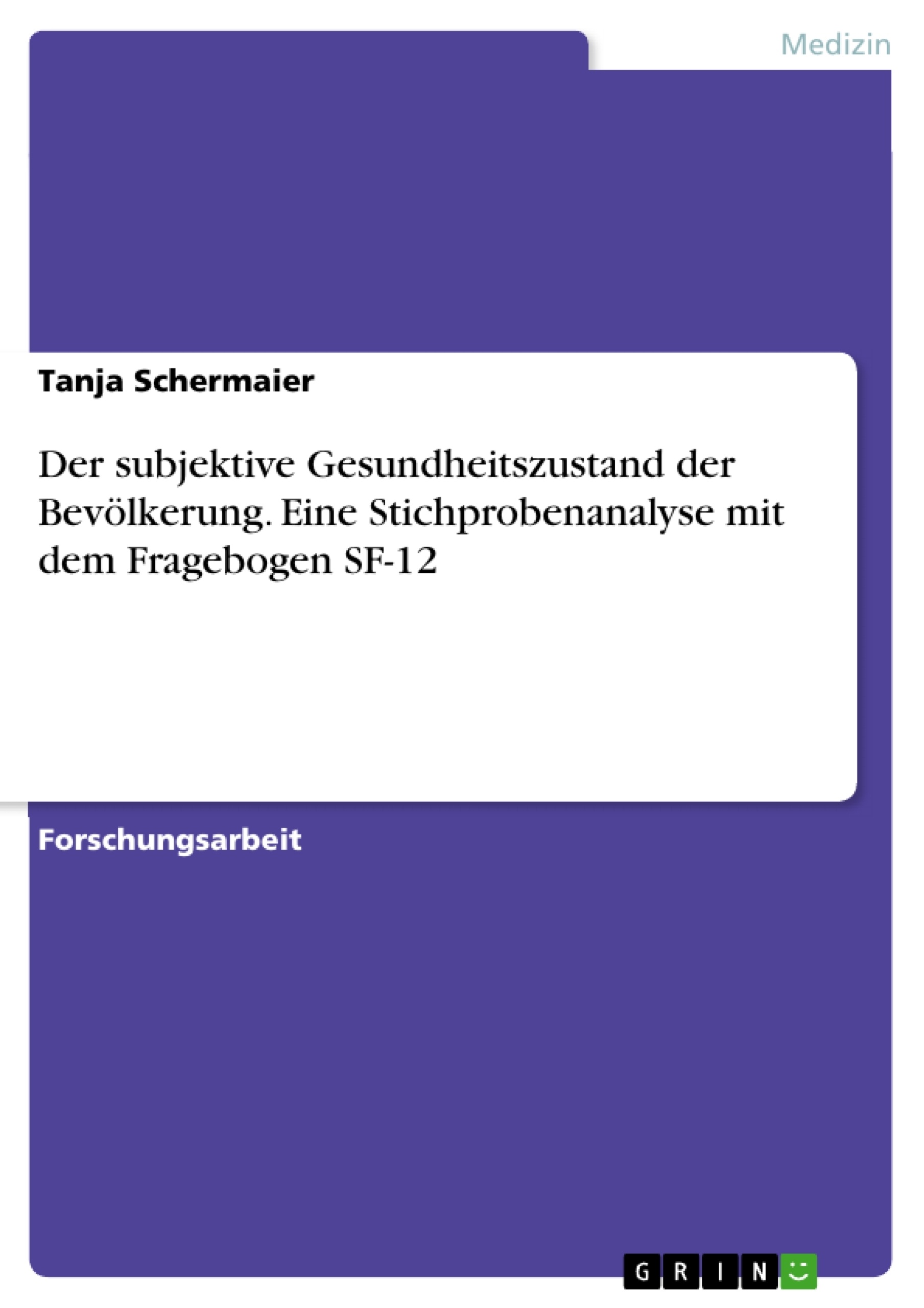Ziel dieser Arbeit ist es, einen aktuellen Einblick in das subjektive Empfinden des Gesundheitszustands der durchschnittlichen Bevölkerung zu gewinnen. Daraus ergibt sich die Forschungsfrage, die lautet: Wie stellt sich der subjektive Gesundheitszustand von Männern und Frauen dar? Zur Erfassung wurde der Selbstbeurteilungsbogen SF-12, ein quantitativ standardisiertes Messinstrumentarium, gewählt. Die Daten ermöglichen beispielsweise die Korrelation des Geschlechtes sowie dem subjektiv geschätzten Gesundheitszustand.
Der SF-12 ist eine Kurzversion des SF-36 und ist ein quantitativer, standardisierter Fragebogen. Es wurde für die Arbeit eine Gliederung mit fünf Kapiteln und Unterpunkten erstellt. Das erste Kapitel lautet die Problemstellung, diesem folgt der Methodenteil und im Anschluss die Darstellung der Ergebnisse. Basierend auf dem Ergebnissteil, folgt die Diskussion und als letztes Kapitel die Zusammenfassung.
Im Ergebnissteil wird präzise die Hypothesenstellung mit statistischen Daten dargestellt. Dabei können sich die gewünschten Korrelationen von psychisch und physischer Gesundheit, sowie Unterschiede der psychischen und physischen Gesundheit, von Mann und Frau aufzeigen. Sie geben die Antwort auf die Frage, wie Männer und Frauen subjektiv ihre Gesundheit sehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 1.1 Theoretischer Hintergrund
- 1.1.1 Gesundheit
- 1.1.2 Salutogenese
- 1.2 Empirischer Forschungsstand
- 1.3 Fragestellung und Hypothese
- 1.4 Methoden
- 1.5 Stichprobenbeschreibung
- 1.6 Untersuchungsinstrument
- 2.2.1 SF-12
- 2.3 Durchführung der Untersuchung
- 3. Ergebnisse
- 4. Diskussion
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen aktuellen Einblick in das subjektive Empfinden des Gesundheitszustands der durchschnittlichen Bevölkerung zu gewinnen, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Forschungsfrage lautet: Wie stellt sich der subjektive Gesundheitszustand von Männern und Frauen dar? Die Studie verwendet den SF-12 Fragebogen zur Datenerhebung.
- Subjektiver Gesundheitszustand von Männern und Frauen
- Einfluss von psychischen und physischen Faktoren auf die Gesundheit
- Anwendung des SF-12 Fragebogens zur Gesundheitsmessung
- Vergleich mit dem bestehenden empirischen Forschungsstand
- Theoretische Grundlagen der Gesundheit und Salutogenese
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt den Ausgangspunkt der Forschungsarbeit: eine Hospitation in Rehabilitationskursen, die die Einschränkungen chronisch kranker Personen im Alltag aufzeigt. Es wird die Forschungsfrage formuliert, die den subjektiven Gesundheitszustand von Männern und Frauen untersucht, und die Methodik der Studie, basierend auf dem SF-12 Fragebogen, skizziert. Die Bedeutung der Untersuchung für das Verständnis der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung wird hervorgehoben.
1.1 Theoretischer Hintergrund: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gesundheitsbegriff, beginnend mit der WHO-Definition von 1946 und deren Kritikpunkte. Er diskutiert alternative Sichtweisen, die den subjektiven Aspekt der Gesundheit stärker betonen und das Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit hervorheben. Der Beitrag von Hurrelmann und Woll zur erweiterten Gesundheitsdefinition wird erläutert, um den komplexen und mehrdimensionalen Charakter des Begriffs zu verdeutlichen.
1.1.2 Salutogenese: Dieses Unterkapitel stellt das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky vor, das sich auf die Faktoren konzentriert, die Gesundheit fördern und erhalten. Im Gegensatz zum pathogenetischen Ansatz, der sich auf Krankheiten konzentriert, betont die Salutogenese die Resilienz und die Fähigkeit von Menschen, trotz Stress gesund zu bleiben. Antonovskys Konzept des „Wohlsein-Unwohlsein-Kontinuums“ und seine Bedeutung für die Gesundheitsforschung werden detailliert erklärt.
1.2 Empirischer Forschungsstand: Der empirische Forschungsstand wird vorgestellt, basierend auf einer Studie des Statistischen Bundesamtes von 2016 zur Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes nach Altersgruppen und Geschlecht. Die Methodik der Studie (EU-SILC Panelerhebung mit Likert-Skala) und die wichtigsten Ergebnisse bezüglich der Selbsteinschätzung der Gesundheit von Männern und Frauen werden zusammengefasst. Dies dient als Ausgangspunkt für die eigene Untersuchung.
Schlüsselwörter
Subjektiver Gesundheitszustand, Salutogenese, SF-12, Gesundheitsforschung, Geschlecht, chronische Erkrankungen, Empirische Studie, Gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL), Resilienz, Gesundheitskontinuum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Subjektiver Gesundheitszustand von Männern und Frauen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den subjektiven Gesundheitszustand von Männern und Frauen. Sie beleuchtet geschlechtsspezifische Unterschiede im Empfinden des Gesundheitszustands und analysiert die Einflüsse psychischer und physischer Faktoren.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie stellt sich der subjektive Gesundheitszustand von Männern und Frauen dar?
Welche Methode wird verwendet?
Zur Datenerhebung wird der SF-12 Fragebogen eingesetzt. Die Studie basiert auf einer quantitativen Auswertung der Ergebnisse dieses standardisierten Fragebogens.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die WHO-Definition von Gesundheit, kritische Auseinandersetzungen damit und alternative Sichtweisen, die den subjektiven Aspekt stärker betonen. Ein wichtiger Bestandteil ist das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky, welches die Faktoren der Gesundheitsförderung und -erhaltung im Vordergrund stellt.
Wie wird der Begriff "Gesundheit" in der Arbeit definiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Gesundheitsdefinitionen, beginnend mit der WHO-Definition von 1946 und deren Limitationen. Sie geht auf erweiterte Definitionen ein, die den subjektiven Aspekt und das Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit stärker berücksichtigen.
Welche Rolle spielt die Salutogenese?
Das salutogenetische Modell von Antonovsky spielt eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zum krankheitsorientierten (pathogenetischen) Ansatz konzentriert sich die Salutogenese auf Ressourcen und Faktoren, die die Gesundheit fördern und erhalten, insbesondere die Resilienz.
Wie sieht der empirische Forschungsstand aus?
Der empirische Forschungsstand basiert auf einer Studie des Statistischen Bundesamtes von 2016 (EU-SILC Panelerhebung) zur Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands nach Altersgruppen und Geschlecht. Die Ergebnisse dieser Studie dienen als Vergleichsbasis für die eigene Untersuchung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Problemstellung (inkl. theoretischem Hintergrund und empirischem Forschungsstand, Fragestellung, Methodik, Stichprobenbeschreibung und Instrumentenbeschreibung), Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Subjektiver Gesundheitszustand, Salutogenese, SF-12, Gesundheitsforschung, Geschlecht, chronische Erkrankungen, Empirische Studie, Gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL), Resilienz, Gesundheitskontinuum.
Wo kann ich mehr über den SF-12 Fragebogen erfahren?
Der SF-12 Fragebogen wird im Kapitel zur Methodik detailliert beschrieben. Zusätzliche Informationen sind über wissenschaftliche Literatur zum SF-12 zu finden.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen aktuellen Einblick in das subjektive Empfinden des Gesundheitszustands der durchschnittlichen Bevölkerung zu gewinnen, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede.
- Citar trabajo
- Tanja Schermaier (Autor), 2020, Der subjektive Gesundheitszustand der Bevölkerung. Eine Stichprobenanalyse mit dem Fragebogen SF-12, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133643