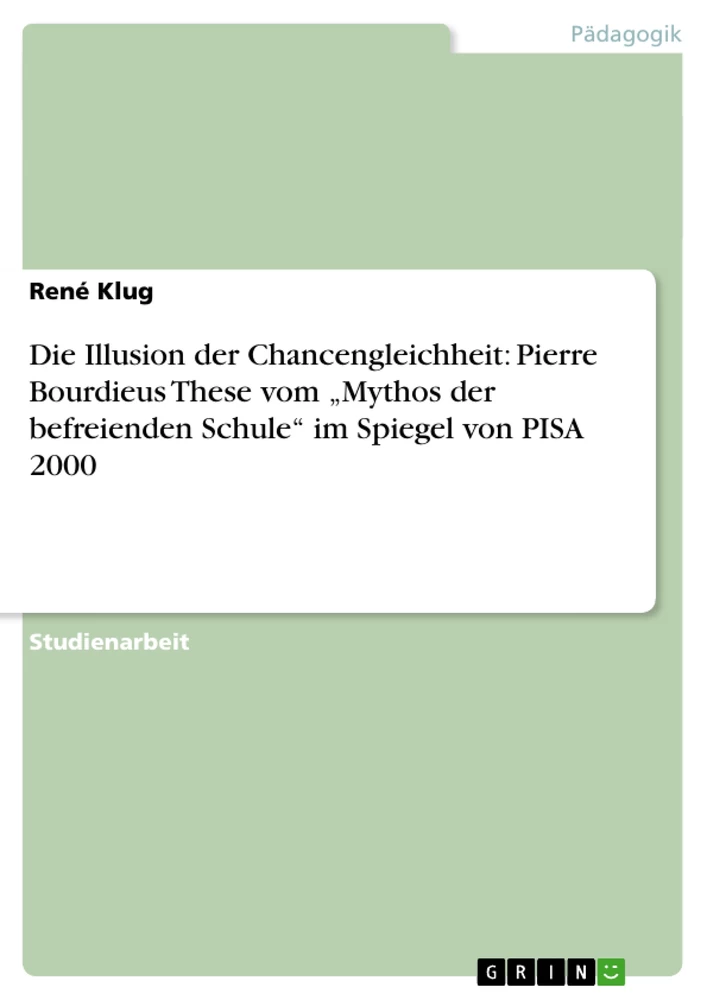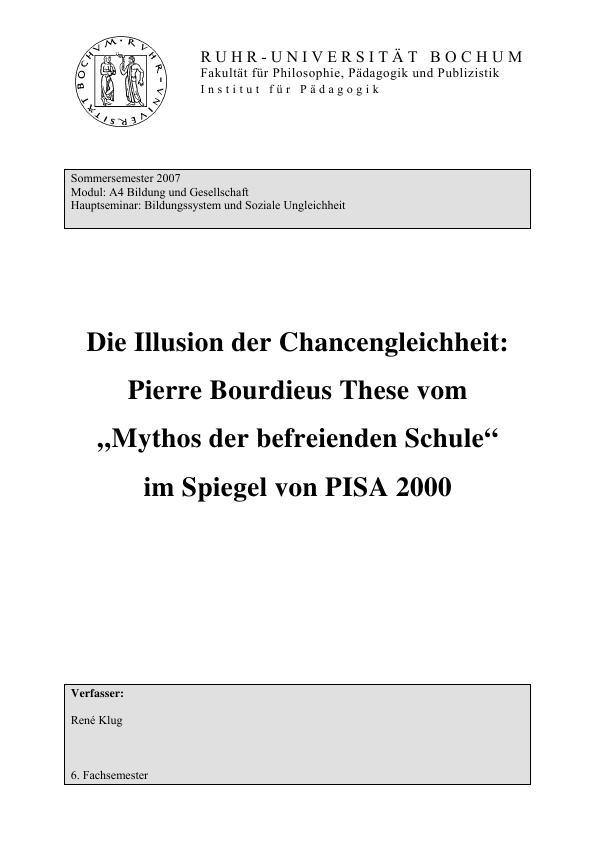Diese Arbeit befasst sich mit den Analysen des französischen Soziologen, Kulturphilosophen und Zeitkritikers Pierre Bourdieu. Ziel soll es dabei sein, seine hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren aufgestellten Thesen zum Thema soziale Ungleichheit im (französischen) Bildungswesen darzustellen, um diese in einem nächsten Schritt auf das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland zu beziehen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht damit die Frage, ob – und falls ja, auf welche Art und Weise – sich die im eingangs erwähnten Zitat beschriebene soziale Selektivität des Bildungssystems mithilfe der Terminologie Bourdieus im Einzelnen beschreiben und belegen lässt.
Ausgehend von einigen kurzen biographischen Notizen zum Werdegang und Schaffen
Bourdieus gilt es demnach zunächst die zentralen Begrifflichkeiten zu nennen
sowie im Detail zu erläutern, welche für die nachfolgenden Analysen von Bedeutung sein werden. Im Einzelnen sind dies die Begriffe des Habitus sowie des Kapitals (und seiner spezifischen Formen). Im Anschluss daran werden diese Begriffe in den Kontext von Bourdieus Untersuchungen zur Selektivität des französischen Bildungssystems der 60er Jahre zurückgebunden um somit die Mechanismen aufzeigen zu können, mittels derer nach Bourdieu die Schule eine herrschaftssichernde bzw. den gesellschaftlichen Status quo aufrechterhaltende Funktion ausübt.
Im Folgenden richtet sich der Fokus dieser Arbeit dann auf das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland. Als Diagnoseinstrument dient hierbei die internationale Vergleichsstudie PISA 2000, deren zentrale Ergebnisse vorgestellt werden, um diese schließlich mit den Analysen Bourdieus in Verbindung zu bringen sowie einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Abschließen wird die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PIERRE BOURDIEU – EINE KURZE BIOGRAPHISCHE NOTIZ
- HABITUS
- KAPITAL
- ÖKONOMISCHES KAPITAL
- KULTURELLES KAPITAL
- Objektiviertes Kulturkapital
- Inkorporiertes Kulturkapital
- Institutionalisiertes Kulturkapital
- SOZIALES KAPITAL
- SYMBOLISCHES KAPITAL
- BILDUNG: REPRODUKTIONSMECHANISMEN SOZIALER UNGLEICHHEIT
- SOZIALE SELEKTIVITÄT IM DEUTSCHEN BILDUNGSSYSTEM
- DIE INTERNATIONALE VERGLEICHSSTUDIE PISA
- PISA 2000: OPERATIONALISIERUNG & DURCHFÜHRUNG
- PISA 2000: ZENTRALE BEFUNDE
- PISA 2006: AKTUELLE ERGEBNISSE IM VERGLEICH
- ÜBERPRÜFUNG UND KRITIK DER THESEN BOURDIEUS
- RESÜMEE
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Thesen des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zur sozialen Ungleichheit im Bildungssystem. Ziel ist es, seine zentralen Konzepte, insbesondere den Habitus und die verschiedenen Kapitalformen, zu erläutern und auf das deutsche Bildungssystem zu übertragen. Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern die soziale Selektivität des Bildungssystems mit Bourdieus Terminologie erklärt werden kann.
- Die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem
- Die Rolle des Habitus und des Kapitals in der Bildung
- Die Analyse des deutschen Bildungssystems im Spiegel von PISA 2000
- Die Kritik an der Illusion der Chancengleichheit
- Die Bedeutung von Bourdieus Thesen für die aktuelle Bildungsdiskussion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Forschungsansatz. Sie führt in die Thematik der sozialen Selektivität im Bildungssystem ein und stellt die Relevanz von Bourdieus Thesen heraus.
Kapitel 2 bietet eine kurze biographische Notiz zu Pierre Bourdieu und beleuchtet seine wissenschaftliche Karriere. Es wird auf seine frühen Forschungen in Algerien und die Entwicklung seiner zentralen Konzepte eingegangen.
Kapitel 3 erläutert den Begriff des Habitus als ein zentrales Konzept in Bourdieus Werk. Es wird dargestellt, wie der Habitus die soziale Praxis und das Denken von Individuen prägt und die Reproduktion sozialer Ungleichheit beeinflusst.
Kapitel 4 definiert die verschiedenen Kapitalformen, die Bourdieu unterscheidet: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital. Es wird gezeigt, wie diese Kapitalformen die soziale Position von Individuen bestimmen und die Chancen im Bildungssystem beeinflussen.
Kapitel 5 analysiert die Mechanismen der sozialen Selektivität im französischen Bildungssystem nach Bourdieu. Es wird gezeigt, wie die Schule die herrschende Gesellschaftsordnung reproduziert und die Chancen von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten beeinflusst.
Kapitel 6 stellt die internationale Vergleichsstudie PISA 2000 vor und erläutert deren zentrale Ergebnisse. Es wird gezeigt, wie die Ergebnisse der Studie die Thesen Bourdieus über die soziale Selektivität im Bildungssystem bestätigen.
Kapitel 7 überprüft und kritisiert die Thesen Bourdieus im Lichte der Ergebnisse von PISA 2000. Es werden die Stärken und Schwächen seiner Analyse diskutiert und alternative Erklärungen für die soziale Selektivität im Bildungssystem betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Pierre Bourdieu, soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Habitus, Kapital, Reproduktion, Selektivität, PISA 2000, Chancengleichheit, Deutschland, Frankreich.
- Quote paper
- René Klug (Author), 2008, Die Illusion der Chancengleichheit: Pierre Bourdieus These vom „Mythos der befreienden Schule“ im Spiegel von PISA 2000, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113355