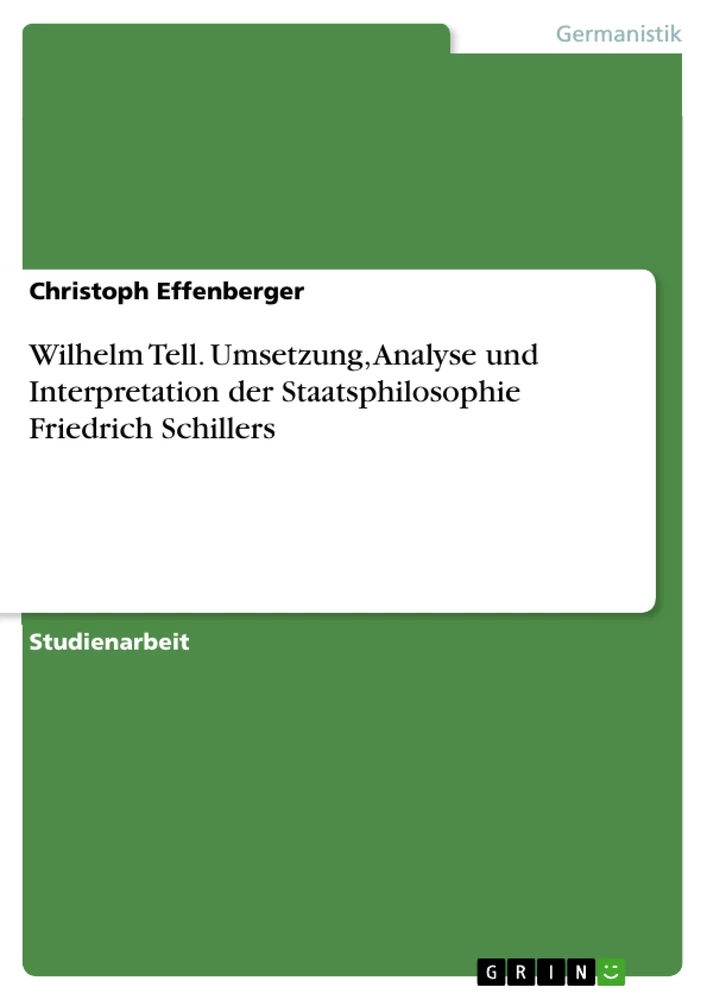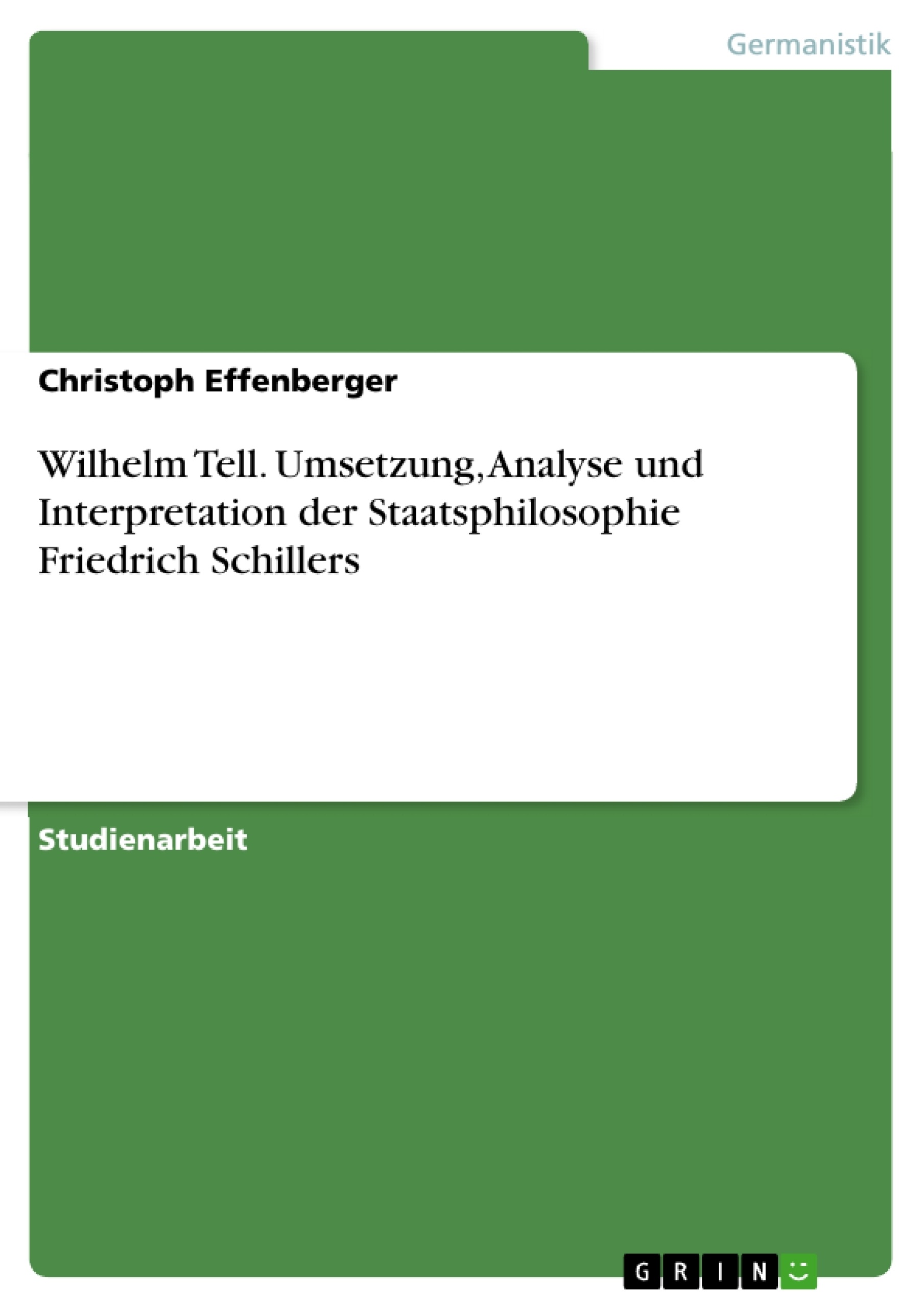Gemeinsam mit Johann Wolfgang von Goethe stand Friedrich Schiller der Französischen Revolution des Jahres 1789 zweifelnd und kritisch gegenüber . Besonders die Diktatur der Gewaltexzesse, Willkür und Brutalität, namentlich unter Robespierre, erzeugte nicht nur in den beiden bedeutendsten deutschen Literaten des 18. Jahrhunderts ein Gefühl der Unrechtmäßigkeit und fehlenden Autorität bzw. Legitimität dieser Umwälzungen.
Unumstritten ist, dass Schillers „Wilhelm Tell“ durch die Ereignisse in Frankreich inspiriert wurde.
Dennoch ist die Annahme, es handle sich bei diesem Drama um eine literarische Umsetzung der revolutionären Geschehnisse, fehlerhaft und wurde durch die moderne Literaturwissenschaft mehrfach widerlegt. Dieter Borchmeyer bezeichnet den Schillerschen Freiheitskampf der Schweizer als „politisch-ästhetisches Gegenmodell“ zur „chaotischen Willkür“ der Französischen Revolution.
Die Grundlagen zur Konstruktion des Handlungsstranges sowie der Figurencharaktere und des Figurenhabitus im „Wilhelm Tell“ finden sich in den 1795 erschienen Schriften Schillers „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen“. Dort entstanden konkrete staatsphilosophische Ideen und Bewertungshorizonte des Autors.
Aufgabe der folgenden Arbeit soll es nun sein, genau diese Affinitäten zwischen den Briefen zur „ästhetischen Erziehung“ und dem Drama „Wilhelm Tell“ herauszuarbeiten und anschließend zu analysieren.
Dazu folgt im Anschluss ein kurzer Überblick zu den Theorien der Schillerschen Staatsphilosophie. Anschließend soll anhand ausgewählter Szenen des Dramas die Existenz der Parallelität nachgewiesen werden und entsprechend dem vorgegeben Wertekanon des Autors betrachtet werden. Es entspricht dem Wesen eines Dramas, dass die Handlung bzw. das Verhalten einzelner Figuren oder Figurenkonstellationen im Mittelpunkt steht. Diese Grundstruktur findet sich natürlich auch im „Wilhelm Tell“. Aus diesem Grund erfolgt die Ausarbeitung und Analyse anhand bestehender Figurenkonstellationen im Drama selbst. Dabei konnte nur auf die dominantesten und vordergründigsten Rücksicht genommen werden, da sonst die Sprengung des Rahmens einer Hausarbeit drohen würde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schillers Staats- und Sozialisierungsphilosophie
- 2.1 Der Naturstaat, die Fiktion des Naturzustandes, der Staat und der Gesellschaftsvertrag
- 2.2 Kündigung des Gesellschaftsvertrages, Revolution und die Rolle der Ästhetischen Erziehung
- 3. Analyse des Dramas
- 3.1 Der Bruch des Gesellschaftsvertrages und die Reaktionen der Schweizer
- 3.2 Das Treffen am Rütli als Abschluss eines neuen Gesellschaftsvertrages
- 3.3 Die Entwicklung der „Außenstehenden\": Wilhelm Tell und Ulrich von Rudenz
- 3.4 Die Befreiung der Kantone durch den Tod des Hermann Geßler und die Reaktionen der Schweizer
- 4. Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Friedrich Schillers Briefen zur „ästhetischen Erziehung“ und seinem Drama „Wilhelm Tell“, um Schillers Staatsphilosophie und deren Umsetzung im Drama zu analysieren. Es werden die Umstände untersucht, die eine Revolution im Sinne Schillers legitimieren, die Gefahren während des Revolutionsprozesses und den Einfluss individueller Charaktere. Das Schillersche „Gegenmodell“ zur Französischen Revolution wird ebenfalls betrachtet.
- Schillers Staatsphilosophie und deren Wurzeln in Kant und Rousseau
- Die Konzeption des Naturstaates und die „Fiktion des Naturzustandes“
- Der Gesellschaftsvertrag und dessen Bruch als Auslöser der Revolution
- Die Rolle der ästhetischen Erziehung in der Gestaltung eines gerechten Staates
- Die Charakterisierung der Figuren in „Wilhelm Tell“ als Ausdruck der Staatsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Verbindungen zwischen Schillers Staatsphilosophie und seinem Drama „Wilhelm Tell“ vor. Sie thematisiert Schillers kritische Haltung zur Französischen Revolution und die unterschiedlichen Interpretationen des Dramas als revolutionäre oder gegenrevolutionäre Schrift. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Parallelen zwischen den „Briefen zur ästhetischen Erziehung“ und „Wilhelm Tell“, um Schillers Staatsverständnis und dessen Umsetzung im Drama zu untersuchen. Die methodische Herangehensweise wird erläutert, wobei die Analyse auf ausgewählte Figurenkonstellationen fokussiert, um den Rahmen der Arbeit einzuhalten. Schließlich werden zentrale Forschungsfragen formuliert, die als Leitfaden für die Analyse dienen.
2. Schillers Staats- und Sozialisierungsphilosophie: Dieses Kapitel beleuchtet die philosophischen Grundlagen von Schillers Staatsphilosophie, die auf den Ideen von Kant und Rousseau basieren. Es untersucht den Naturzustand, die Entwicklung des Gesellschaftsvertrages und dessen potenziellen Bruch als Vorbedingung für eine Revolution. Schiller stellt den "physischen Menschen" mit seinen natürlichen Trieben dem "moralischen Menschen" mit seinem Vernunftverständnis gegenüber. Der "Naturstaat" wird als ein Zustand beschrieben, der durch die "Notwendigkeit" der Natur bestimmt ist, während der Übergang zum moralischen Staat durch die Fähigkeit des Menschen, "moralische Notwendigkeit" zu empfinden, erreicht wird. Diese Entwicklung führt zur "Fiktion des Naturzustandes" – eine Balance zwischen Natur und Moral, die die Willkür verhindert und Freiheiten gewährleistet. Die Bedeutung der ästhetischen Erziehung als Mittel zur Entwicklung moralischer Werte und zur Schaffung eines harmonischen Staatswesens wird hier ebenfalls thematisiert.
Häufig gestellte Fragen zu "Wilhelm Tell" und Schillers Staatsphilosophie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Friedrich Schillers Briefen zur „ästhetischen Erziehung“ und seinem Drama „Wilhelm Tell“, um Schillers Staatsphilosophie und deren Umsetzung im Drama zu analysieren. Es werden die Umstände untersucht, die eine Revolution im Sinne Schillers legitimieren, die Gefahren während des Revolutionsprozesses und den Einfluss individueller Charaktere. Das Schillersche „Gegenmodell“ zur Französischen Revolution wird ebenfalls betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Schillers Staatsphilosophie und deren Wurzeln in Kant und Rousseau, der Konzeption des Naturstaates und der „Fiktion des Naturzustandes“, dem Gesellschaftsvertrag und dessen Bruch als Auslöser der Revolution, der Rolle der ästhetischen Erziehung in der Gestaltung eines gerechten Staates und der Charakterisierung der Figuren in „Wilhelm Tell“ als Ausdruck der Staatsphilosophie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Schillers Staats- und Sozialisierungsphilosophie, ein Kapitel zur Analyse des Dramas "Wilhelm Tell" und eine Abschlussbetrachtung. Das Kapitel zur Analyse des Dramas untersucht den Bruch des Gesellschaftsvertrages und die Reaktionen der Schweizer, das Treffen am Rütli als Abschluss eines neuen Gesellschaftsvertrages, die Entwicklung der „Außenstehenden“ Wilhelm Tell und Ulrich von Rudenz sowie die Befreiung der Kantone durch den Tod des Hermann Geßler und die Reaktionen der Schweizer.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Verbindungen zwischen Schillers Staatsphilosophie und seinem Drama „Wilhelm Tell“ vor. Sie thematisiert Schillers kritische Haltung zur Französischen Revolution und die unterschiedlichen Interpretationen des Dramas. Die methodische Herangehensweise wird erläutert, und zentrale Forschungsfragen werden formuliert.
Was wird im Kapitel zu Schillers Staats- und Sozialisierungsphilosophie behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die philosophischen Grundlagen von Schillers Staatsphilosophie, die auf den Ideen von Kant und Rousseau basieren. Es untersucht den Naturzustand, die Entwicklung des Gesellschaftsvertrages und dessen potenziellen Bruch als Vorbedingung für eine Revolution. Die Bedeutung der ästhetischen Erziehung als Mittel zur Entwicklung moralischer Werte und zur Schaffung eines harmonischen Staatswesens wird thematisiert. Der "physische" und der "moralische" Mensch und die "Fiktion des Naturzustandes" werden erläutert.
Welche methodische Herangehensweise wird verwendet?
Die Analyse fokussiert auf ausgewählte Figurenkonstellationen in "Wilhelm Tell", um den Rahmen der Arbeit einzuhalten und die Parallelen zu Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung herauszuarbeiten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Schillers Staatsphilosophie und seinem Drama "Wilhelm Tell". Die genaue Schlussfolgerung wird im letzten Kapitel, der Abschlussbetrachtung, gezogen und ist aus dem hier gegebenen Auszug nicht ersichtlich.
- Quote paper
- Christoph Effenberger (Author), 2002, Wilhelm Tell. Umsetzung, Analyse und Interpretation der Staatsphilosophie Friedrich Schillers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113354