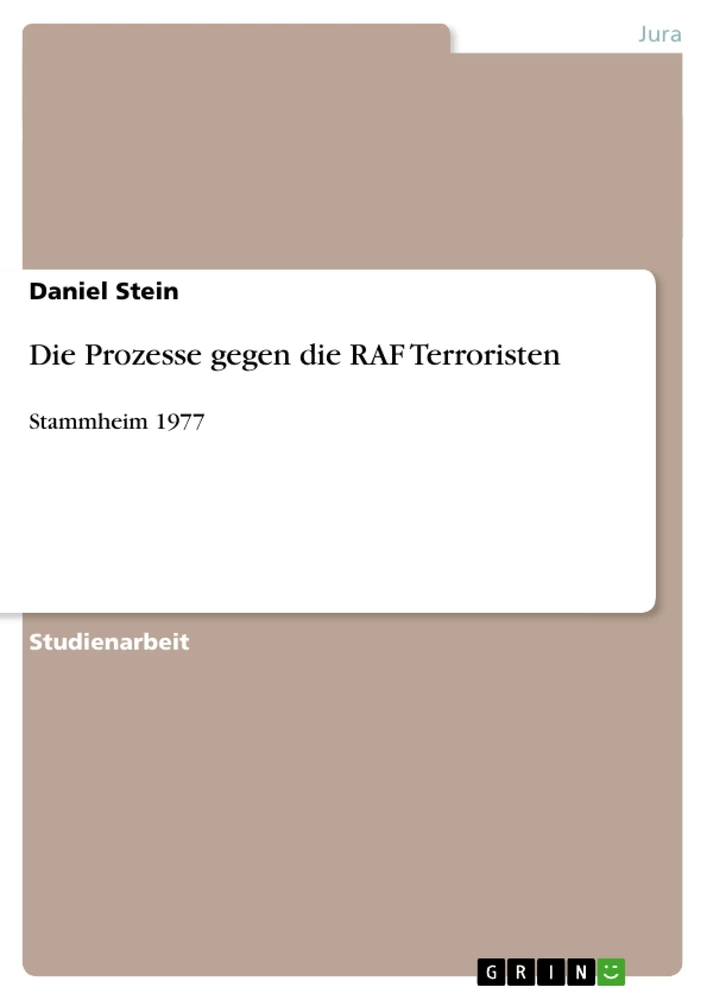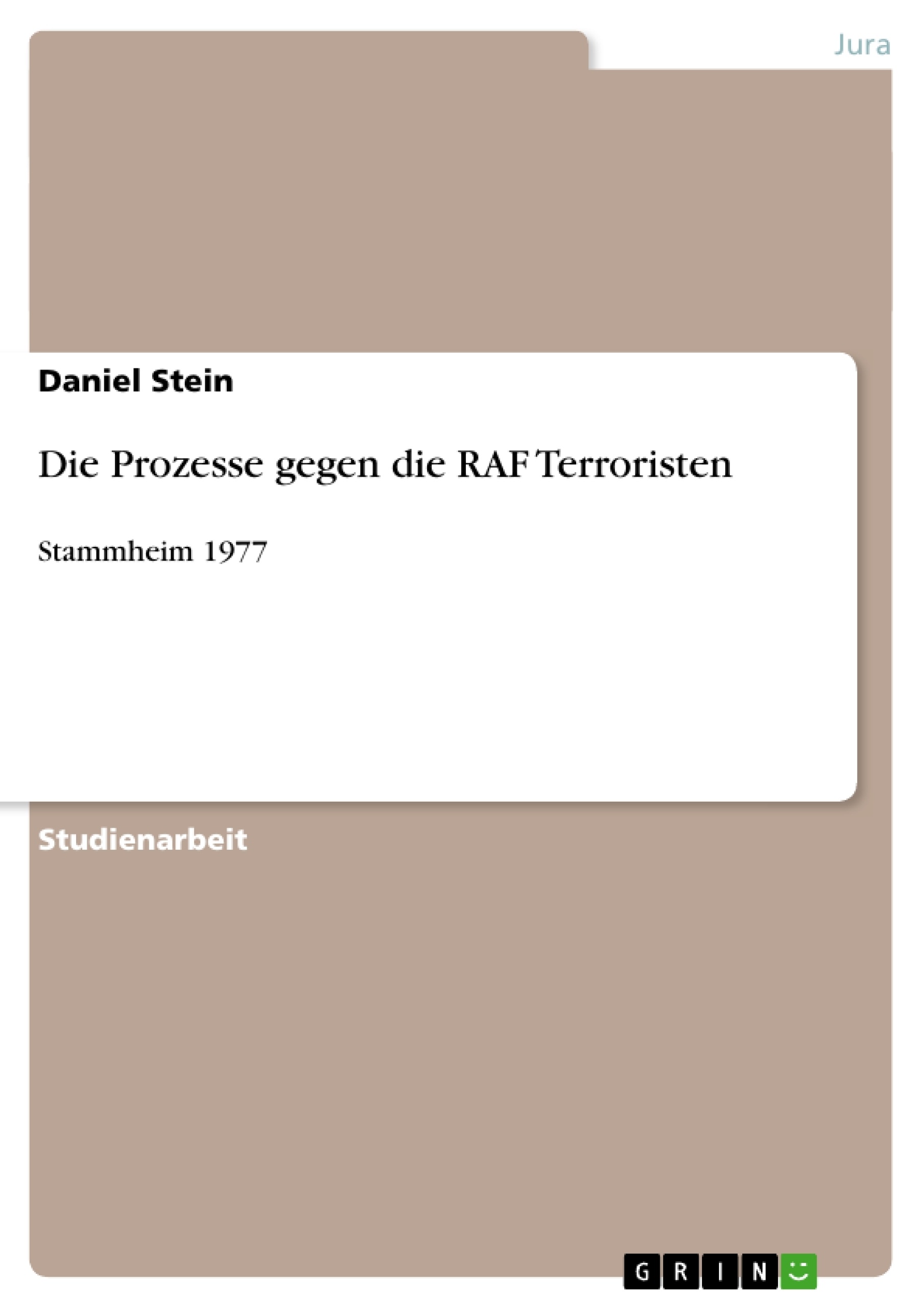Während der juristischen Aufarbeitung des „Deutschen Herbst“ anlässlich dieser Arbeit bin ich zur für mich erstaunlichen Einsicht gekommen, dass die vorhandene Literatur zu einem sehr grossen Teil in irgendeiner politischen Couleur „eingefärbt“ ist. Eine objektive Betrachtung des Prozesses und damit eine gänzlich nüchterne Beurteilung bzw. Aufarbeitung der damaligen Ereignisse scheint auch mehr als 30 Jahre später schwierig zu sein. Diesen Anspruch muss die vorliegende Arbeit m.E. aber auch nicht per se erfüllen. Die Deutsche Justiz sah sich in den Jahren 1974 bis 1977 mit Fragen konfrontiert, die sie nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wohl bereits im Fundus der Geschichte entsorgt hatte. Das Studium der vorhandenen Literatur hat für mich gezeigt, dass i.c. Staat und Justiz wohl bisweilen selber überfordert gewesen sind und die Personen der RAF mit jenen Waffen geschlagen hat, die die nämlichen selber in den Kampf mitbrachten: Mit brachialer und teils unmenschlicher Gewalt. Ganz offensichtlich wurden in den Prozessen gegen die beschuldigten Mitglieder und Mitläufer der RAF andere Regeln angewendet, als in konventionellen Gerichtsverfahren .
Die bisher klare und unverrückbare Gewaltentrennung zwischen Politik und Justiz wurde durchlässig und der Staat bediente sich seines einflussreichsten Instruments zur Bekämpfung des RAF Terrorismus; der Polizei. Interessant ist, dass sich die vorliegende Literatur praktisch durchwegs (zumindest implizit) kritisch zur Einmischung der Politik äussert. Neben der immer fliessender werdenden Grenze zwischen Justiz und Politik ist auch festzustellen, dass RAF Mitglieder sehr oft im bereits im Vorfeld des Prozesses öffentlich vorverurteilt wurden. Die Frage, ob die Justiz dem Druck der Politik überhaupt standhalten mochte ist m.E. sehr berechtigt und lässt zumindest Zweifel aufkommen, dass ein objektiv fairer Prozess überhaupt möglich gewesen ist. Immer wieder finden sich in der Literatur (zynische) Hinweise, die eine Ähnlichkeit zwischen den RAF Prozessen und denjenigen vor den nationalsozialistischen Volksgerichten herleiten wollen. Es ist keine Frage, dass dieser Vergleich an den Haaren herbeigezogen ist und doch entsteht manchmal der fahle Nachgeschmack, dass die Deutsche Öffentlichkeit sich sehr schwer getan hat im Umgang mit den Exponenten der RAF bzw. mit dem Prozess gegen nämliche.
Inhaltsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Deutsche Staat und die RAF
- 1. Terrorismus versus Alltagskriminalität
- 2. Im Vorfeld des Stammheimer Prozesses
- III. Der Prozess
- 1. Zuständigkeit und Tatbestand
- 2. Verteidigerausschuss - § 138a - d StPO
- 3. Einschränkung der Anzahl Wahlverteidiger auf maximal drei - § 137 StPO
- 4. Verbot der Mehrfachverteidigung - § 146 StPO
- 5. Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten - § 231a StPO
- IV. Epilog und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Prozess gegen die RAF-Terroristen in Stammheim 1977. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Besonderheiten des Verfahrens, insbesondere im Hinblick auf die Verteidigung der Angeklagten. Die Arbeit untersucht die Rolle des Staates im Kampf gegen den Terrorismus und die Herausforderungen, die sich aus der Konfrontation mit einer extremistischen Gruppierung wie der RAF ergeben.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Stammheimer Prozesses
- Die Rolle der Verteidigung im Prozess
- Der Umgang des Staates mit dem Terrorismus
- Die Herausforderungen der Strafverfolgung im Kontext von Extremismus
- Die Bedeutung des Stammheimer Prozesses für die deutsche Rechtsgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Stammheimer Prozesses ein und skizziert die historische und politische Bedeutung des Verfahrens. Sie beleuchtet die Entstehung der RAF und ihre Ziele sowie die Reaktion des Staates auf den Terrorismus. Das zweite Kapitel analysiert die Beziehung zwischen dem deutschen Staat und der RAF. Es untersucht die unterschiedlichen Strategien des Staates im Kampf gegen den Terrorismus und die Herausforderungen, die sich aus der Konfrontation mit einer extremistischen Gruppierung ergeben. Das dritte Kapitel widmet sich dem Stammheimer Prozess selbst. Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Verfahrens, die Rolle der Verteidigung und die Besonderheiten des Prozesses. Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung des Stammheimer Prozesses für die deutsche Rechtsgeschichte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Stammheimer Prozess, die Rote Armee Fraktion (RAF), Terrorismus, Strafprozessrecht, Verteidigung, Rechtsstaatlichkeit, Staat und Terrorismus, Extremismus, deutsche Rechtsgeschichte.
- Quote paper
- Daniel Stein (Author), 2008, Die Prozesse gegen die RAF Terroristen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113351