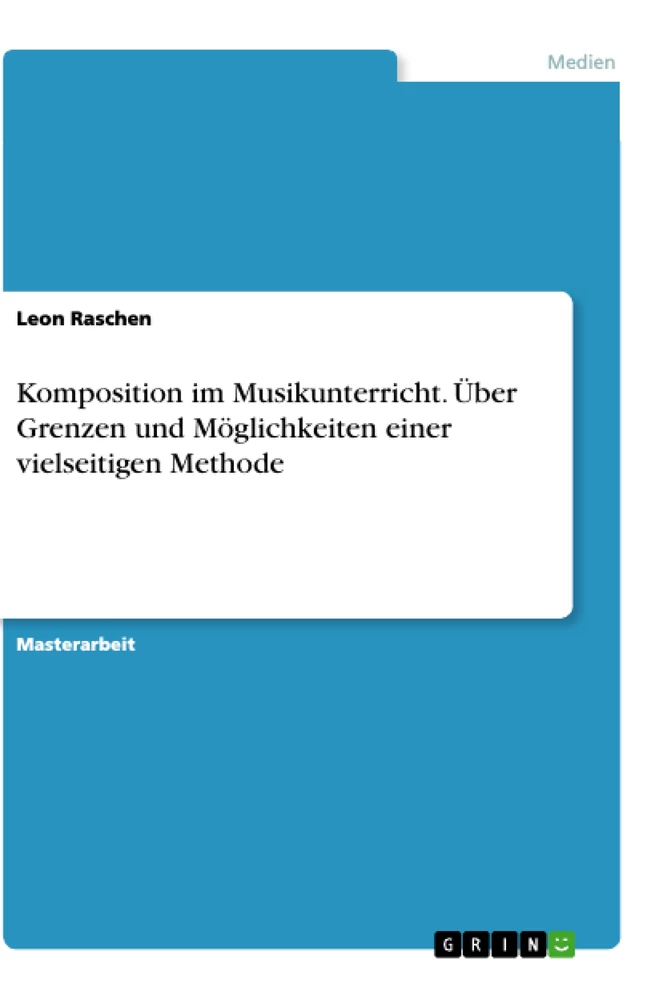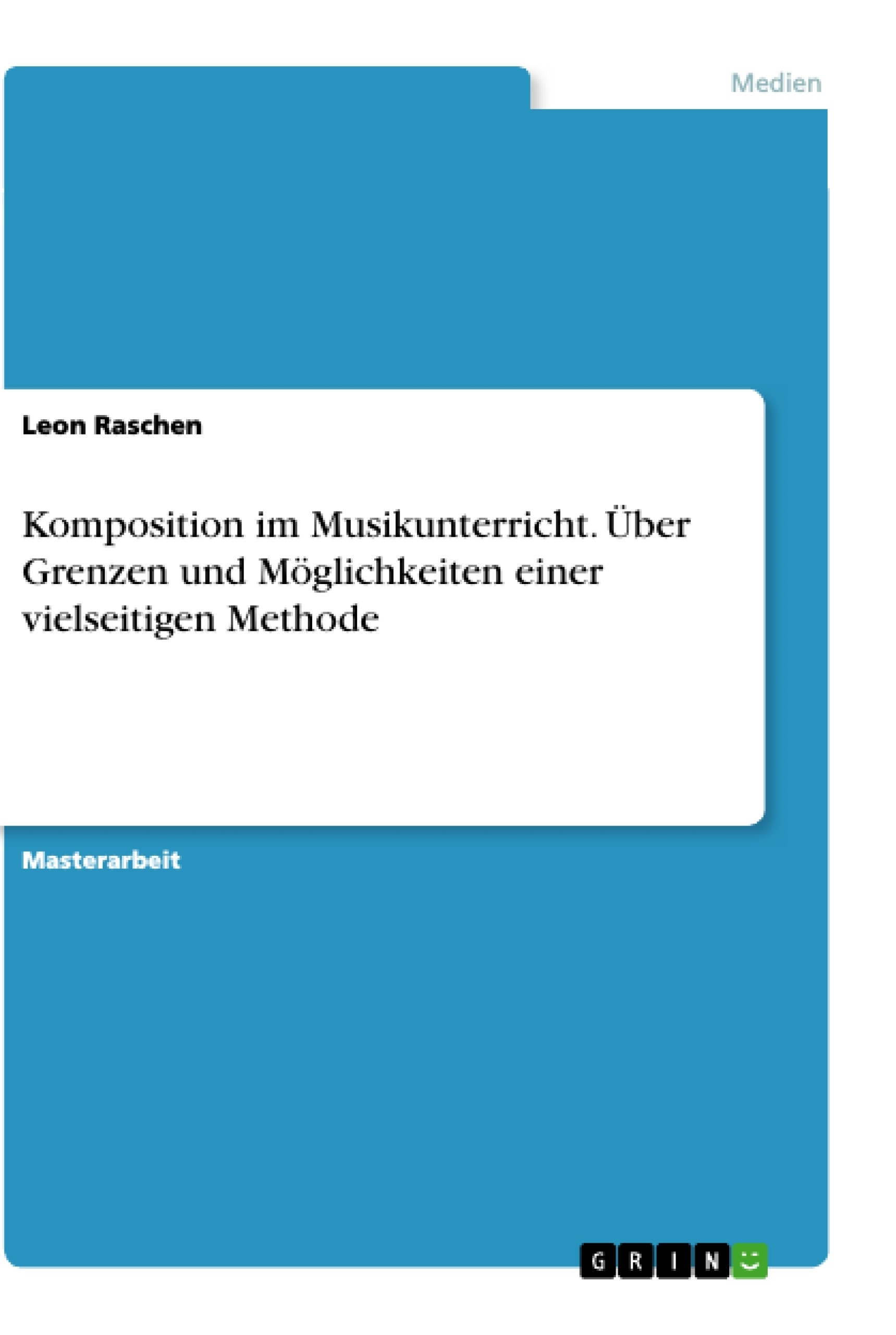Diese Arbeit beschäftigt sich damit, welche spezifischen Gründe als Argumentation für eine Nichtnutzung von Komposition im Musikunterricht verwendet werden. Gleichzeitig wird untersucht, wie schlüssig diese Begründungen ausfallen und ob sie ggf. durch fundierte Gegenargumente entkräftet werden können. Grundlegend dazu werden Thesen aufgestellt, die das Potential von Komposition thematisieren und Grundlage für die Forderung bilden, dass Komposition im Musikunterricht vermehrt genutzt werden sollte:
These 1: Das Komponieren im Musikunterricht bietet sich als vielseitige Methode an, Musiktheorie und -praxis verstehend zu verbinden.
These 2: Durch Komposition kann zeitgleich die Entwicklung mehrerer Zielkompetenzen erreicht bzw. gefördert werden.
These 3: Schüler erhalten durch das eigenständige Komponieren ein vertiefendes Verständnis vieler vom Kerncurriculum geforderten Themen wie Instrumentenkunde, Formen- und Harmonielehre, Notation und eigenverantwortliches Anleiten.
Studien bestätigen, dass produktive Umgangsweisen im Musikunterricht einen geringen Stellenwert aufweisen. Dieser sei sogar so gering, dass er als Rückseite jener Medaille bezeichnet werden könne, „auf deren allermeist thematisierter Vorderseite der rezeptive und reproduktive Zugang und Umgang mit Musik geprägt ist.“
Es stellt sich die Frage, ob die Nutzung produktiver Umgangsweisen bzw. von Produktionsprozessen wie Komposition nicht stattfindet, weil es sich nicht für den Musikunterricht anbietet oder ob es tatsächlich andere Gründe hat, dass Komposition als „blinder Fleck“ der schulischen Musikbegegnung gesehen wird. Dass Musikunterricht vielerorts ohne produktive Umgangsweisen durchgeführt wird, verwundert deswegen nicht nur, sondern muss kritisiert werden, denn es stehen musikpädagogische Konzeptionen elementaren Komponierens mit geringen Voraussetzungen zur Verfügung, die das Potential inne haben, individuelle Kreativität ausleben zu lassen. Hinzu kommt, dass Komposition ein vielseitiges Handlungsfeld darstellt, das Wahrnehmungsfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und das Reflexionsvermögen gleichermaßen und simultan anspricht bzw. fördern kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1 – Überblick/Theoretische Rahmung
- 1.1 Kreativität/Kreative Prozesse
- 1.2 Komposition – ein Definitionsversuch
- 1.3 Improvisation – ein Abgrenzungsversuch
- 1.4 Ästhetische Erfahrung im Rahmen der Prozess-Produkt-Didaktik
- 1.5 Erstes Zwischenfazit
- Teil 2 – Komposition im Musikunterricht
- 2.1 Überblick über den Forschungsstand
- 2.2 Effekte von Komposition auf die Kompetenzentwicklung
- 2.3 Lernziele und zu erwerbende Kompetenzen
- 2.4 Chancen und Grenzen aus Sicht der Literatur
- 2.4.1 Grenzen
- 2.4.2 Chancen
- 2.5 Zweites Zwischenfazit
- Teil 3 – Analyse des niedersächsischen Kerncurriculums
- 3.1 „Gestalten“
- 3.2 Die Arbeitsfelder
- 3.3 Bewertungen und Operatoren
- 3.4 Drittes Zwischenfazit
- Teil 4 – Komposition als Verbindung von Musiktheorie und -praxis
- 4.1 Exkurs: Die Arbeitsprinzipien von Komposition
- 4.2 Thesenvorstellung
- 4.3 Methodische Aspekte von Komposition
- 4.3.1 Notation
- 4.3.2 Modell 1: Live Arrangement
- 4.3.3 Modell 2: Neue Musik als Weg zur Komposition
- 4.3.4 Modell 3: Begegnung mit Komponisten im Rahmen von Projekten
- 4.4 Viertes Zwischenfazit
- Teil 5 – Experteninterviews mit Lehrkräften
- 5.1 Zur Anlage der Interviews
- 5.2 Methodik
- 5.2.1 Erhebungsdaten: Experteninterviews
- 5.2.2 Übertragung der Forschungsfrage in Interviewfragen (Operationalisierung)
- 5.2.3 Auswahl der Experten
- 5.2.4 Beschreibung der Durchführung der Interviews
- 5.2.5 Transkriptionsregeln
- 5.3 Erläuterungen zum Auswertungsverfahren
- 5.3.1 Deduktive Kategorienbildung
- 5.3.2 Zur Kodierung der Transkripte
- 5.4 Analyse und Ergebnisse
- 5.4.1 Rahmenrichtlinien von Komposition durch das Kerncurriculum
- 5.4.2 Nutzung von Komposition im eigenen Musikunterricht in Bezug zur Häufigkeit und Methodenwahl
- 5.4.3 Verbindung von Musiktheorie und -praxis
- 5.4.4 Stellenwert von und die Ansichten über Komposition in der Schule
- 5.4.5 Chancen und Grenzen von Komposition
- 5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse hinsichtlich der Fragestellung
- 5.6 Abgleich der Ergebnisse der Literaturanalyse mit den Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Rolle der Komposition im Musikunterricht. Ziel ist es, die Chancen und Grenzen dieser vielseitigen Methode zu ergründen und Argumente für eine verstärkte Integration von Komposition in den Unterricht zu liefern. Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand, das niedersächsische Kerncurriculum und die praktischen Erfahrungen von Musiklehrkräften.
- Definition und Abgrenzung von Komposition und Improvisation
- Komposition als Methode zur Verbindung von Musiktheorie und -praxis
- Kompetenzentwicklung durch Komposition
- Analyse des niedersächsischen Kerncurriculums bezüglich Komposition
- Praktische Erfahrungen von Musiklehrkräften mit Komposition im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beginnt mit einer persönlichen Erfahrung des Autors, die den geringen Stellenwert produktiver Umgangsweisen mit Musik im Musikunterricht aufzeigt. Diese Beobachtung wird durch Studien bestätigt, die den überwiegend rezeptiven und reproduktiven Zugang zur Musik kritisieren. Die Arbeit untersucht die Gründe für die Nichtnutzung von Komposition und formuliert Thesen zu deren Potential im Musikunterricht.
Teil 1 – Überblick/Theoretische Rahmung: Dieser Teil definiert und differenziert die zentralen Begriffe der Arbeit: Kreativität, Komposition und Improvisation. Er untersucht den Prozess-Produkt-Ansatz der Produktionsdidaktik im Kontext ästhetischer Erfahrung und fasst die Ergebnisse in einem Schaubild zusammen.
Teil 2 – Komposition im Musikunterricht: Dieser Teil beleuchtet den Forschungsstand zur Komposition im Musikunterricht, analysiert deren Effekte auf die Kompetenzentwicklung und erörtert Lernziele, Chancen und Grenzen aus der Literatur. Der Mangel an Forschung im deutschsprachigen Raum und der höhere Stellenwert von Komposition im englischen Sprachraum werden hervorgehoben.
Teil 3 – Analyse des niedersächsischen Kerncurriculums: Dieser Abschnitt analysiert das niedersächsische Kerncurriculum Musik auf die Verwendung von Komposition und verwandten Begriffen. Er untersucht die Arbeitsfelder, Bewertungskriterien und Operatoren und zeigt Unschärfen und Widersprüche in der Formulierung und Einordnung von Komposition auf.
Teil 4 – Komposition als Verbindung von Musiktheorie und -praxis: Dieser Teil erörtert die in der Einleitung formulierten Thesen anhand der bisherigen Ergebnisse. Er stellt gängige Arbeitsprinzipien von Komposition vor und analysiert methodische Aspekte, insbesondere die Rolle der Notation und verschiedene Modelle für den Kompositionsunterricht (Live Arrangement, Neue Musik, Projekte mit Komponisten).
Teil 5 – Experteninterviews mit Lehrkräften: Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse von zwei Experteninterviews mit Musiklehrkräften. Die Methodik der Interviews wird erläutert und die Ergebnisse werden in Bezug auf die Forschungsfrage und die vorherigen Kapitel analysiert. Die Analyse beleuchtet die Einstellungen der Lehrkräfte zu Komposition, deren Chancen und Grenzen, den Stellenwert im Unterricht und die Orientierung am Kerncurriculum.
Schlüsselwörter
Komposition, Improvisation, Musikunterricht, Kerncurriculum, Musiktheorie, Musikpraxis, Kompetenzentwicklung, Ästhetische Erfahrung, Produktionsdidaktik, Kreativität, Experteninterviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Notation, Digitale Medien, Neue Musik, Projektlernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Komposition im Musikunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Rolle der Komposition im Musikunterricht. Sie analysiert die Chancen und Grenzen der Komposition als Methode und liefert Argumente für deren verstärkte Integration in den Unterricht. Die Arbeit betrachtet den Forschungsstand, das niedersächsische Kerncurriculum und die Praxiserfahrungen von Lehrkräften.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Komposition und Improvisation; Komposition als Verbindung von Musiktheorie und -praxis; Kompetenzentwicklung durch Komposition; Analyse des niedersächsischen Kerncurriculums bezüglich Komposition; Praktische Erfahrungen von Musiklehrkräften mit Komposition im Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Einleitung, theoretische Rahmung (inkl. Definitionen von Kreativität, Komposition und Improvisation und des Prozess-Produkt-Ansatzes), Komposition im Musikunterricht (Forschungsstand, Kompetenzentwicklung, Chancen und Grenzen), Analyse des niedersächsischen Kerncurriculums (Arbeitsfelder, Bewertungskriterien, Operatoren), und Experteninterviews mit Musiklehrkräften (Methodik, Ergebnisse, Analyse).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit nutzt eine Literaturanalyse, um den Forschungsstand zu Komposition im Musikunterricht zu erfassen und das niedersächsische Kerncurriculum zu analysieren. Zusätzlich werden qualitative Experteninterviews mit Musiklehrkräften durchgeführt und mittels deduktiver Kategorienbildung ausgewertet.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit identifiziert Chancen und Grenzen der Komposition im Musikunterricht, analysiert Unschärfen im niedersächsischen Kerncurriculum bezüglich Komposition und zeigt die Praxiserfahrungen von Musiklehrkräften auf. Die Ergebnisse der Literaturanalyse werden mit den Ergebnissen der Experteninterviews abgeglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Komposition, Improvisation, Musikunterricht, Kerncurriculum, Musiktheorie, Musikpraxis, Kompetenzentwicklung, Ästhetische Erfahrung, Produktionsdidaktik, Kreativität, Experteninterviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Notation, Digitale Medien, Neue Musik, Projektlernen.
Welche konkreten methodischen Ansätze zur Komposition im Unterricht werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene methodische Ansätze, darunter Live Arrangement, die Einbindung Neuer Musik und die Zusammenarbeit mit Komponisten in Projekten.
Wie wird die Verbindung von Musiktheorie und -praxis im Kontext von Komposition dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Komposition als Methode die Verbindung von Musiktheorie und -praxis im Musikunterricht fördern kann und beleuchtet dies anhand der Ergebnisse der Literaturanalyse und der Experteninterviews.
Welche Rolle spielt das niedersächsische Kerncurriculum in der Arbeit?
Das niedersächsische Kerncurriculum wird hinsichtlich seiner Vorgaben und Formulierungen zur Komposition analysiert. Die Arbeit zeigt Unschärfen und Widersprüche in der Einordnung von Komposition im Curriculum auf.
- Quote paper
- Leon Raschen (Author), 2019, Komposition im Musikunterricht. Über Grenzen und Möglichkeiten einer vielseitigen Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1133113