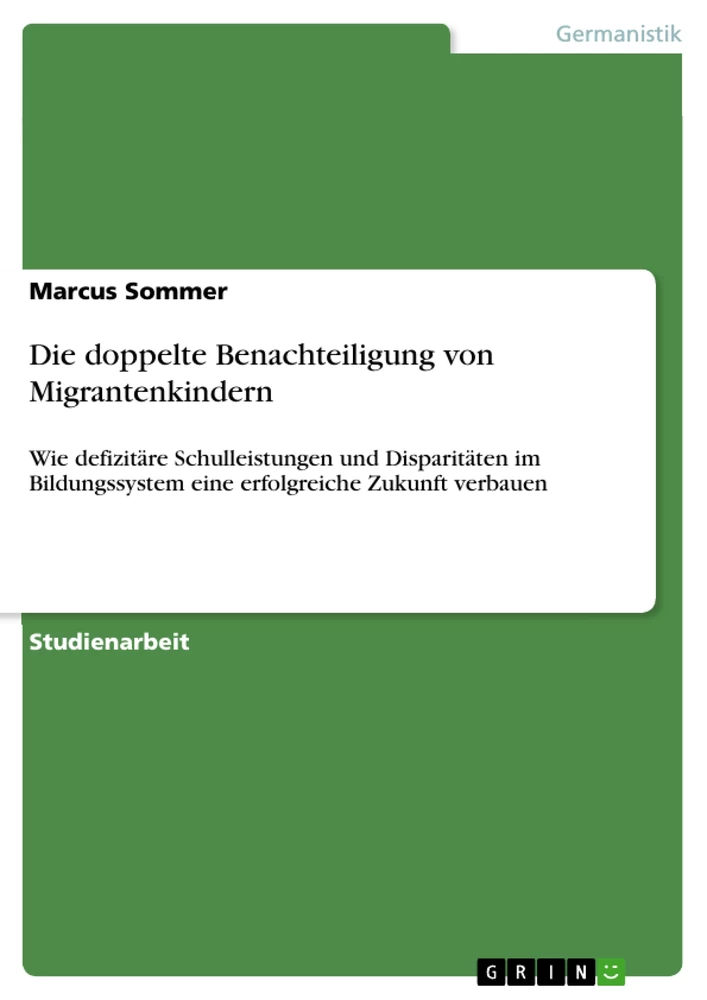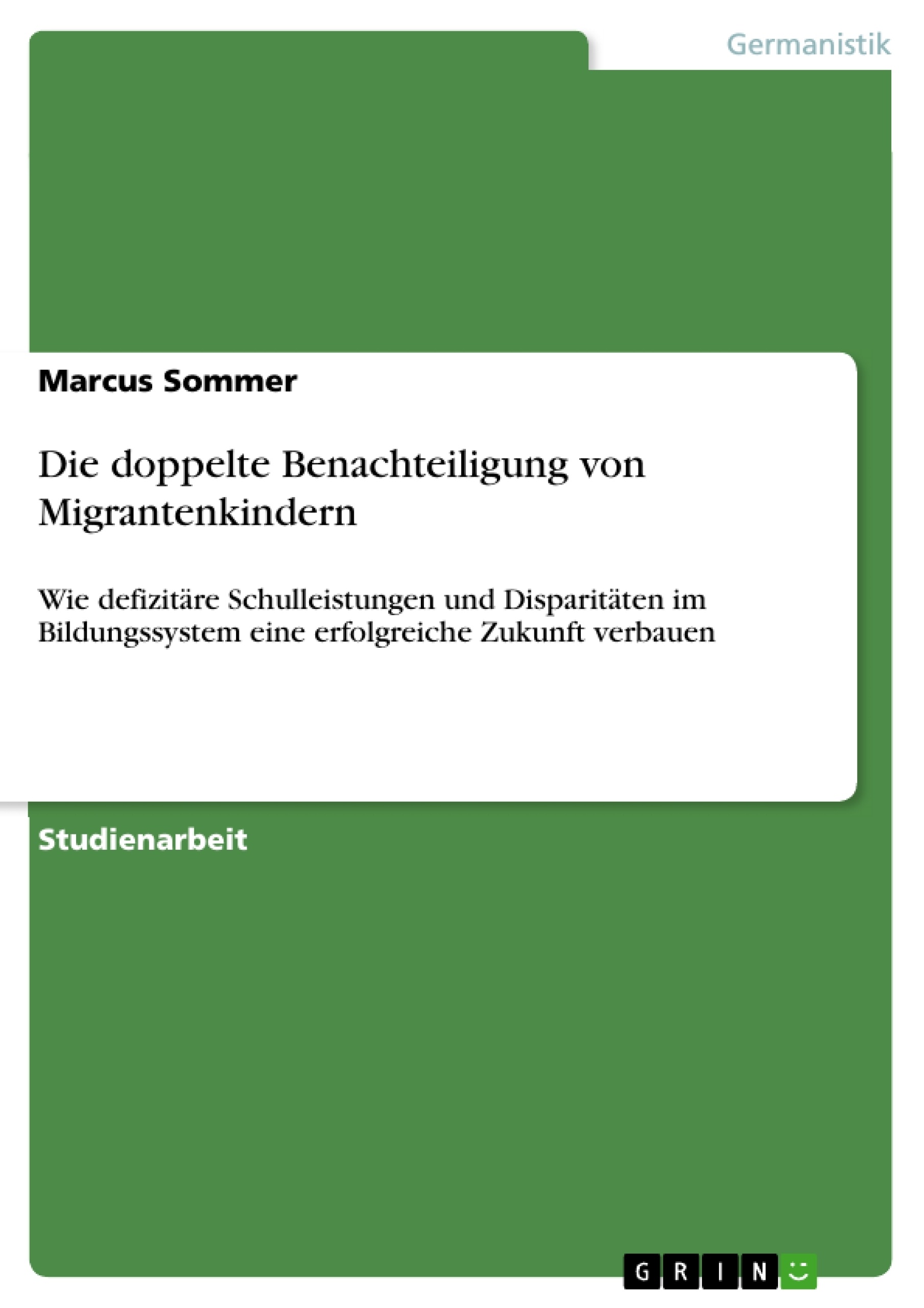Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich Sorgen. Über das deutsche Bildungssystem und insbesondere um die Migrantenkinder, welche genau dieses Schulsystem so miserabel fördert. Die Abhängigkeit von sozialer Herkunft und Bildungserfolg sei in Deutschland zu hoch, bemängelte sie bei einer Konferenz zu Integration und Bildung im Herbst 2007. Sie fordert ein, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben müssten. Merkel warnt: „Wir können auf kein einziges Talent verzichten!“ (Focus 2007).
Derzeit wird allerdings genau das getan.
Auf etliche Talente wird verzichtet, wenn laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung bundesweit im Schnitt 19,4 % der ausländischen Jugendlichen die Schule abbrechen und keinen Schulabschluss erreichen. Am deutlichsten sind die Alarmzeichen in den deutschen Großstädten: In Berlin scheiterten 2002 laut GEW-Berechnungen 32% an ihrem Hauptschulabschluss (Weil 2002, S. 15).
Seit der ersten PISA-Studie (Programme for International Student Assessement) wissen wir, dass im deutschen Bildungssystem einige Schieflagen existieren. Denn auf etliche „Talente“ wird auch verzichtet, wenn der aktuellen Schulleistungsstudie der OECD zufolge „knapp die Hälfte der Ausländerkinder […] nicht einmal in Mathematik die Basis-Aufgaben“ schaffen und „fünfzig Prozent der Zugewanderten […] im Lesen die elementare Kompetenzstufe 1 nicht erreichten“ (Kippel 2006, S. 32).
Die Sprach- und Lesekompetenz sind für das Bildungsschicksal der zentrale „Knackpunkt“ (Brizic 2008, S. 5). Und die Ergebnisse, die die Internationale Grundschul-Leseuntersuchung (IGLU ) diesbezüglich vermeldet, sind dramatisch. Demnach hätten Schüler mit Migrationshintergrund gegenüber Schülern ohne Migrationshintergrund einen Leistungsrückstand auf der Leseskala von 48 Punkten (Schwippert 2007, S.266) – statistisch betrachtet, bedeutet dies einen Unterschied von einer halben Standardabweichung; für die Jugendlichen geht damit ein erheblicher Verlust an Lebensqualität und gesellschaftlicher wie ökonomischer Teilhabe verloren. Die empirischen Untersuchungen sind brisant. Immer häufiger stellt sich derzeit die Frage, wie gut Migrantenkinder in der deutschen Schule integriert sind? Inwieweit unterscheiden sich die Schulleistungen (insbesondere die Lese- und sprachlichen Leistungen) von Schülern mit Migrationshintergrund von einheimischen deutschen Schülern? Und, gibt es demzufolge eine Chancenungerechtigkeit zwischen beiden Gruppen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung: Deutsche, Ausländer, Migrationshintergrund...
- Operationalisierung der Begrifflichkeiten
- Migrantenkinder im deutschen Bildungssystem
- Empirische Ergebnisse zur Sprach- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund am Beispiel von IGLU 2006 und PISA 2006
- Methodischer und inhaltlicher Exkurs
- Lesekompetenzen von Schülern mit Migrationshintergrund im Vergleich
- Ergebnisse bei PISA 2006
- Ergebnisse bei IGLU 2006
- Die Folgen der defizitären Sprachbeherrschung: Ergebnisse für andere Teilbereiche
- Verteilung von Schülern im deutschen Schulsystem
- Migranten auf dem Abstellgleis: Eine (kurze) Analyse der Bildungschancen von Migrantenkindern
- Unterschiedliche Bildungsabschlüsse
- Chancenungerechtigkeit nach der Grundschule
- Ursachen für die großen Leistungsunterschiede zwischen Migrantenkindern und Deutschen
- Erklärungsansätze auf der individuellen Ebene
- Erklärungsansätze auf der institutionellen Ebene
- Synthese
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der doppelten Benachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die defizitären Schulleistungen, insbesondere im Bereich der Sprach- und Lesekompetenz, und untersucht, wie diese Disparitäten zu einer ungleichen Verteilung von Bildungschancen führen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen für diese Benachteiligung zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Defizitäre Sprach- und Lesekompetenz von Migrantenkindern
- Disparitäten im Bildungssystem und ungleiche Bildungschancen
- Einfluss des Migrationshintergrunds auf Schulerfolg und Berufsleben
- Analyse von empirischen Daten aus PISA und IGLU Studien
- Theoretische Erklärungsansätze für die Benachteiligung von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Benachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem dar und führt in die Thematik der Hausarbeit ein. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe „Deutsche“, „Ausländer“ und „Migrationshintergrund“ definiert und operationalisiert. Dabei wird die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Migrantenkindern erster und zweiter Ordnung hervorgehoben. Das dritte Kapitel analysiert die empirischen Ergebnisse von IGLU und PISA Studien, die einen deutlichen Leistungsrückstand von Schülern mit Migrationshintergrund in Bezug auf Sprach- und Lesekompetenz aufzeigen. Das vierte Kapitel untersucht die Verteilung von Schülern im deutschen Schulsystem und analysiert die Bildungschancen von Migrantenkindern. Dabei wird deutlich, dass Migrantenkindern im Vergleich zu deutschen Schülern deutlich schlechtere Bildungschancen haben. Das fünfte Kapitel beleuchtet die Ursachen für die großen Leistungsunterschiede zwischen Migrantenkindern und Deutschen. Es werden sowohl individuelle als auch institutionelle Erklärungsansätze diskutiert. Die Synthese fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf mögliche Lösungsansätze.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die doppelte Benachteiligung von Migrantenkindern, defizitäre Schulleistungen, Sprach- und Lesekompetenz, Disparitäten im Bildungssystem, Bildungschancen, Migrationshintergrund, PISA und IGLU Studien, Integration und Inklusion.
- Citation du texte
- Marcus Sommer (Auteur), 2008, Die doppelte Benachteiligung von Migrantenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113176