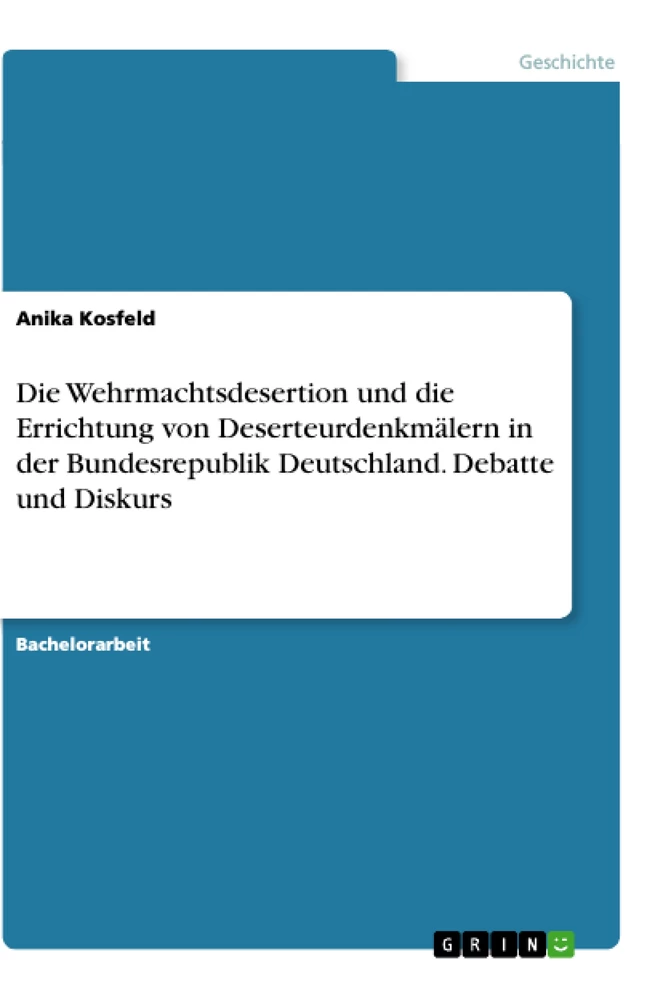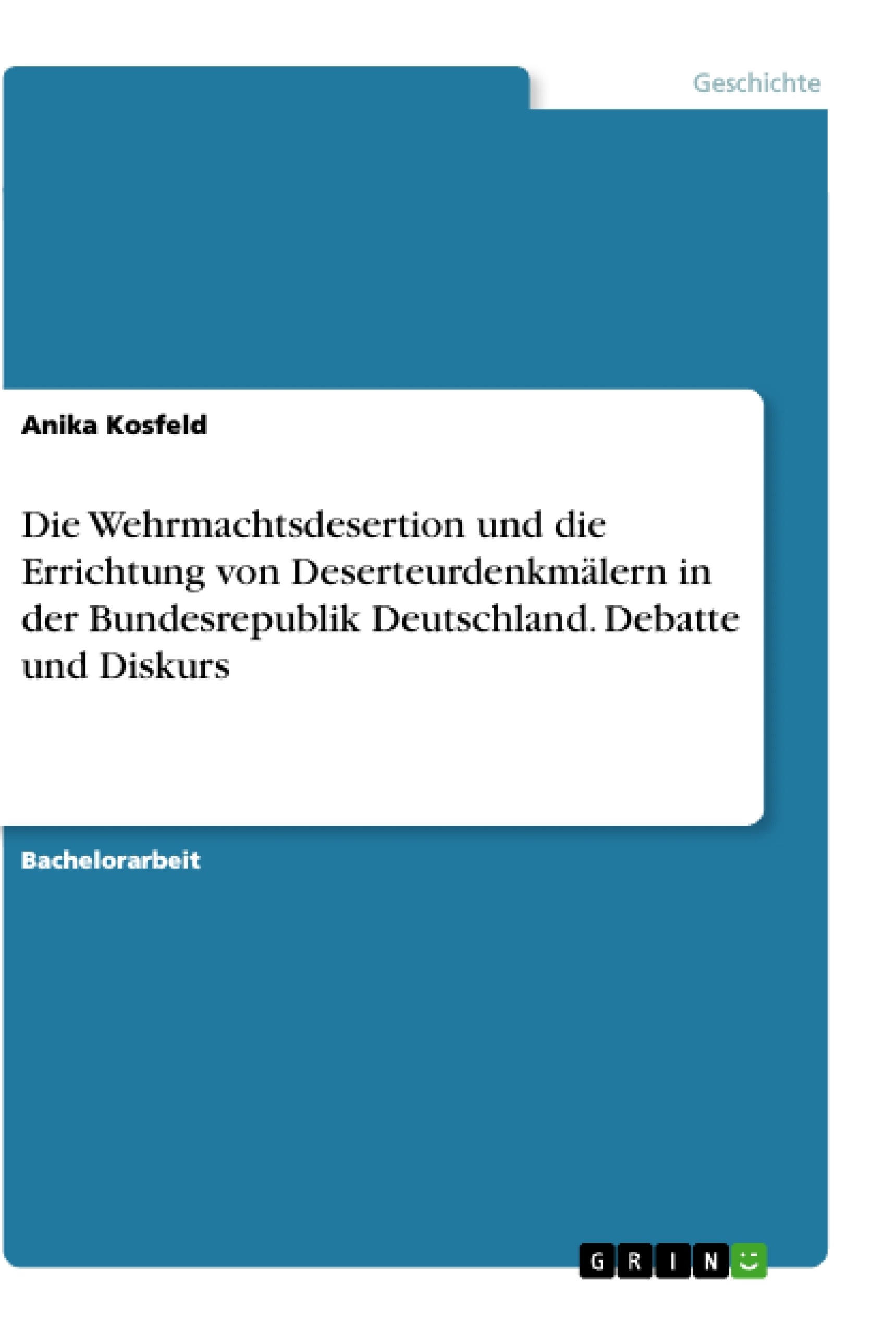Thema dieser Arbeit ist der Diskurs, der die Errichtung von Deserteurdenkmälern begleitete. Dabei stehen die Fragen im Zentrum, wie Deserteure in den 1980er-Jahren „denkmalswürdig“ wurden, nachdem ihnen Entschädigung und öffentliche Anerkennung in der Nachkriegsgesellschaft verwehrt blieben. Außerdem wird thematisiert, welcher Wandel hinsichtlich Initiatoren und Ausrichtung der Projekte bis heute zu beobachten sind, welche Positionen die Akteure einnehmen und wie übergeordnete Bezüge zur Erinnerungskultur, Vergangenheitspolitik und zeithistorischer Gegenwartskritik in die Debatten hineinwirken.
Zur Beantwortung dieser Fragestellungen sollen als Quellen Projektdokumentationen, Zeitungsartikel, Leserbriefe, Flugschriften, Redetexte sowie Senats- und Parlamentsprotokolle herangezogen werden, die einen Einblick in den Verlauf der Auseinandersetzung ermöglichen. Die methodische Grundlage der Arbeit bildet die historische Diskursanalyse.
Deserteurdenkmäler sind im engeren historischen Kontext Ausdruck des gesellschaftlichen Prozesses um Anerkennung der Wehrmachtsdeserteure als Opfer der NS-Militärjustiz. In diesem Sinne ist ihre Entstehung eingebunden in die Differenzierung der NS-Gedenkkultur um sogenannte „vergessene“ Opfergruppen seit den 1980er-Jahren.
Eine erste Sichtung des Materials zeigt, dass diese doppelte Lesbarkeit der Denkmäler – als Teil der NS-Erinnerungskultur und als „Gegendenkmale“ mit friedenspolitischer Botschaft – den Diskurs bis heute bestimmt. Mit den Erinnerungszeichen wurde eine über den eigentlichen historischen Kontext hinausgehende Diskussion über die Stellung des Militärs in der Gesellschaft, des Wertes von sogenannten militärischen Tugenden, des Verhältnisses von Staat und Bürger und persönlicher Widerstandsrechte angeregt.
Während Desertion aus der Wehrmacht in den ersten drei Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland ein tabuisiertes Thema blieb, erfolgte Anfang der 1980er-Jahre ein Bruch mit dieser Erinnerungstradition, als Teile der Friedensbewegung Denkmäler für Wehrmachtsdeserteure forderten. Um ihre Errichtung wurden teils erbitterte geschichtskulturelle und politische Kontroversen geführt. Deserteurdenkmäler sind Ausdruck des Prozesses um Anerkennung der Wehrmachtsdeserteure als Opfer der NS-Militärjustiz. Thema dieser Arbeit ist der Diskurs, der die Errichtung von Deserteurdenkmälern begleitete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wehrmachtsdesertion: Zum Wandel des gesellschaftlichen Meinungsbildes
- NS-Zeit: Desertion als Verrat an der „Volksgemeinschaft“
- Ausgrenzung und Marginalisierung 1945 bis 1980
- Enttabuisierung und sukzessive Rehabilitierung seit 1980.
- Deserteurdenkmäler in Deutschland
- Frühe Gedenkzeichen für Deserteure in der Nachkriegszeit
- Friedensbewegung und Differenzierung der Gedenkkultur: Neue Impulse in den 1980er-Jahren
- Zur Chronologie und Periodisierung der Deserteurdenkmäler
- Die frühen Denkmalsprojekte: 1986 bis Anfang der 1990er-Jahre.
- Denkmalsetzungen zwischen den 1990er-Jahren und 2002.
- Jüngere Denkmalsprojekte nach der politischen Rehabilitierung 2002.
- Die Kontroversen zu Denkmälern für Wehrmachtsdeserteure
- Verrat oder Widerstandstat? Der Streit um die historische Bewertung der Legitimität von Desertion aus der Wehrmacht
- Sterben oder desertieren für den Frieden? Gegenwartsbezüge und friedenspolitische Implikationen
- Erinnerungszeichen für Deserteure als „Gegendenkmäler“ zu traditionellen Gedenkformen und politischem Totenkult
- Desertion, Zivilcourage und Whistleblowing: Aktuelle Bezüge im Diskurs.
- Resümee und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Diskurs, der die Errichtung von Deserteurdenkmälern in der Bundesrepublik Deutschland begleitete. Ziel ist es, die Entwicklung des gesellschaftlichen Meinungsbildes zur Wehrmachtsdesertion in den 1980er-Jahren zu beleuchten, insbesondere die Frage, wie Deserteure „denkmalswürdig“ wurden, nachdem ihnen Entschädigung und öffentliche Anerkennung in der Nachkriegsgesellschaft verwehrt blieben.
- Der Wandel des gesellschaftlichen Meinungsbildes zur Wehrmachtsdesertion
- Die Entstehung und Entwicklung von Deserteurdenkmälern in Deutschland
- Die Kontroversen um die historische Bewertung von Desertion und die Rehabilitierung von Deserteuren
- Die Rolle von Deserteurdenkmälern in der Erinnerungskultur und die Verbindung zur Gegenwartskritik
- Der Diskurs über Deserteurdenkmäler im Kontext von friedenspolitischen Implikationen und gesellschaftlichen Werten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und skizziert den historischen Kontext der Arbeit. Kapitel 2 analysiert den Wandel des gesellschaftlichen Meinungsbildes zur Wehrmachtsdesertion von der NS-Zeit über die Nachkriegszeit bis zur Rehabilitierung von Deserteuren in den 1980er-Jahren. Kapitel 3 widmet sich der Entstehung von Deserteurdenkmälern in Deutschland und deren Periodisierung in verschiedene Phasen. Kapitel 4 beleuchtet die Kontroversen um die historischen Bewertungen von Desertion und die politischen Implikationen der Deserteurdenkmäler.
Schlüsselwörter
Wehrmachtsdesertion, Deserteurdenkmäler, NS-Gedenkkultur, Erinnerungskultur, Geschichtsdebatte, Friedensethik, Zivilcourage, Whistleblowing, Gegenwartskritik, Politischer Totenkult, NS-Militärjustiz, Rehabilitierung, Denkmalsprojekte, Kontroversen, Gedenklandschaft.
- Citar trabajo
- Anika Kosfeld (Autor), 2017, Die Wehrmachtsdesertion und die Errichtung von Deserteurdenkmälern in der Bundesrepublik Deutschland. Debatte und Diskurs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131405