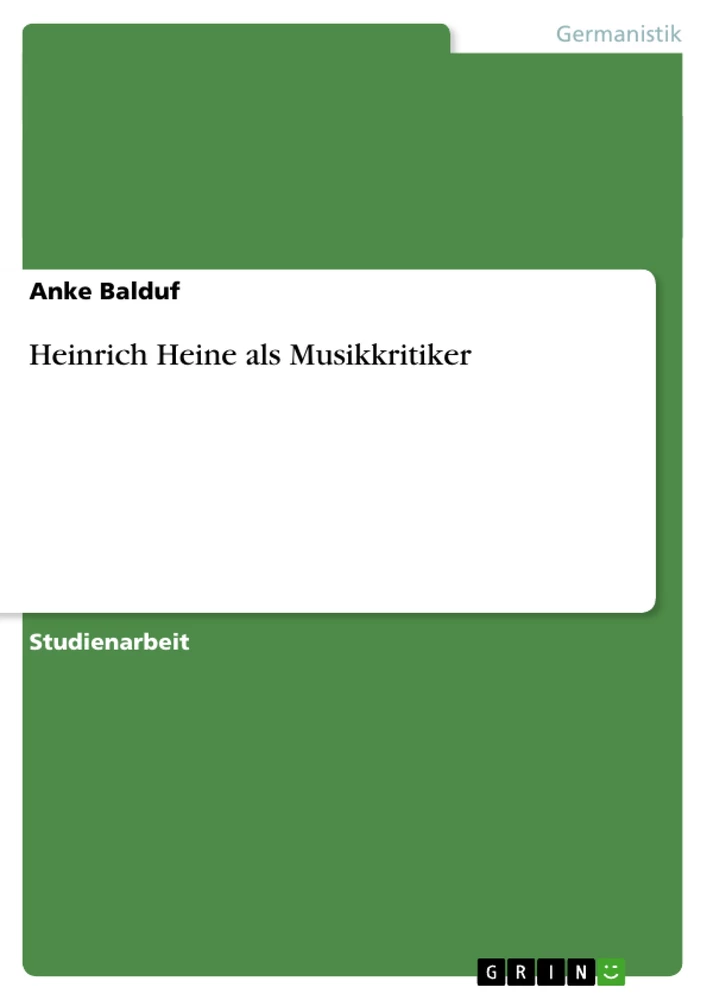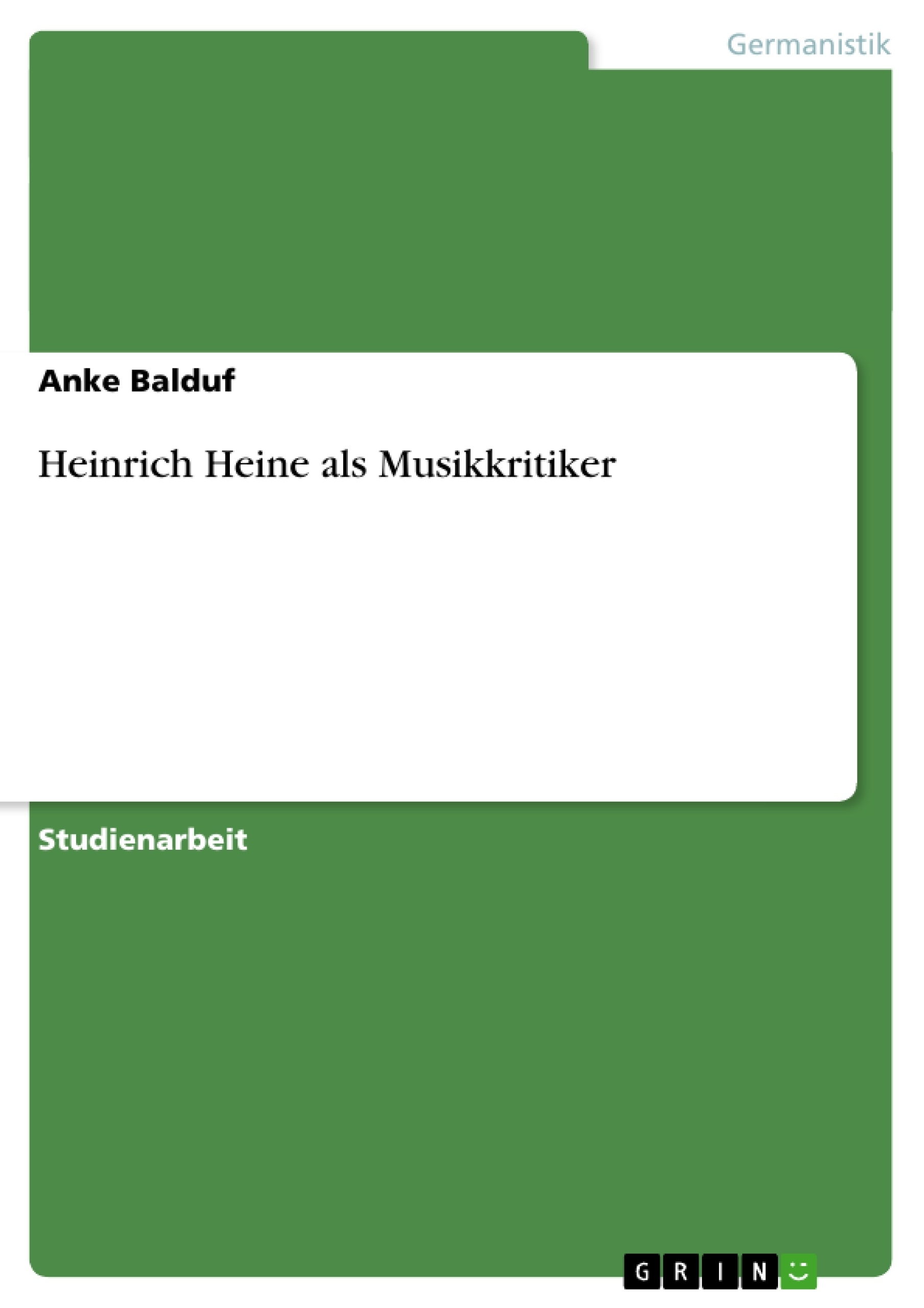„Wir wissen nicht, was Musik ist. Aber was gute Musik ist, das wissen wir, und noch besser wissen wir,
was schlechte Musik ist.“1
Ja, man kann nicht leugnen, daß Heine sehr wohl wußte, was er für gute, und was er für schlechte
Musik hielt, und man kann auch nicht leugnen, daß er wußte, wie er seine Meinung am besten kundtun
konnte. Heine scheute sich nie, Musiker und ihre Werke zu beurteilen, auch wenn er selbst mehrfach
sein Laientum auf diesem Gebiet betonte. Heine war mit vielen Komponisten und Musikern seiner Zeit
befreundet oder zumindest bekannt, und seine Musikkritiken waren oft dementsprechend
personenbezogen. Sein Urteil änderte sich meist dann, wenn der Betreffende nicht mehr mit ihm
befreundet war oder ihn in irgendeiner Weise verärgert hatte.
Nichtsdestotrotz ist Heines Musikkritik wesentlich von dem zentralen Konflikt zwischen deutscher und
italienischer Musik geprägt, der die Musikästhetik des 18. Und 19. Jahrhunderts beschäftigte.
Eng verbunden ist Heines Musikauffassung auch mit der von E.T.A. Hoffmann. Beide suchen in der
Musik das Zauberhafte, das den Hörer in eine andere Welt trägt. Und beide haben ihre dichterische
Tätigkeit in den Bereich der musikalischen Tageskritik verlegt, um den Lesern die Musik bildhaft zu
beschreiben.
Auch mit Herder verbindet Heine einiges. Herder sucht in der Musik die Volksverbundenheit und das
Nationalgefühl, und sowohl Heine als auch Herder finden in der italienischen Oper „schmachtendüppige
Gesänge“ und in der deutschen Oper „das wahre, schlicht Deutsche“.2
Ich möchte mit dieser Arbeit einen Überblick über Heines Musikkritiken liefern. Die Berliner Briefe
werde ich nicht behandeln, da ich mich hauptsächlich auf Heines kritische Beschäftigung mit Musik
während seiner Pariser Zeit konzentriere.
1 Windfuhr, Michael (Hrsg.). Heinrich Heine. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke,
Düsseldorfer Ausgabe, Hamburg, 1980, 12/1, 273
Alle weiteren Angaben zu dieser Ausgabe sind so gekennzeichnet: DHA
2 Mann, Michael. Heinrich Heines Musikkritiken, Heine-Studien, Michael Windfuhr (Hrsg.), Hamburg,
1971, 135
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heines Leben und seine Zeit
- Zensur
- Geschichtliches zur Musikkritik
- Heines Musikkritiken
- Heine in Paris
- Heine und der Saint-Simonismus
- Die Musikberichte
- Hillers Konzert
- Les Huguenots
- Brief 9 und 10 über die französische Bühne
- Lutezia
- Heines Schreibstil
- Die Literarische Technik
- Die Verlängerte Metapher
- Die Gleichnisse
- Das fingierte Gespräch
- Der Vergleich
- Erklärung des Kunstwerks anhand eines anderen Kunstgebiets
- Heines Witz
- Die Literarische Technik
- Die Komponisten
- Giacomo Meyerbeer
- Gioacchino Rossini
- Franz Liszt
- Frédéric Chopin
- Ferdinand Hiller
- Hector Berlioz
- Gaspare Spontini
- Felix Mendelssohn-Bartholdy
- Niccoló Paganini
- Vincenzo Bellini
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Heinrich Heines Musikkritiken und zeichnet ein umfassendes Bild von seiner Auseinandersetzung mit der Musik seiner Zeit. Insbesondere untersucht sie die Entwicklung seiner Ansichten und Bewertungen, sowie die Rolle der Musik in seinem Gesamtwerk.
- Heines Leben und seine Zeit im Kontext der musikalischen Entwicklungen
- Der Einfluss von E.T.A. Hoffmann und Herder auf Heines Musikauffassung
- Heines Kritik an Komponisten und musikalischen Strömungen
- Die Rolle des Nationalismus und des politischen Zeitgeschehens in Heines Musikkritiken
- Heines Schreibstil und seine literarischen Mittel in der Musikkritik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach Heines Verständnis von guter und schlechter Musik und beleuchtet seine Rolle als Musikkritiker in Bezug auf seine Zeit und seine Beziehungen zu Komponisten. Die Einleitung verweist auf die Bedeutung des Konflikts zwischen deutscher und italienischer Musik in Heines Ästhetik und zeigt Bezüge zu E.T.A. Hoffmann und Herder.
- Heines Leben und seine Zeit: Dieses Kapitel skizziert Heines Lebensweg und die wichtigsten Ereignisse seiner Zeit im Kontext der musikalischen Entwicklungen, um seine Musikkritiken in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
- Zensur: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Zensur im Kontext Heines und seiner Zeit und beleuchtet mögliche Auswirkungen auf seine Musikkritiken.
- Geschichtliches zur Musikkritik: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Geschichte der Musikkritik und stellt sie in Relation zu Heines Zeit und seiner Rolle als Kritiker.
- Heine in Paris: Dieses Kapitel befasst sich mit Heines Zeit in Paris und analysiert seine Musikkritiken in diesem Kontext, wobei die Rolle der französischen Musik und die Beziehung zu französischen Komponisten im Mittelpunkt stehen.
- Heine und der Saint-Simonismus: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss des Saint-Simonismus auf Heines Musikauffassung und seine Auseinandersetzung mit der Musik in diesem Kontext.
- Die Musikberichte: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Musikberichte Heines, darunter die Rezensionen von Hillers Konzert, Les Huguenots und Lutezia, und analysiert seinen Schreibstil und seine Kritik in diesen Texten.
- Heines Schreibstil: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Heines literarische Techniken und seinen Schreibstil in der Musikkritik, darunter die Verwendung von Metaphern, Gleichnissen, fingierten Gesprächen und Vergleichen.
- Die Komponisten: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse von Heines Beurteilungen verschiedener Komponisten wie Giacomo Meyerbeer, Gioacchino Rossini, Franz Liszt, Frédérig Chopin, Ferdinand Hiller, Hector Berlioz, Gaspare Spontini, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Niccoló Paganini und Vincenzo Bellini.
Schlüsselwörter
Heinrich Heine, Musikkritik, Musikästhetik, deutsche Musik, italienische Musik, E.T.A. Hoffmann, Herder, Saint-Simonismus, französische Musik, Komponisten, literarische Techniken, Schreibstil.
- Quote paper
- Anke Balduf (Author), 1998, Heinrich Heine als Musikkritiker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11313