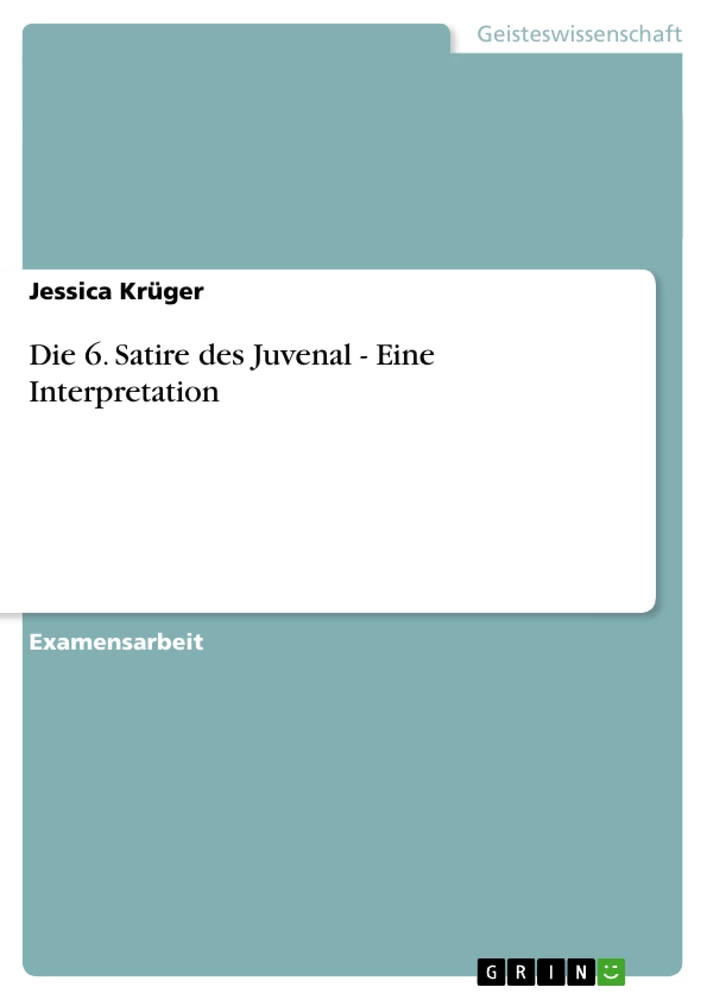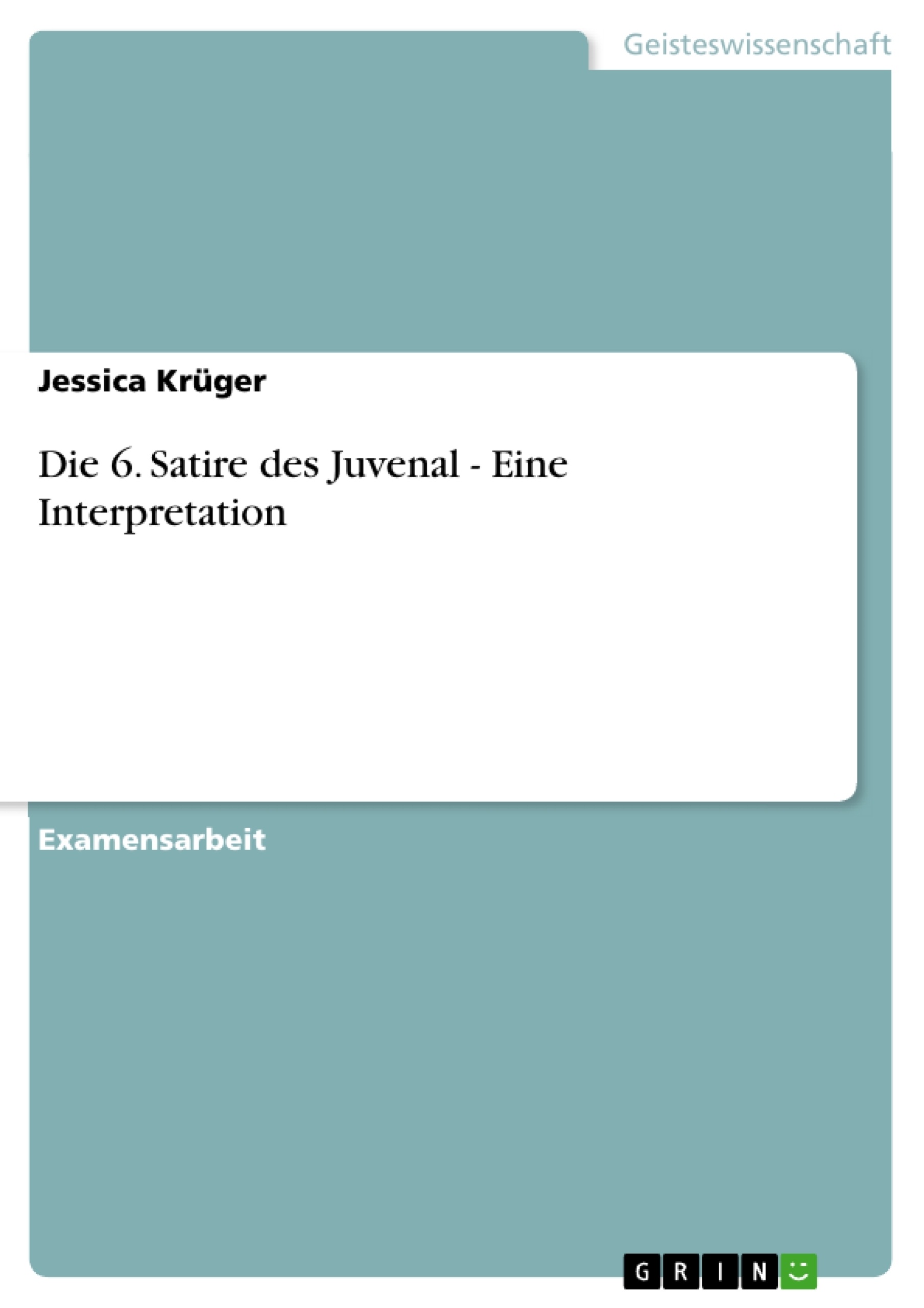Nil erit ulterius, quod nostris moribus addat posteritas. (Iuv. I 147 f.)1 Mit diesem Ausspruch gibt der Dichter Juvenal zu erkennen, dass seiner Meinung nach die Lasterhaftigkeit seiner Zeitgenossen von der Nachwelt nicht mehr übertroffen werden kann, da der Höhepunkt bereits erreicht ist. Difficile est saturam non scribere. (Iuv. I 30) Und wegen dieser Verdorbenheit bleibt ihm nichts anderes übrig, als Satiren zu schreiben. Während Horaz aus den Fehlern seiner Mitmenschen Lehren für sein eigenes Leben zu ziehen versuchte und sie dann erst bei Gelegenheit und so aus einer gewissen Distanz aufschrieb,2 lässt sich bei Juvenal keine Distanz zu den Lastern des Alltags finden.3 Bei ihm ist keine Rede mehr von Gelegenheitsdichtung, sondern er wird von seiner Entrüstung zum Dichten angestachelt: Facit indignatio versum (Iuv. I 79). Während es bei Horaz noch Spiel und Zeitvertreib war (inludere und ubi quid datur oti), denkt Juvenal an die Aggressivität des Lucilius, des Begründers der Satire.4 Anhand der Wahl des Vorbilds Lucilius lässt sich offenbar Juvenals Auffassung erkennen, dass „die scharfe Beobachtung der menschlichen Fehler in der Welt Roms und deren moralische Bloßstellung”5 die Aufgabe des Satirikers sei. Ob Juvenal sich dieses auch in der 6. Satire zur Aufgabe gemacht hat, gilt es in der vorliegenden Examensarbeit zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorwort
- I. 1. Forschungskontroversen zur 6. Satire
- I. 2. Leitfragen und methodisches Vorgehen
- II. 1. Die Struktur der 6. Satire
- II. 1. 1. Pudicitiam Saturno rege moratam: Über das Proömium (V. 1-20)
- II. 1. 2. atque duae pariter fugere sorores: Pudicitia und Iustitia haben die Erde verlassen (V. 21-135)
- II. 1. 3. nullam invenies quae parcat amanti: Die Qualen der Ehe für den Ehemann (V. 136-285)
- II. 1. 4. saevior armis luxuria incubuit: Der Luxus verdirbt die römischen Frauen (V. 286-300)
- II. 1. 5. non umquam reputat quanti sibi gaudia constent: Der Luxus der Frauen treibt die Männer in den Ruin (V. 300-365)
- II. 1. 6. Das Oxford-Fragment (O 1-34)
- II. 1. 7. nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil: Die Unarten und Verbrechen der Frauen (V. 366-633)
- II. 1. 8. Clytaemestram nullus non vicus habebit: Diese Frauen existieren wirklich (V. 634-661)
- II. 2. Der poeta ethicus und der satirische Sprecher
- III. Fazit
- IV. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Juvenals 6. Satire, die mit 661 Versen seine längste ist. Ziel ist es, die Struktur und die zentralen Themen der Satire zu analysieren und die bestehenden Forschungskontroversen, insbesondere bezüglich der Komposition und der Interpretation des "Oxford-Fragments", zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Satire als eine "tour de force of antifeminism" zu verstehen ist oder ob sie primär als Warnung vor den Gefahren der Ehe zu interpretieren ist.
- Struktur und Komposition der 6. Satire
- Das Bild der Frau in Juvenals 6. Satire
- Die Rolle des "Oxford-Fragments"
- Der satirische Sprecher und seine Position
- Interpretation der zentralen Argumentationslinien
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorwort: Das Vorwort erläutert die Motivation der Autorin, sich mit Juvenals 6. Satire auseinanderzusetzen. Es wird auf die Lasterhaftigkeit der Zeitgenossen Juvenals eingegangen und dessen Motivation, durch seine Satiren auf diese zu reagieren, hervorgehoben. Der Vergleich mit Horaz’ Satiren verdeutlicht den Unterschied in Herangehensweise und Intention. Der Bezug auf Lucilius als Vorbild unterstreicht Juvenals Zielsetzung, die moralische Verdorbenheit seiner Zeit aufzuzeigen.
II. 1. Die Struktur der 6. Satire: Dieses Kapitel analysiert die Struktur der 6. Satire Juvenals, die mit 661 Versen die längste seiner Satiren ist und in der römischen Satire einzigartig ist. Es wird auf die verschiedenen Interpretationen und die damit verbundenen Kontroversen eingegangen, insbesondere die Frage nach der Echtheit des "Oxford-Fragments" und die Diskussion um eine mögliche strukturelle Einheit der Satire. Verschiedene Ansätze zur Segmentierung der Satire in Abschnitte werden vorgestellt und bewertet, wobei die unterschiedlichen Positionen der Forschung, von einer klaren Struktur bis hin zur fehlenden Komposition, dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Juvenal, 6. Satire, Strukturanalyse, "Oxford-Fragment", Antifeminismus, Ehekritik, Römische Satire, Moral, Luxus, Frauenbild, Forschungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu Juvenals 6. Satire
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit, die sich mit Juvenals 6. Satire auseinandersetzt. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Strukturanalyse der Satire, der Interpretation des "Oxford-Fragments" und der Diskussion um die Rolle der Frauen und die Kritik an der Ehe in Juvenals Werk.
Welche Themen werden in der Arbeit zu Juvenals 6. Satire behandelt?
Die Arbeit analysiert die Struktur und die zentralen Themen von Juvenals 6. Satire. Im Mittelpunkt stehen die Interpretation des "Oxford-Fragments", die Frage nach einer möglichen antifeministischen Tendenz oder der Priorisierung der Ehekritik, sowie die Rolle des satirischen Sprechers. Weitere Themen sind das Frauenbild in der Satire, der Einfluss von Luxus und Moral und die Einordnung der Satire in den Kontext der römischen Literatur.
Wie ist die 6. Satire von Juvenal strukturiert?
Die Arbeit untersucht die Struktur der 6. Satire, die mit 661 Versen die längste Satire Juvenals ist. Es werden verschiedene Interpretationen und die damit verbundenen Kontroversen diskutiert, insbesondere die Frage nach der Echtheit und der Position des "Oxford-Fragments" innerhalb der Gesamtstruktur. Die Arbeit analysiert verschiedene Ansätze zur Segmentierung der Satire in Abschnitte und bewertet deren jeweilige Stärken und Schwächen. Die unterschiedlichen Positionen der Forschung, von einer klaren Struktur bis hin zur fehlenden Komposition, werden dargestellt.
Welche Rolle spielt das "Oxford-Fragment" in der Interpretation der 6. Satire?
Das "Oxford-Fragment" stellt einen zentralen Punkt der Debatte dar. Die Arbeit beleuchtet die bestehenden Forschungskontroversen bezüglich seiner Echtheit und seiner Bedeutung für die Gesamtinterpretation der Satire. Die Position des Fragments innerhalb der Struktur und sein Einfluss auf die Argumentationslinien werden analysiert.
Ist Juvenals 6. Satire antifeministisch?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Satire als "tour de force of antifeminism" zu verstehen ist oder ob sie primär eine Warnung vor den Gefahren der Ehe darstellt. Diese Frage wird im Kontext der Analyse der Struktur, der Argumentationslinien und des Frauenbildes in der Satire diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einem Vorwort, welches die Motivation der Autorin und den methodischen Ansatz erläutert. Der Hauptteil analysiert die Struktur der 6. Satire im Detail. Ein Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und ein Literaturverzeichnis listet die verwendeten Quellen auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Juvenal, 6. Satire, Strukturanalyse, "Oxford-Fragment", Antifeminismus, Ehekritik, Römische Satire, Moral, Luxus, Frauenbild, Forschungsgeschichte.
- Quote paper
- Jessica Krüger (Author), 2008, Die 6. Satire des Juvenal - Eine Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113044