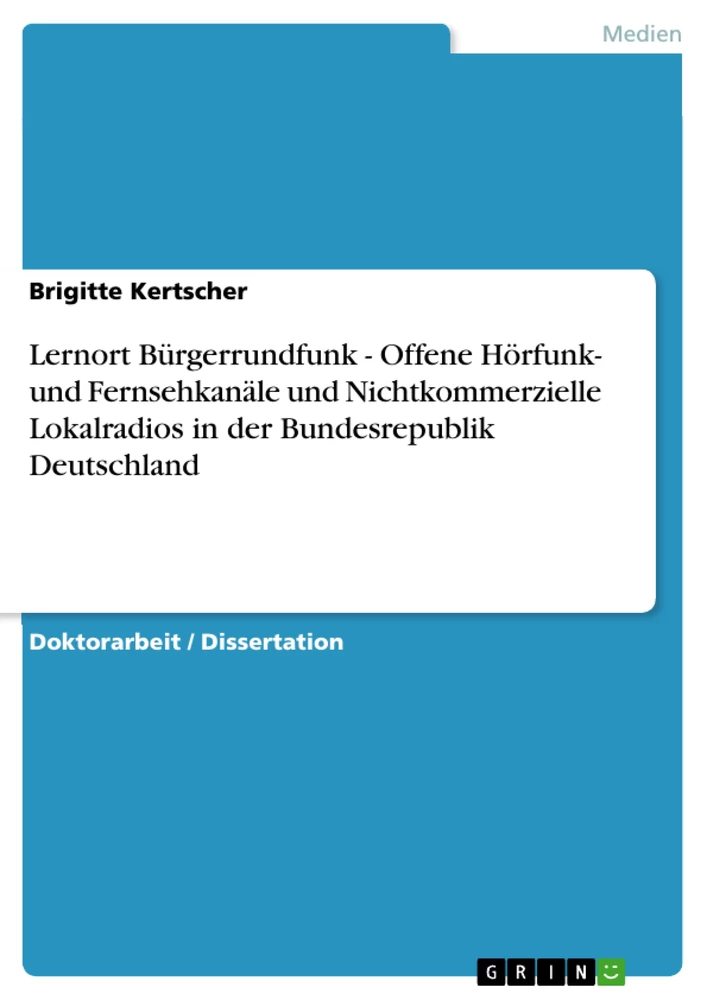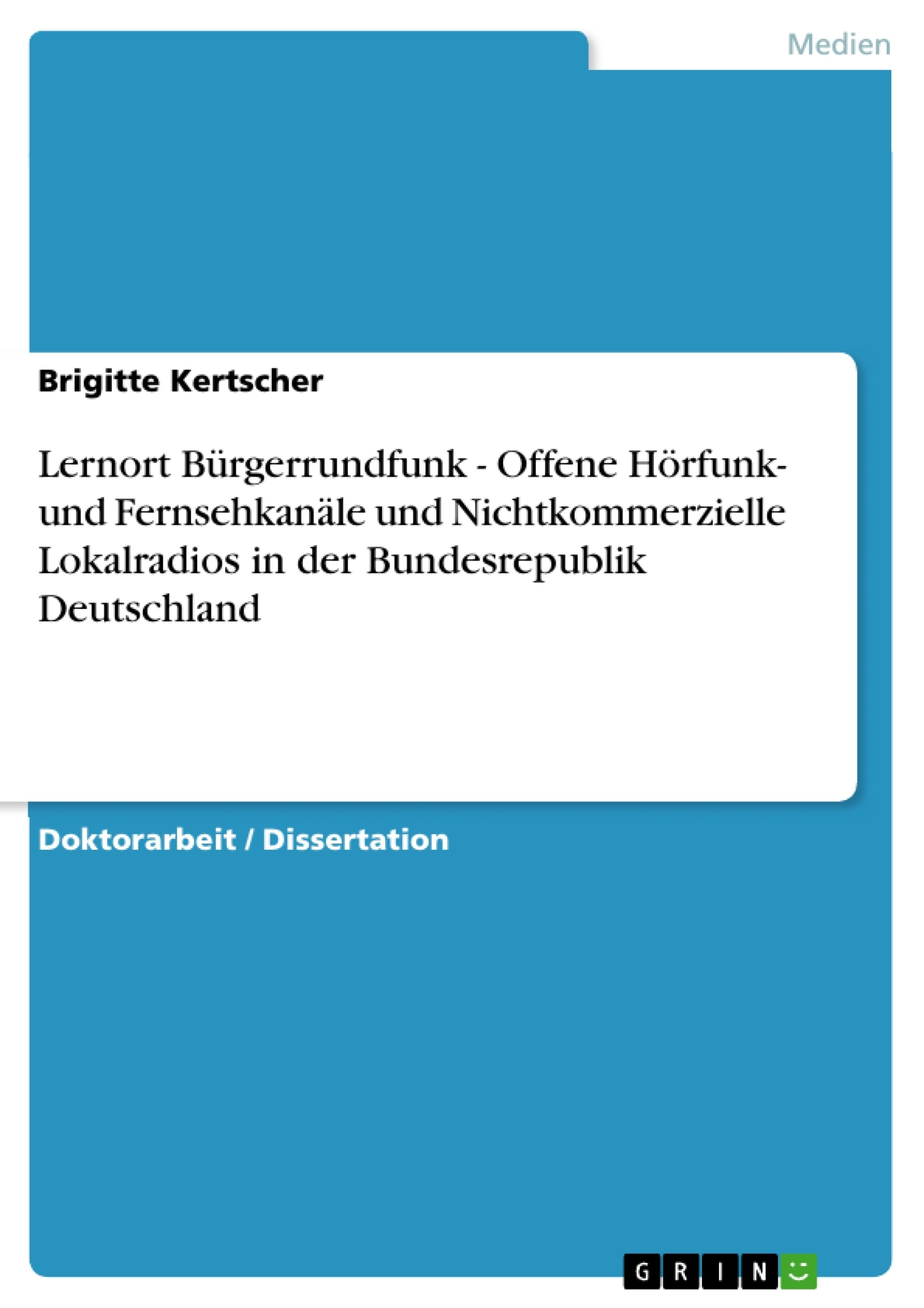Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die Entstehung, Entwicklung und Strukturen des Bürgerrundfunks in Deutschland geben und seine Funktionen darlegen. Ein Schwerpunkt wird darauf liegen, die Rolle dieser Rundfunksender – Nichtkommerzielle Lokale Hörfunksender (NKL) und Offene Hörfunk- und Fernsehkanäle (OK) – als Lernorte in der modernen Kommunikationsgesellschaft zu verdeutlichen.
Bisherige umfangreichere Publikationen befassen sich zumeist mit einzelnen Bürgersendern oder regionalen Bürgerrundfunklandschaften bzw. beschränken sich auf eine der beiden Grundformen. Daneben gibt es eine Reihe von Veröffentlichungen, die medienpädagogische Projekte vorstellen. Erstmals wird mit dieser Arbeit eine umfassendere Monografie vorgelegt, die sowohl Offene Kanäle als auch Nichtkommerzielle Lokalradios von der Idee über ihre Institutionalisierung bis hin zu ihrer Arbeitsorganisation und Funktionsweise bundesweit vorstellt.
Ergänzend wurden vier Modellbeispiele aufgenommen und zudem eine größere Anzahl aktiver Nutzer Offener Kanäle ausführlich befragt. Im Bürgerrundfunk wird, wie die vorliegende Arbeit belegen soll, alltäglich medienpraktische und medienpädagogische Arbeit geleistet. Diese Sender bieten mit ihren Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger ein hervorragendes Untersuchungsfeld für die Forschung, die hier anhand einer Vielzahl verschiedenster Produktionsvorhaben und Weiterbildungsangebote betrieben werden kann. Solche Feldforschungen können auch über lange Zeiträume geführt werden und die verschiedensten Zielgruppen einbeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begleitforschungen im Bereich des Bürgerrundfunks
- Medienkompetenz als politische Schlüsselkompetenz
- Die Entwicklung der Medien und ihre Bedeutung in der Gesellschaft
- Medienkompetenz - Bildungsbegriff und -aufgabe
- Medienkompetenz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
- Die Bildungsinhalte
- Zur Entwicklung der Bürgersender in Deutschland
- Die Idee des Bürgerrundfunks: Offene Kanäle und Nichtkommerzieller Lokaler Hörfunk
- Formen und Merkmale des Bürgerrundfunks
- Merkmale Offener Kanäle (OK)
- Merkmale Nichtkommerzieller Lokaler Hörfunksender (NKL)
- Ausbildungssender
- Das duale Rundfunksystem in Deutschland und die Zulassung von Bürgerrundfunk
- Die Entstehung des dualen Rundfunksystems der Bundesrepublik Deutschland und der gesellschaftspolitische Diskurs
- Die medienpolitische Diskussion um den Ausbau neuer Übertragungstechniken und die Einführung des dualen Rundfunksystems
- Die Diskussion um die Zulassung von Bürgerrundfunk – Pro und Kontra Offene Kanäle
- Die Landesmedienanstalten
- Die Entstehung des Bürgerrundfunks in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Entstehung und Zulassung der ersten Offenen Kanäle
- Die Entstehung und Zulassung des Nichtkommerziellen Lokalen Hörfunks
- Zusammenfassung: Traditionslinien und Entstehung des Bürgerrundfunks
- Grundsätzliche Regelungen und Organisationsmerkmale des Bürgerrundfunks
- Grundsätzliche Regelungen und Organisationsmerkmale Offener Kanäle
- Grundsätzliche Regeln und Organisationsmerkmale der NKL
- Zusammenfassung: Strukturen
- Problemkreise des Bürgerrundfunks
- Lage des Bürgerrundfunks um das Jahr 2000 - eine Übersicht über die Entwicklung und den Betrieb der Bürgersender in ihrer länderspezifischen Ausprägung
- NKL und Präferenz für Ausbildungssender – der „OK-freie“ Süden
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Sachsen
- Konzentration auf die OK - Länder mit Offenen Kanälen aber ohne NKL
- Berlin/Brandenburg
- Bremen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Schleswig-Holstein
- Bürgerrundfunklandschaften – Länder mit NKL und OK
- Hamburg
- Hessen
- Niedersachsen
- Sachsen-Anhalt
- Thüringen
- Dachorganisationen, Kooperationen
- Der Arbeitskreis Offener Kanäle/Bürgerfunk (AKOK)
- Die Norddeutsche Kooperation Bürgermedien (NOKO)
- Der Bundesverband Offene Kanäle (BOK) e.V.
- Der Bundesverband Freier Radios (BFR)
- Die Praxis vor Ort
- Der Bürgerrundfunk als medienpädagogisches Handlungs- und Forschungsfeld
- Saarland: Offener Kanal in Schulen (OkiS)
- ArbeitnehmerInnen auf Sendung - Projekt der PH Freiburg in Offenen Hörfunkkanälen und NKL
- Freie Radios in Baden-Württemberg als Ort der aktiven Jugend-Medienarbeit
- Modellbeispiele
- Radio,,Corax" (Halle/Saale)
- Radio,,Lora" (München) (Stand Januar 2001)
- OK Bremen/OK Bremerhaven
- Offener Kanal Wernigerode(Stand Mai 2001)
- Zusammenfassung
- Die Praxis vor Ort aus Nutzersicht OK-Umfrage Sachsen-Anhalt
- Ziele und Grenzen der Umfrage
- Theoretische Ansätze der Befragung
- Befragungsmodus
- Auswertung
- Fazit und Rückschlüsse für die weitere Arbeit der Offenen Kanäle in Sachsen-Anhalt
- Ergänzender Überblick über wesentliche Entwicklungen nach 2001
- Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Hamburg
- Das niedersächsische Konvergenzmodell
- Die Idee des Konvergenzmodells und die daraus resultierenden Aufgaben der Bürgersender
- Die Umsetzung des Konvergenzmodells
- Ausblick auf die mögliche weitere Entwicklung
- Zusammenfassung
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Anlagen
- MEDIENGESETZE (Auszüge)
- Rundfunkstaatsvertrag (RStV) Auszüge
- Landesmediengesetze
- DACHORGANISATIONEN/VERBÄNDE
- Satzung des Bundesverbandes Offene Kanäle (BOK) e.V.
- Open Channels For Europe 1997
- Erklärung zum Jahrestreffen Offener Kanäle Berlin 1998
- Bundesverband Freier Radios - BFR-Charta
- Tübinger Maßgaben zur Programmkooperation
- Nordkooperation der Landesmedienanstalten - Thementag Offene Kanäle in Norddeutschland 2001
- LÄNDERRICHTLINIEN/OK-SATZUNGEN DER LÄNDER
- Baden-Württemberg Richtlinien der Landesanstalt für Kommunikation für eine Förderung von nichtkommerziellen Hörfunkveranstaltern (FÖRL NKL)
- Satzung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR Hessen) über die Nutzung Offener Kanäle
- Nutzungsordnung für die Offenen Kanäle in Hessen
- Thüringen: OK-Satzung
- Thüringen - Merkblatt NKL
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation „Lernort Bürgerrundfunk“ befasst sich mit der Entwicklung, den Strukturen und der Bedeutung von Offenen Hörfunk- und Fernsehkanälen sowie Nichtkommerziellen Lokalradios in der Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit untersucht die Rolle des Bürgerrundfunks als Lernort und die Bedeutung von Medienkompetenz im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung.
- Die Entstehung und Entwicklung des Bürgerrundfunks in Deutschland
- Die Bedeutung von Medienkompetenz als politische Schlüsselkompetenz
- Die Rolle des Bürgerrundfunks als Lernort und medienpädagogisches Handlungsfeld
- Die Strukturen und Organisationsmerkmale des Bürgerrundfunks
- Die Praxis des Bürgerrundfunks in verschiedenen Bundesländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Bürgerrundfunks ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung und der Bedeutung von Medienkompetenz.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Konzept der Medienkompetenz. Es analysiert die Entwicklung der Medien und ihre Bedeutung in der Gesellschaft sowie die Bedeutung von Medienkompetenz als Bildungsbegriff und -aufgabe. Das Kapitel beleuchtet die Medienkompetenz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und untersucht die Bildungsinhalte, die im Kontext des Bürgerrundfunks relevant sind.
Kapitel 3 zeichnet die Entwicklung des Bürgerrundfunks in Deutschland nach. Es beleuchtet die Idee des Bürgerrundfunks, die Entstehung der Offenen Kanäle und des Nichtkommerziellen Lokalen Hörfunks sowie die Zulassung des Bürgerrundfunks im dualen Rundfunksystem. Das Kapitel analysiert die Strukturen und Organisationsmerkmale des Bürgerrundfunks und beleuchtet die Problemkreise, die mit der Entwicklung und dem Betrieb der Bürgersender verbunden sind.
Kapitel 4 bietet eine Übersicht über die Lage des Bürgerrundfunks um das Jahr 2000. Es analysiert die Entwicklung und den Betrieb der Bürgersender in verschiedenen Bundesländern und beleuchtet die länderspezifischen Ausprägungen des Bürgerrundfunks. Das Kapitel untersucht die Rolle von Dachorganisationen und Kooperationen im Bereich des Bürgerrundfunks.
Kapitel 5 befasst sich mit der Praxis des Bürgerrundfunks vor Ort. Es analysiert den Bürgerrundfunk als medienpädagogisches Handlungs- und Forschungsfeld und stellt verschiedene Modellbeispiele vor. Das Kapitel untersucht die Praxis des Bürgerrundfunks aus Nutzersicht anhand einer OK-Umfrage in Sachsen-Anhalt.
Kapitel 6 bietet einen ergänzenden Überblick über wesentliche Entwicklungen des Bürgerrundfunks nach 2001. Es beleuchtet die Entwicklung in verschiedenen Bundesländern und analysiert das niedersächsische Konvergenzmodell. Das Kapitel gibt einen Ausblick auf die mögliche weitere Entwicklung des Bürgerrundfunks.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bürgerrundfunk, Offene Kanäle, Nichtkommerzieller Lokaler Hörfunk, Medienkompetenz, Bildung, Gesellschaft, Medienentwicklung, Medienpolitik, Landesmedienanstalten, Strukturen, Organisationsmerkmale, Praxis, Modellbeispiele, Nutzerumfrage, Konvergenzmodell, Entwicklung, Zukunft.
- Citar trabajo
- Dr. Brigitte Kertscher (Autor), 2005, Lernort Bürgerrundfunk - Offene Hörfunk- und Fernsehkanäle und Nichtkommerzielle Lokalradios in der Bundesrepublik Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113034