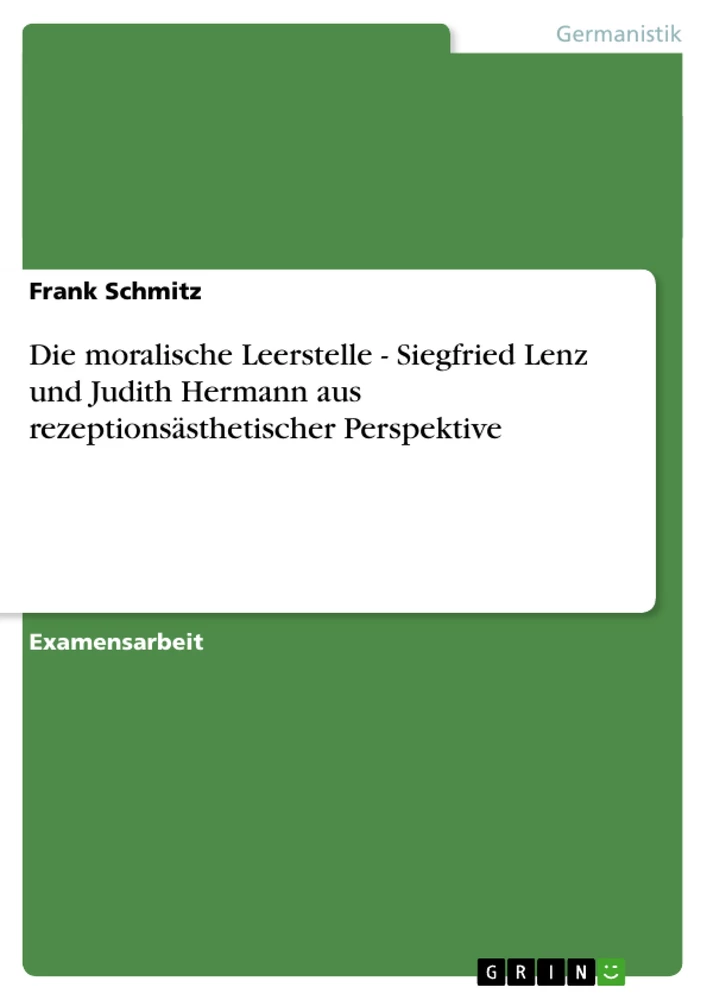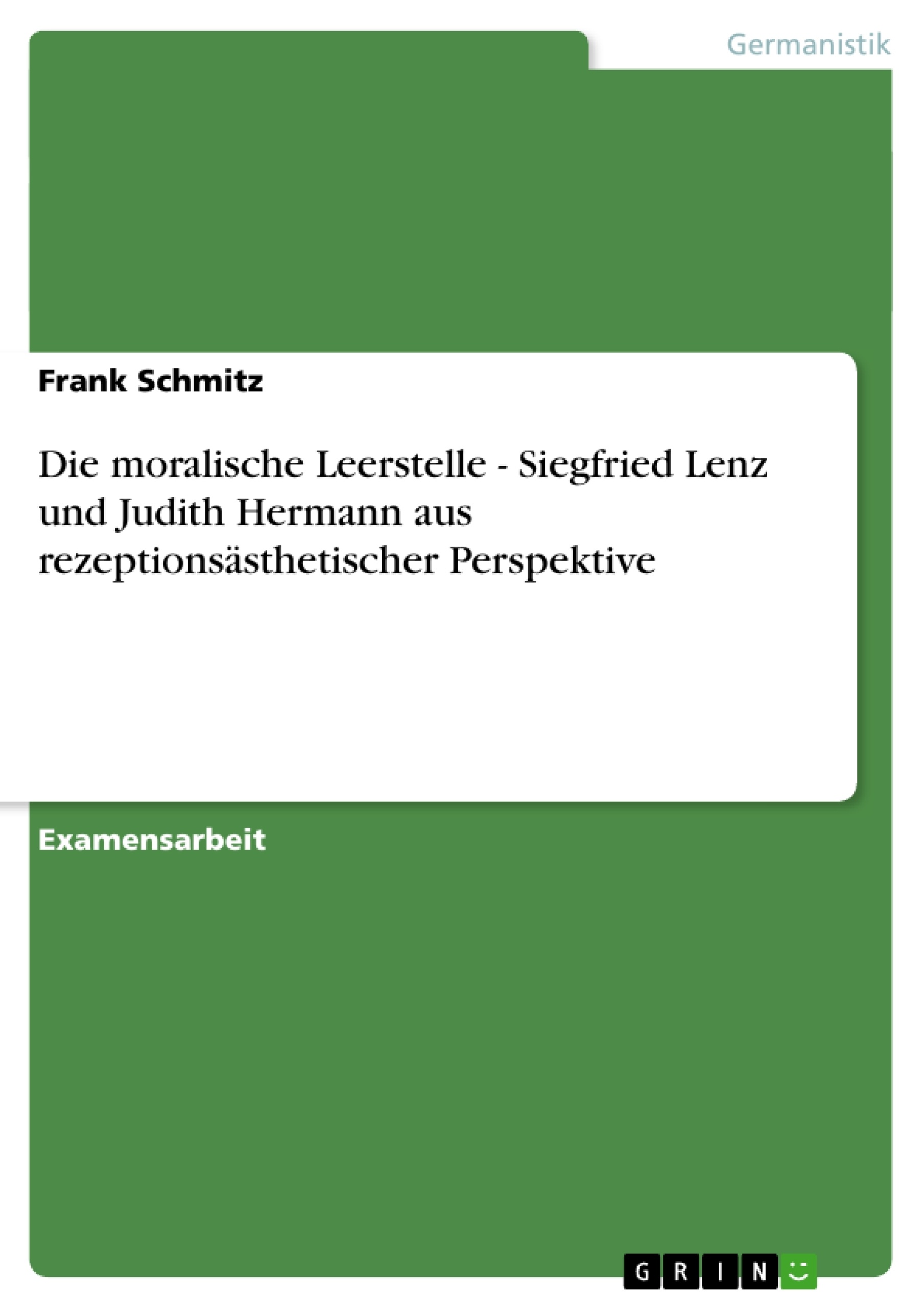Wenngleich es literarische Texte seit geraumer Zeit gibt, so ist die Art und Weise des Umgangs mit ihnen, d. h. insbesondere ihre Interpretation seit je her umstritten. Nicht nur die Literaturwissenschaft ist sich bis heute uneins in der Auslegung von Texten, sondern auch die „gewöhnliche“ Leserschaft kommt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, was die Bedeutung von Texten anlangt. Seit den Bemühungen der Konstanzer Schule und ihren Hauptvertretern Wolfgang Iser und Hans Robert Jauß, das Verhältnis von Text und Leser in einer Theorie der Rezeptionsästhetik neu zu definieren, hat der etwas starre Interpretationsbetrieb aus Hermeneutik und Strukturalismus in den 1970er Jahren neue Bewegung erfahren. Iser und Jauß zeigen in ihren Ausführungen die Verwechslung zwischen Bedeutung und Sinn auf. Wer Texte nur auf ihre Bedeutung hin liest, läuft also nicht nur Gefahr, Bedeutung mit Sinn zu verwechseln, sondern auch über den Sinn eines literarischen Textes hinweg zu lesen und somit die Grundlage für die mögliche Bedeutung von Texten außer Acht zu lassen. Könnten Texte allein über die Denotate ihre Wörter erschlossen werden, so stellt sich die Frage, warum die Bedeutung eines Textes, die sich dem Zugriff des Lesers gezielt und beinahe böswillig entzieht, immer erst „gefunden“ werden muss. Inwieweit dieser Auffassung ein Missverständnis innewohnt und inwieweit es sich lösen lässt, zeigt Wolfgang Iser anhand seiner rezeptionsästhetischen Theorie in „Der Akt des Lesens“ , die im Anschluss an eine knappe Darstellung auf drei Erzählungen angewendet werden soll. Über die Anwendung hinaus möchte ich zeigen, dass Isers „Leerstellen“ in den ausgewählten Erzählungen insbesondere von moralischer Bedeutsamkeit sind, wenngleich die Rezeptionsästhetik eine Vielzahl von möglichen Interpretationen annimmt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Iser und der Akt des Lesens
- 1. Voraussetzungen
- 2. Der implizite Leser
- 3. Textrepertoire
- 4. Thema und Horizont
- 5. Zwischen Retention und Protention
- 6. Die Leerstellen
- 7. Negation
- III. Siegfried Lenz: Der seelische Ratgeber
- 1. Analyse
- 2. Die Sinnkonstitution und ihre Bedeutung
- IV. Siegfried Lenz: Die Flut ist pünktlich
- 1. Analyse
- 2. Die Sinnkonstitution und ihre Bedeutung
- V. Judith Hermann: Ruth (Freundinnen)
- 1. Herangehensweise
- 2. Störfaktoren im Figurenverhältnis
- 3. Ursachenforschung
- 4. Die Lösungsstrategien der Ich-Erzählerin
- 5. Die Sinnkonstitution und ihre Bedeutung
- VI. Was soll ich tun? – Die Erzählungen im Überblick
- VII. Grenzen der Rezeptionsästhetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die moralischen Implikationen in drei Erzählungen von Siegfried Lenz und Judith Hermann unter Anwendung der rezeptionsästhetischen Theorie von Wolfgang Iser. Ziel ist es, die Bedeutung von Isers Konzept der "Leerstellen" für das Verständnis der moralischen Dimensionen in den Texten aufzuzeigen und die unterschiedlichen Sinnkonstitutionen beim Leser zu beleuchten.
- Rezeptionsästhetische Analyse von Erzählungen
- Moralische Dimensionen in der Literatur
- Isers Konzept der "Leerstellen"
- Sinnkonstitution und Leserrolle
- Vergleichende Analyse von Lenz und Hermann
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Textinterpretation und der Rezeptionsästhetik ein. Sie hebt die Uneinigkeit in der Auslegung literarischer Texte hervor und betont die Bedeutung der Konstanzer Schule, insbesondere von Wolfgang Iser und Hans Robert Jauß, für eine neue Definition des Verhältnisses von Text und Leser. Die Arbeit stellt die zentrale These auf, dass Isers "Leerstellen" in den ausgewählten Erzählungen von moralischer Bedeutung sind, und kündigt die Anwendung von Isers Theorie auf drei Erzählungen von Siegfried Lenz und Judith Hermann an.
II. Iser und der Akt des Lesens: Dieses Kapitel beschreibt Isers rezeptionsästhetische Theorie. Es erläutert die Kommunikationsstruktur zwischen Text und Leser, wobei der Text den künstlerischen Pol und der Leser den der Konkretisation darstellt. Der Sinn eines Textes wird nicht allein durch die Dekodierung der Wörter erschlossen, sondern durch die aktive Konstitution des Lesers unter Einbezug seiner kognitiven Fähigkeiten und Affekte. Der implizite Leser, als ein vom Text vorausgedachter möglicher Empfänger, wird eingeführt, und die Rolle des Lesers bei der Sinnkonstitution wird detailliert beschrieben.
III. Siegfried Lenz: Der seelische Ratgeber: (Eine detaillierte Zusammenfassung dieses Kapitels würde den vorgegebenen Umfang überschreiten und müsste auf Basis des nicht vorhandenen Textes erstellt werden. Dasselbe gilt für die folgenden Kapitel.)
IV. Siegfried Lenz: Die Flut ist pünktlich: (Eine detaillierte Zusammenfassung dieses Kapitels würde den vorgegebenen Umfang überschreiten und müsste auf Basis des nicht vorhandenen Textes erstellt werden.)
V. Judith Hermann: Ruth (Freundinnen): (Eine detaillierte Zusammenfassung dieses Kapitels würde den vorgegebenen Umfang überschreiten und müsste auf Basis des nicht vorhandenen Textes erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Rezeptionsästhetik, Wolfgang Iser, Siegfried Lenz, Judith Hermann, Moral, Sinnkonstitution, Leerstellen, Leserrolle, Textinterpretation, Nachkriegsliteratur, Deutsche Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Rezeptionsästhetische Analyse von Erzählungen von Siegfried Lenz und Judith Hermann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die moralischen Implikationen in drei Erzählungen von Siegfried Lenz und Judith Hermann unter Anwendung der rezeptionsästhetischen Theorie von Wolfgang Iser. Im Fokus steht die Bedeutung von Isers Konzept der "Leerstellen" für das Verständnis der moralischen Dimensionen und die unterschiedlichen Sinnkonstitutionen beim Leser.
Welche Erzählungen werden analysiert?
Analysiert werden folgende Erzählungen: "Der seelische Ratgeber" und "Die Flut ist pünktlich" von Siegfried Lenz sowie "Ruth" (aus dem Band "Freundinnen") von Judith Hermann.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf der rezeptionsästhetischen Theorie von Wolfgang Iser. Insbesondere das Konzept der "Leerstellen" und die Rolle des impliziten Lesers spielen eine zentrale Rolle in der Analyse.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These besagt, dass Isers "Leerstellen" in den ausgewählten Erzählungen von moralischer Bedeutung sind und die Sinnkonstitution des Lesers maßgeblich beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Iser und der Akt des Lesens, Analyse von "Der seelische Ratgeber", Analyse von "Die Flut ist pünktlich", Analyse von "Ruth", Ein Überblick über die Erzählungen und Schlussfolgerungen zu den Grenzen der Rezeptionsästhetik.
Wie wird die Analyse der Erzählungen durchgeführt?
Die Analyse erfolgt anhand der rezeptionsästhetischen Theorie Isers. Es wird untersucht, wie der Leser durch die "Leerstellen" im Text aktiv an der Sinnkonstitution beteiligt ist und wie diese Leerstellen die moralische Dimension der Erzählungen beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Rezeptionsästhetik, Wolfgang Iser, Siegfried Lenz, Judith Hermann, Moral, Sinnkonstitution, Leerstellen, Leserrolle, Textinterpretation, Nachkriegsliteratur, Deutsche Wiedervereinigung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Isers Konzept der "Leerstellen" für das Verständnis der moralischen Dimensionen in den analysierten Texten aufzuzeigen und die unterschiedlichen Sinnkonstitutionen beim Leser zu beleuchten. Sie bietet eine vergleichende Analyse der Erzählungen von Lenz und Hermann.
- Quote paper
- Frank Schmitz (Author), 2008, Die moralische Leerstelle - Siegfried Lenz und Judith Hermann aus rezeptionsästhetischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112992