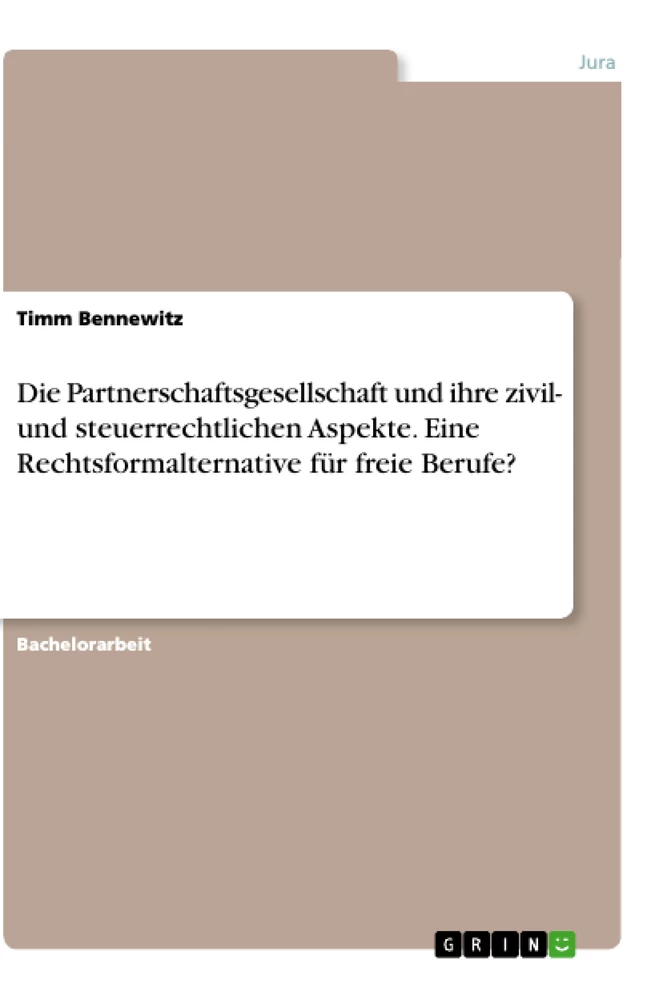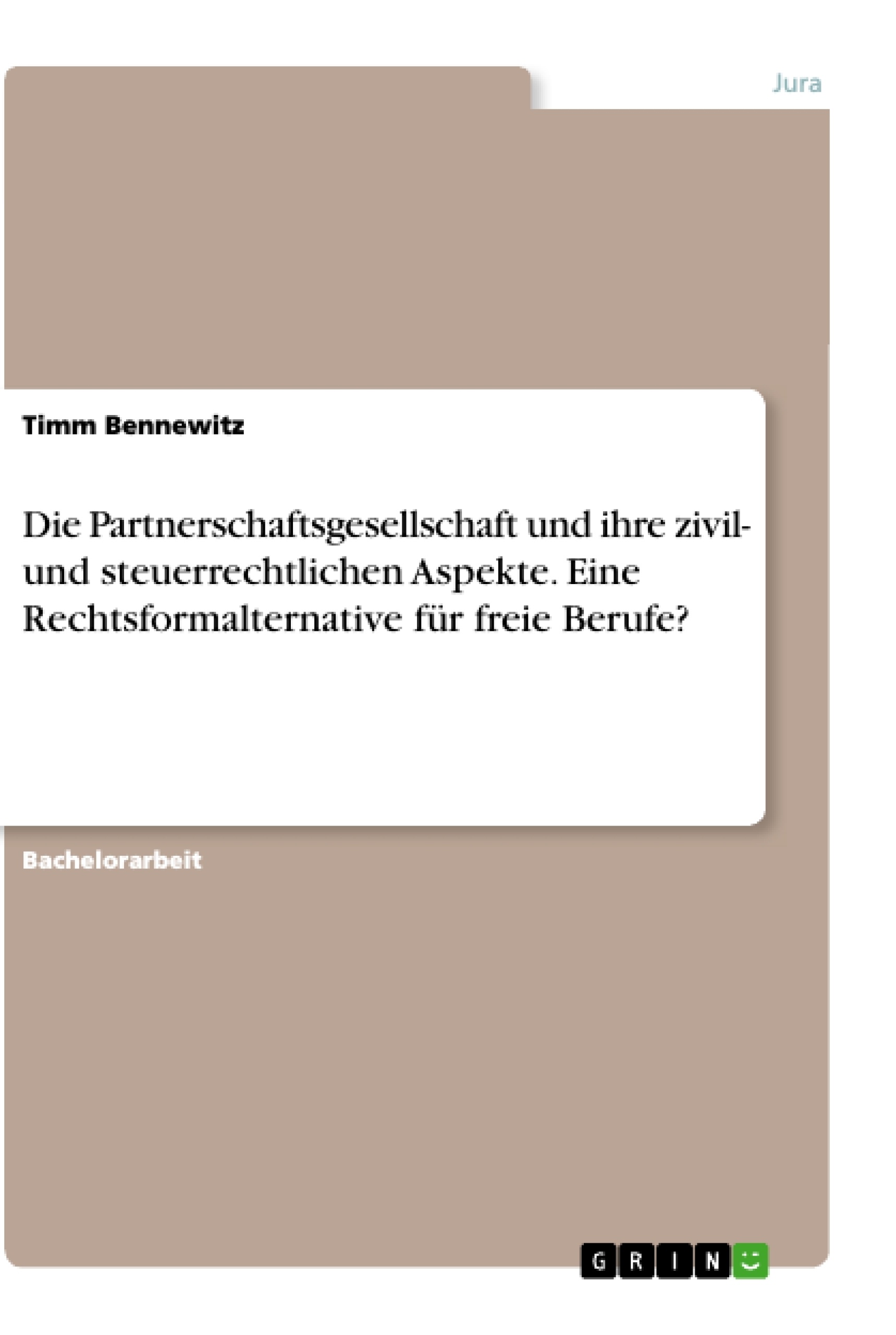Die Arbeit gibt einen Einblick in die Grundlagen der Partnerschaftsgesellschaft und erläutert im Anschluss die zivilrechtlichen Aspekte sowie die steuerliche Handhabung. Abschließend wird ein Vergleich zwischen den Rechtsformen PartG, GbR und GmbH durchgeführt. Der Vergleich findet im Wesentlichen hinsichtlich der Gründungskosten, der steuerlichen Belastung sowie der einschlägigen Gewinnermittlungsmethode und Möglichkeit der Haftungsbeschränkung statt.
Über die letzten 20 Jahre hinweg nimmt die Anzahl der selbstständigen Freiberufler in Deutschland stetig zu und notiert zum 01.01.2020 einen neuen Höchststand mit 1.450.000 entsprechenden Berufsangehörigen. Durch diesen fortwährenden Anstieg nimmt ebenfalls die Nachfrage nach Zusammenschlüssen gleicher Berufsangehörigen zu. Der Vorteil eines Zusammenschlusses kann mehrere Gründe haben, wie zum Beispiel die Reduzierung des finanziellen Risikos einer Neugründung oder die Möglichkeit der Spezialisierung auf einzelne Fachbereiche.
Seit dem 01.07.1995 bietet die Partnerschaftsgesellschaft Angehörigen freier Berufe die Option, sich zu einer Personengesellschaft zusammenzuschließen. Diese neue Rechtsform wurde ins Leben gerufen, um die Nische zwischen der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts und den Kapitalgesellschaften zu schließen. So ist es dank der Partnerschaftsgesellschaft möglich, die Haftung der einzelnen Gesellschafter zu konzentrieren und seit der Einführung der PartG mbB auch zu beschränken, ohne dass die freiberufliche Ausübung im Sinne des § 18 EStG angegriffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen der Partnerschaftsgesellschaft
- Begriff des freien Berufs und Zugang zur Partnerschaftsgesellschaft
- Entwicklung des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
- Stellung im Rechtssystem
- Vorrang des Berufsrechts
- Verweisung auf das Recht der OHG und GbR
- Zivilrecht
- Zugangskriterien für die Partner
- Name der Partnerschaftsgesellschaft
- Formale und materielle Voraussetzungen des Partnerschaftsvertrags
- Partnerschaftsregister
- Rechtsverhältnis der Partner untereinander
- Verweis auf die handelsrechtlichen Vorschriften
- Geschäftsführung
- Beschlussfassung durch die Gesellschafter
- Gewinn- und Verlustverteilung
- Rechtsverhältnis zu Dritten
- Rechtliche Selbstständigkeit
- Vertretung durch die Partner
- Haftung
- Grundsatz der gesamtschuldnerischen Haftung
- Haftungskonzentration auf bestimmte Partner
- Haftungskonzept der PartG mbB
- Ausscheiden eines Partners, Auflösung der Gesellschaft
- Steuerrecht
- Allgemein
- Steuersubjekt
- Besteuerungsgrundlage
- Abgrenzung zu Gewerbetreibenden
- Abgrenzung der Einkunftsarten
- Freiberufliche Mitunternehmerschaft
- Umqualifizierung zu gewerblichen Einkünften
- Geringfügige gewerbliche Tätigkeit
- Gewerbliche Beteiligung
- Beteiligung Berufsfremder
- Konsequenzen der Einordnung als gewerbliche Personengesellschaft
- Steuerliche Besonderheiten
- Betriebsvermögen
- Gewinnermittlung
- Gründung
- Verlustverrechnung
- Allgemein
- Die PartG im Rechtsformvergleich zur GmbH und GbR
- Gründungskosten
- Steuerliche Belastung
- Einkommensteuer
- Körperschaftssteuer
- Gewerbesteuer
- Vergleichende Steuerbelastungsrechnung
- Gewinnermittlungsmethode
- Möglichkeit der Haftungsbeschränkung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Partnerschaftsgesellschaft (PartG) als Rechtsformalternative für freie Berufe. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der PartG im Vergleich zu anderen Rechtsformen wie der GmbH und der GbR darzustellen und deren Eignung für freie Berufe zu bewerten.
- Rechtliche Grundlagen der Partnerschaftsgesellschaft
- Zivilrechtliche Aspekte der PartG (Verträge, Haftung, Vertretung)
- Steuerrechtliche Behandlung der PartG
- Vergleich der PartG mit GmbH und GbR
- Bewertung der PartG als Rechtsform für freie Berufe
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik der Partnerschaftsgesellschaft als Rechtsformalternative für freie Berufe ein und beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung der Wahl der richtigen Rechtsform für die Organisation und den Erfolg eines freiberuflichen Unternehmens.
Grundlagen der Partnerschaftsgesellschaft: Dieses Kapitel legt die Definition des freien Berufs und die Zugangsvoraussetzungen zur Partnerschaftsgesellschaft dar. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG) und seine Einordnung im deutschen Rechtssystem. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zum Handelsrecht und den spezifischen Regelungen für die PartG.
Zivilrecht: Dieser Abschnitt analysiert die zivilrechtlichen Aspekte der Partnerschaftsgesellschaft detailliert. Die Zugangskriterien für Partner, die Anforderungen an den Partnerschaftsvertrag, die Haftungsregelungen und das Rechtsverhältnis der Partner untereinander werden umfassend behandelt. Besondere Beachtung findet dabei die Abgrenzung der Haftung gegenüber Dritten und die interne Organisation der Gesellschaft.
Steuerrecht: Das Kapitel widmet sich der steuerlichen Behandlung der Partnerschaftsgesellschaft. Es beleuchtet die Abgrenzung zu gewerblichen Einkünften, die steuerlichen Besonderheiten der PartG, die Gewinnermittlung und die Konsequenzen der Einordnung als gewerbliche oder freiberufliche Gesellschaft. Die verschiedenen Steuerarten und deren Auswirkungen auf die PartG werden präzise erläutert.
Die PartG im Rechtsformvergleich zur GmbH und GbR: Dieser Abschnitt vergleicht die Partnerschaftsgesellschaft mit der GmbH und der GbR hinsichtlich Gründungskosten, steuerlicher Belastung, Gewinnermittlung und Haftungsbeschränkung. Es werden konkrete Beispiele und Berechnungen verwendet, um die Unterschiede und Vorteile der verschiedenen Rechtsformen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Partnerschaftsgesellschaft, PartG, freier Beruf, Zivilrecht, Steuerrecht, GmbH, GbR, Haftung, Gewinnverteilung, Rechtsformwahl, Steuerbelastung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Partnerschaftsgesellschaft (PartG) als Rechtsformalternative für freie Berufe. Sie vergleicht die PartG mit anderen Rechtsformen wie der GmbH und der GbR und bewertet deren Eignung für freie Berufe.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der PartG, zivilrechtliche Aspekte (Verträge, Haftung, Vertretung), die steuerrechtliche Behandlung, einen Vergleich mit GmbH und GbR und eine abschließende Bewertung der PartG als Rechtsform für freie Berufe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einführung, Grundlagen der PartG, Zivilrechtliche Aspekte, Steuerrechtliche Aspekte, Rechtsformvergleich (PartG, GmbH, GbR) und einem Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der PartG.
Was sind die zentralen zivilrechtlichen Aspekte der PartG?
Die zivilrechtlichen Aspekte umfassen Zugangskriterien für Partner, Anforderungen an den Partnerschaftsvertrag, Haftungsregelungen (insbesondere die gesamtschuldnerische Haftung), das Rechtsverhältnis der Partner untereinander und die Vertretung gegenüber Dritten.
Wie wird die PartG steuerrechtlich behandelt?
Das Kapitel zum Steuerrecht behandelt die Abgrenzung zu gewerblichen Einkünften, steuerliche Besonderheiten der PartG (Gewinnermittlung, Verlustverrechnung etc.), und die Konsequenzen der Einordnung als gewerbliche oder freiberufliche Gesellschaft. Es werden verschiedene Steuerarten und deren Auswirkungen auf die PartG erläutert.
Wie wird die PartG im Vergleich zu GmbH und GbR dargestellt?
Der Vergleich mit GmbH und GbR umfasst Gründungskosten, steuerliche Belastung (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer), Gewinnermittlung und Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung. Konkrete Beispiele und Berechnungen verdeutlichen die Unterschiede.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Partnerschaftsgesellschaft, PartG, freier Beruf, Zivilrecht, Steuerrecht, GmbH, GbR, Haftung, Gewinnverteilung, Rechtsformwahl, Steuerbelastung.
Wo finde ich eine detaillierte Übersicht über den Inhalt?
Das Inhaltsverzeichnis (Inhaltsverzeichnis) bietet eine detaillierte Gliederung der Arbeit mit Unterpunkten zu den einzelnen Kapiteln.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Vor- und Nachteile der PartG im Vergleich zu anderen Rechtsformen darzustellen und deren Eignung für freie Berufe zu bewerten.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen.
- Quote paper
- Timm Bennewitz (Author), 2021, Die Partnerschaftsgesellschaft und ihre zivil- und steuerrechtlichen Aspekte. Eine Rechtsformalternative für freie Berufe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129844