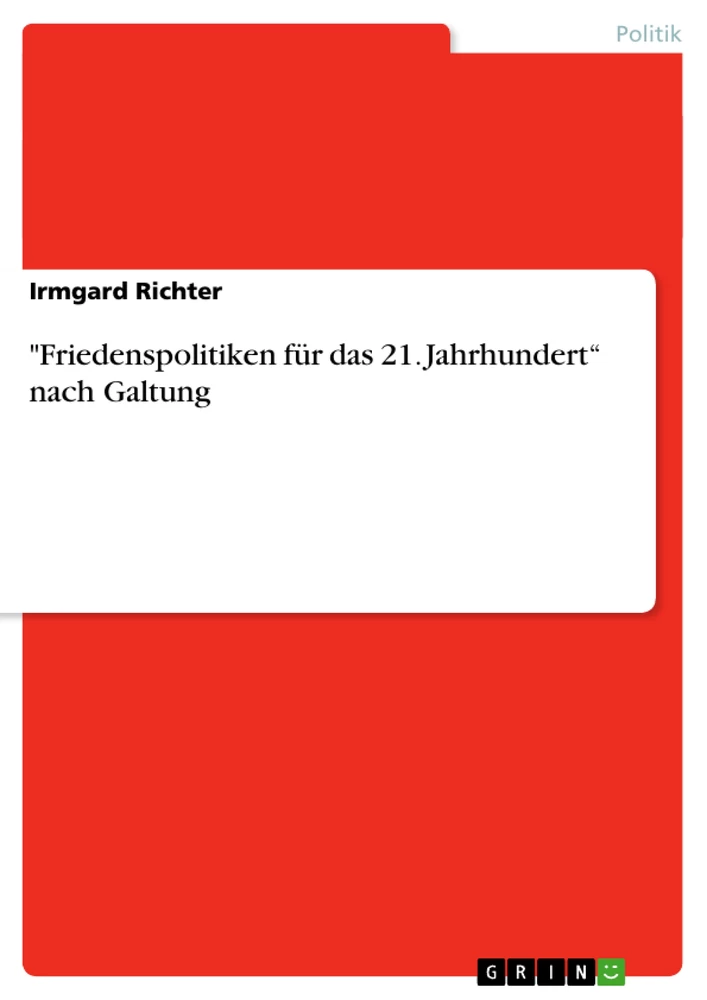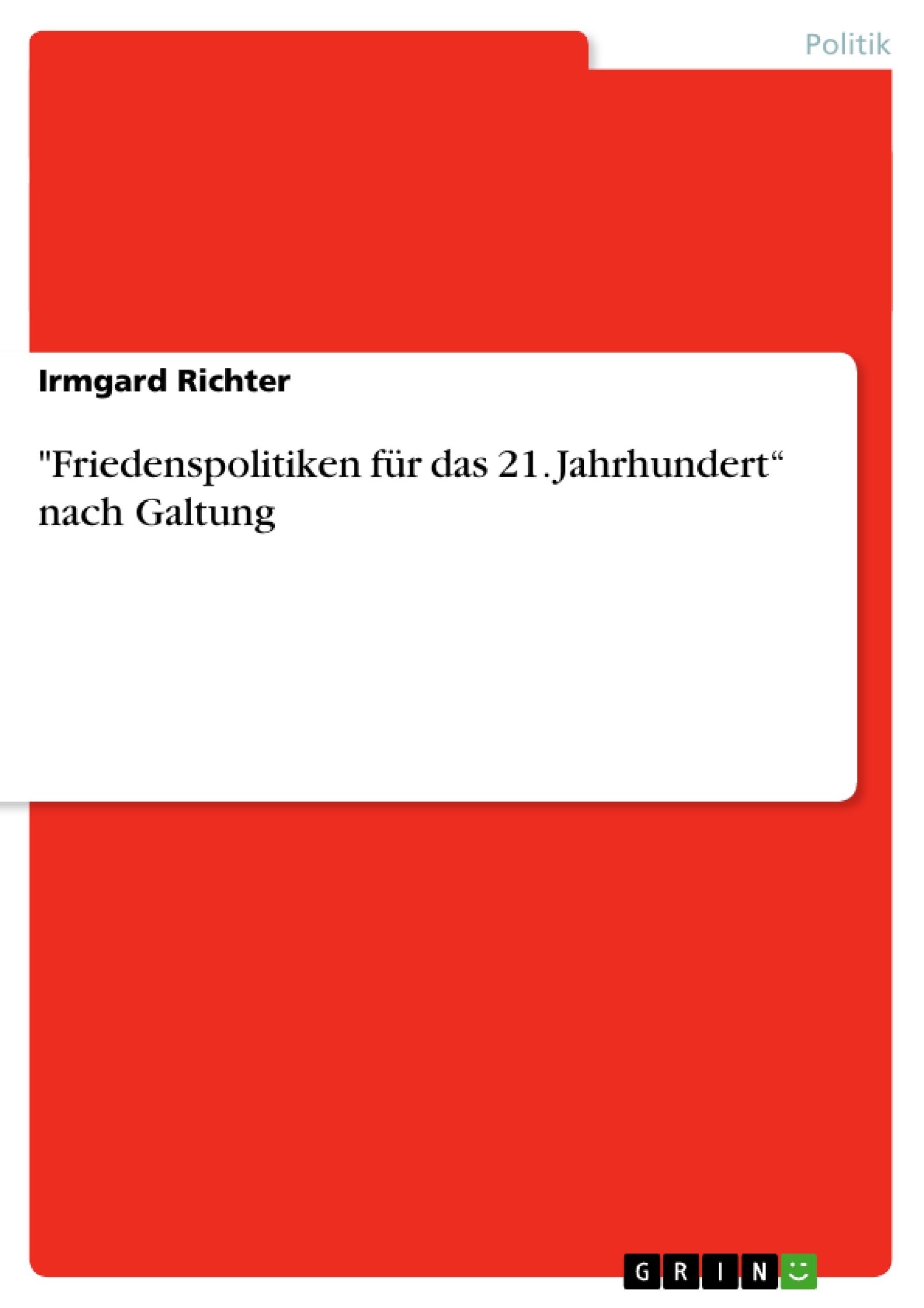Galtungs Tabelle „Friedenspolitiken für das 21 Jahrhundert“ (Galtung, 2004) gibt einen Überblick über Handlungsansätze, die in ihrer Gesamtheit auf die Erreichung bzw. Erhaltung von Frieden abzielen. Dabei unterscheidet Galtung zwischen „negativem“ und „positivem“ Frieden und ordnet die jeweiligen Handlungsansätze vier Macht-Dimensionen zu: politisch, militärisch, ökonomisch und kulturell. Aus diesen Zuordnungen ergeben sich acht Kombinationsmöglichkeiten; ihre Gesamtheit bezeichnet Galtung als den „achtgliedrigen Pfad“. Mit seinen Definitionen des „negativen“ und „positiven“ Friedens lehnt Galtung sich an die Debatte zur Definition des Gesundheitsbegriffes an, die mit der Erklärung von Alma Ata 1978 einen Höhepunkt erreichte und zu einer umfassenden Definition von Gesundheit führte (WHO, 1978). Gesundheit ist entsprechend der Definition der Weltgesundheitsorganisation, WHO, mehr als die Abwesenheit von Krankheit, nämlich der Zustand „vollständigen körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens“ (WHO, 1978).
Der Begriff des „positiven Friedens“ nach Galtung ist ähnlich umfassend wie der Gesundheitsbegriff nach der Definition von Alma Ata. „Positiver Frieden“ ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Er beinhaltet das Streben nach gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine oder ihre Persönlichkeit zum eigenen Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft frei von Repressionen zur Entfaltung zu bringen. Dieser umfassende Friedensbegriff ist eng mit dem Konzept der Menschenrechte verknüpft. Er beinhaltet Freiheit von direkter Gewalteinwirkung und von struktureller Gewalt. Mit struktureller Gewalt ist eine in gesellschaftlichen Strukturen verankerte Gewalt gemeint, die nicht in direkter Gewaltanwendung sichtbar wird, aber bewirkt, dass Menschen in ihren Lebensrechten eingeschränkt und an der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Potenziale gehindert werden; z.B. indem Armut und extreme Ungleichheit als Normalität akzeptiert werden.
Inhalts verzeichnis
Einführung
Negativer und positiver Frieden
Die politische Dimension
Die militärische Dimension
Die ökonomische Dimension
Die kulturelle Dimension
Referenzen
Einführung
Galtungs Tabelle „Friedenspolitiken für das 21 Jahrhundert“ (Galtung, 2004) gibt einen Überblick über Handlungsansätze, die in ihrer Gesamtheit auf die Erreichung bzw. Erhaltung von Frieden abzielen. Dabei unterscheidet Galtung zwischen „negativem“ und „positivem“ Frieden und ordnet die jeweiligen Handlungsansätze vier Macht-Dimensionen zu: politisch, militärisch, ökonomisch und kulturell. Aus diesen Zuordnungen ergeben sich acht Kombinationsmöglichkeiten; ihre Gesamtheit bezeichnet Galtung als den „achtgliedrigen Pfad“.
Negativer und positiver Frieden
Mit seinen Definitionen des „negativen“ und „positiven“ Friedens lehnt Galtung sich an die Debatte zur Definition des Gesundheitsbegriffes an, die mit der Erklärung von Alma Ata 1978 einen Höhepunkt erreichte und zu einer umfassenden Definition von Gesundheit führte (WHO, 1978). Gesundheit ist entsprechend der Definition der Weltgesundheitsorganisation, WHO, mehr als die Abwesenheit von Krankheit, nämlich der Zustand „vollständigen körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens“ (WHO, 1978).
Der Begriff des „positiven Friedens“ nach Galtung ist ähnlich umfassend wie der Gesundheitsbegriff nach der Definition von Alma Ata. „Positiver Frieden“ ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Er beinhaltet das Streben nach gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine oder ihre Persönlichkeit zum eigenen Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft frei von Repressionen zur Entfaltung zu bringen. Dieser umfassende Friedensbegriff ist eng mit dem Konzept der Menschenrechte verknüpft. Er beinhaltet Freiheit von direkter Gewalteinwirkung und von struktureller Gewalt. Mit struktureller Gewalt ist eine in gesellschaftlichen Strukturen verankerte Gewalt gemeint, die nicht in direkter Gewaltanwendung sichtbar wird, aber bewirkt, dass Menschen in ihren Lebensrechten eingeschränkt und an der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Potenziale gehindert werden; z.B. indem Armut und extreme Ungleichheit als Normalität akzeptiert werden.
Der Begriff des „negativen Friedens“ ist enger gefasst und beinhaltet die Abwesenheit vom Krieg im Sinne der Einwirkung direkter Gewalt mit militärischen Mitteln. Der Begriff des „negativen Friedens“ steht also keineswegs, wie man aufgrund es üblichen Sprachgebrauchs für die Adjektive „negativ“ und „positiv“ annehmen könnte, in einem Gegensatz zu dem des „positiven Friedens“. Die Begriffe „negativ“ und „positiv“ drücken aus, dass für die Definition des „negativen Friedens“ das Nichtvorhandensein direkter kriegerischer Gewalt ausschlaggebend ist, während der „positive Frieden“ darüber hinaus durch das Vorhandensein von gesellschaftlichen Merkmalen geprägt ist, die Frieden in einem weiteren Sinne ausmachen.
Die politische Dimension
Die essentielle politische Voraussetzung für die Etablierung eines negativen Friedens im Sinne der Abwesenheit von Krieg ist nach Galtung eine globale Demokratisierung der Staaten. „Das zwischenstaatliche System muss demokratischer, das innerstaatliche System mit demokratischen Mitteln noch friedfertiger gemacht werden“ (Galtung, 2004). Zur Demokratisierung gehören als wesentliche Elemente die Respektierung und Stärkung der Menschenrechte und gleichzeitig die Weiterentwicklung des bestehenden Menschenrechts-Konzepts, das nach Galtung noch zu einseitig auf westliche Ideale bezogen, vom Modell männlicher, erwachsener Menschen westlichen Zuschnitts geprägt und zu stark auf die Rolle des Staates konzentriert ist. Wahlrecht und das Bestehen eines parlamentarischen Systems garantieren für sich allen noch nicht, dass Entscheidungsprozesse demokratisch ablaufen; zur Demokratisierung nach dem Verständnis von Galtung gehört auch der Ausbau von Ansätzen der direkten Demokratie, wie Bürgerinitiativen und Bürgerabstimmungen (Referenden).
Häufig gestellte Fragen
Was ist Galtungs "Friedenspolitik für das 21. Jahrhundert"?
Galtungs Tabelle bietet einen Überblick über verschiedene Handlungsansätze, die darauf abzielen, Frieden zu erreichen bzw. zu erhalten. Er unterscheidet zwischen "negativem" und "positivem" Frieden und ordnet die jeweiligen Ansätze vier Machtdimensionen zu: politisch, militärisch, ökonomisch und kulturell. Diese Kombinationen ergeben den "achtgliedrigen Pfad".
Was versteht man unter "negativem" und "positivem" Frieden nach Galtung?
Negativer Frieden: Die Abwesenheit von Krieg und direkter militärischer Gewalt. Positiver Frieden: Mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Beinhaltet das Streben nach gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen jeder Mensch seine Persönlichkeit frei von Repressionen entfalten kann. Ist eng mit dem Konzept der Menschenrechte und Freiheit von direkter und struktureller Gewalt verbunden.
Was ist strukturelle Gewalt?
Strukturelle Gewalt ist in gesellschaftlichen Strukturen verankerte Gewalt, die nicht in direkter Gewaltanwendung sichtbar wird. Sie bewirkt, dass Menschen in ihren Lebensrechten eingeschränkt und an der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Potenziale gehindert werden (z.B. durch Armut und Ungleichheit).
Welche politischen Voraussetzungen sind laut Galtung für negativen Frieden notwendig?
Eine globale Demokratisierung der Staaten. Dazu gehören die Respektierung und Stärkung der Menschenrechte, die Weiterentwicklung des Menschenrechts-Konzepts und der Ausbau von Ansätzen der direkten Demokratie (Bürgerinitiativen und Bürgerabstimmungen).
Welche politischen Veränderungen sind laut Galtung für positiven Frieden auf globaler Ebene notwendig?
Neben der Demokratisierung der Staaten müssten auch die Vereinten Nationen und ihre Organisation, die UNO, einen Demokratisierungsprozess durchlaufen. Das Veto-Recht der Großmächte sollte abgeschafft werden, und bei Abstimmungen in der UN-Generalversammlung sollte das Prinzip "ein Land, eine Stimme" gelten. Zusätzlich sollte eine Völkerversammlung (United Nations Peoples’ Assembly) der Vereinten Nationen etabliert werden, deren Mitglieder von der Bevölkerung der Mitgliedsländer direkt gewählt würden.
Was wäre die Rolle einer UN-Völkerversammlung?
Die Völkerversammlung böte eine zusätzliche, direktere Artikulationsmöglichkeit für die Bevölkerung der Mitgliedsländer. Mit der Zeit sollte mehr Verantwortung und Entscheidungsbefugnis von der UN-Generalversammlung an die UN-Völkerversammlung übertragen werden.
- Quote paper
- Irmgard Richter (Author), 2007, "Friedenspolitiken für das 21. Jahrhundert“ nach Galtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112930