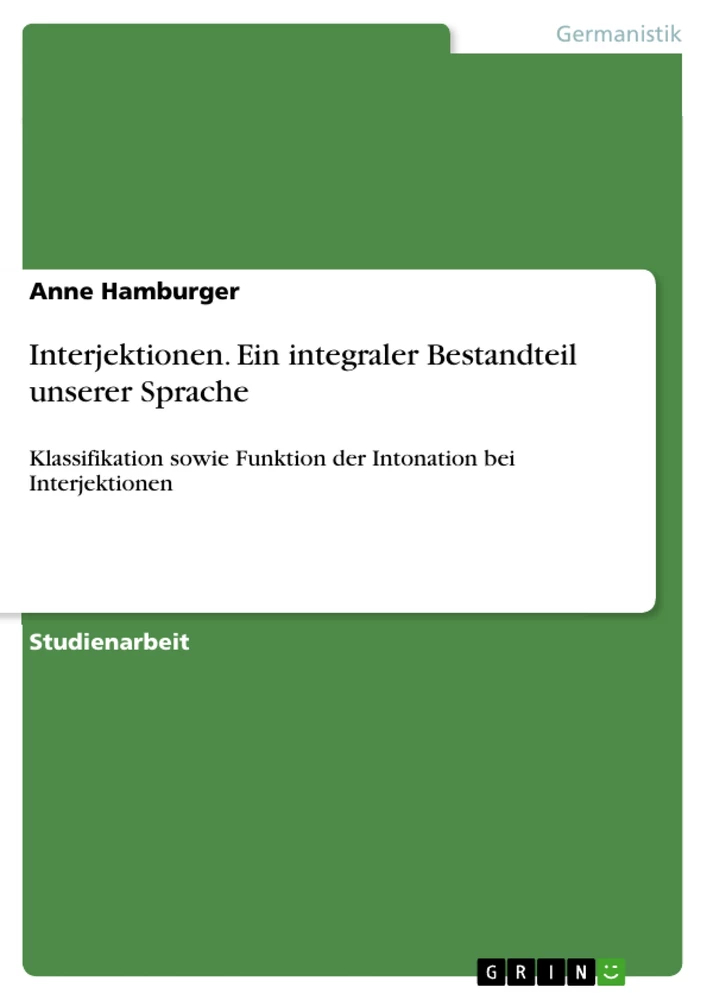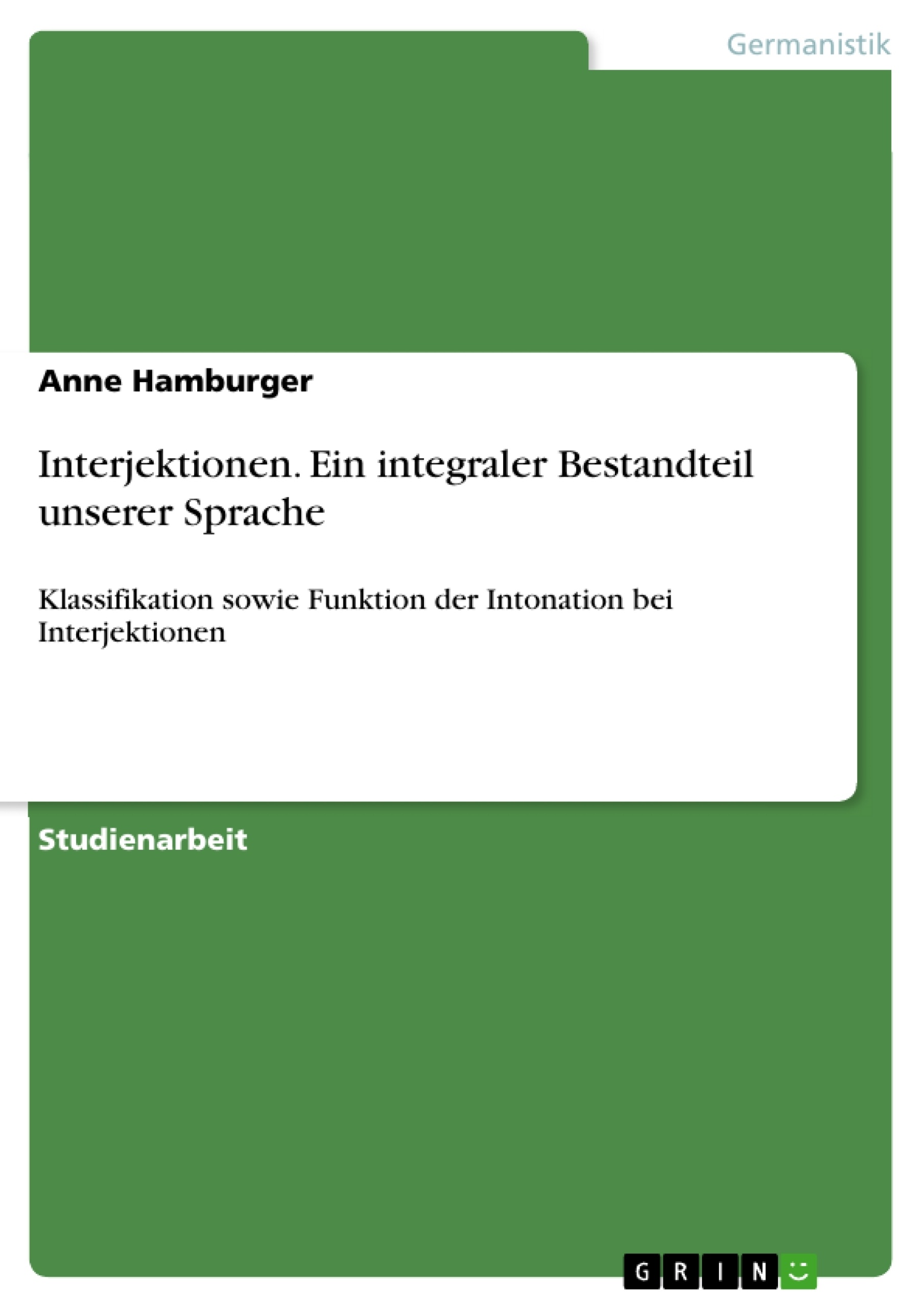In der Arbeit wird zunächst eine definitorische Bestimmung der Interjektion als Wortart erfolgen. Hierbei wird sowohl die geschichtliche Entwicklung der Interjektionen als auch eine Differenzierung zu anderen Wortarten dargestellt. An dieser Stelle werden Interjektionen mit den Wortarten der Partikeln und Routinen verglichen.
Eine genauere Beschreibung der Klassifikation von Interjektionen wird im nachfolgenden Kapitel vorgenommen. Es wird folglich zwischen der morpho-phonologischen und der semantischen Einteilung differenziert. Hierbei werden sowohl die primären als auch die sekundären Interjektionen genauer definiert und analysiert. Anschließend findet eine Beschreibung der Funktion der Intonation bei Interjektionen in Kapitel 4 statt. Die zentralen Begriffe Tonverlauf, Tonhöhenniveau und Tondehnung werden in diesem Abschnitt erläutert und genauer betrachtet.
Interjektionen stellen einen integralen Bestandteil unserer Sprache dar. Sie werden in der deutschen Sprache, aber auch in allen anderen nahezu ununterbrochen meist unbewusst genutzt. In der Linguistik wurden Interjektionen jedoch lange vernachlässig. Bis in die 90er Jahre gab es kaum Veröffentlichungen über diese Wortart, in der heutigen Zeit wird jedoch zunehmend ihre Bedeutung hervorgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interjektionen als Wortart
- 2.1 Geschichtliches und Definitionen
- 2.2 Differenzierung zu anderen Wortarten
- 2.2.1 Interjektionen und Partikeln
- 2.2.2 Interjektionen und Routinen
- 3. Klassifikation von Interjektionen
- 3.1 Morpho-phonologische Einteilung
- 3.1.1 Primäre Interjektionen
- 3.1.2 Sekundäre Interjektionen
- 3.2 Semantische Einteilung
- 3.2.1 Expressiv
- 3.2.2 Konativ
- 3.2.3 Phatisch
- 4. Funktion der Intonation bei Interjektionen
- 4.1 Tonverlauf
- 4.2 Tonhöhenniveau
- 4.3 Tondehnung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Interjektionen als integralen Bestandteil der deutschen Sprache. Ziel ist es, ihre Bedeutung in der Linguistik zu beleuchten und verschiedene Klassifikationsansätze zu präsentieren. Die Arbeit betrachtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Interjektionen, ihre Abgrenzung zu anderen Wortarten und die Rolle der Intonation.
- Historische Entwicklung des Verständnisses von Interjektionen
- Klassifikation von Interjektionen (morpho-phonologisch und semantisch)
- Abgrenzung von Interjektionen zu Partikeln und Routinen
- Die Rolle der Intonation bei Interjektionen
- Bedeutung von Interjektionen für die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Bedeutung von Interjektionen als oft unbeachteten, aber integralen Bestandteil der Kommunikation. Sie skizziert den Forschungsstand, der bis in die 90er Jahre eher gering war, und kündigt den Aufbau der Arbeit an, der sich mit der Definition, Klassifizierung und der Funktion der Intonation bei Interjektionen auseinandersetzt. Die Einleitung stellt die Notwendigkeit der Untersuchung von Interjektionen für ein umfassendes Verständnis der sprachlichen Kommunikation heraus.
2. Interjektionen als Wortart: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Interjektionen in der Grammatikgeschichte. Es zeigt, wie sich die Sichtweise von Interjektionen von einer Unterklasse der Adverbien hin zu einer eigenständigen Wortart gewandelt hat. Der Kapitel vergleicht unterschiedliche Definitionen und Ansätze zur Abgrenzung von Interjektionen zu anderen Wortarten, insbesondere Partikeln und Routinen, um die komplexen linguistischen Eigenschaften dieser Wortart herauszuarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Herausbildung eines differenzierten und umfassenden Verständnisses von Interjektionen, basierend auf der Analyse verschiedener grammatikalischer Traditionen und modernen linguistischen Perspektiven.
3. Klassifikation von Interjektionen: Kapitel 3 befasst sich mit der systematischen Einordnung von Interjektionen. Es unterscheidet zwischen morpho-phonologischen und semantischen Klassifikationen. Die morpho-phonologische Einteilung unterscheidet zwischen primären (lautmalerischen) und sekundären Interjektionen. Die semantische Einteilung betrachtet die Funktion der Interjektionen, unterscheidet zwischen expressiven, konativen und phatischen Interjektionen. Der Kapitel betont die Notwendigkeit verschiedener Klassifikationsansätze für ein vollständiges Verständnis der Vielfältigkeit und Komplexität von Interjektionen.
4. Funktion der Intonation bei Interjektionen: In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Intonation für die Interpretation von Interjektionen untersucht. Es analysiert den Einfluss von Tonverlauf, Tonhöhenniveau und Tondehnung auf die semantische und pragmatische Funktion von Interjektionen. Der Kapitel verdeutlicht, wie eng die Intonation mit der Bedeutung und der kommunikativen Funktion von Interjektionen verwoben ist und wie wichtig die Berücksichtigung der Intonation für ein korrektes Verständnis ist.
Schlüsselwörter
Interjektionen, Wortart, Klassifikation, Morpho-Phonologie, Semantik, Intonation, Kommunikation, Partikeln, Routinen, Expressiv, Konativ, Phatisch, deutsche Sprache, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Interjektionen im Deutschen
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht Interjektionen als eigenständigen Bestandteil der deutschen Sprache. Sie beleuchtet deren Bedeutung in der Linguistik und präsentiert verschiedene Klassifikationsansätze. Ein Schwerpunkt liegt auf der historischen Entwicklung des Verständnisses von Interjektionen, ihrer Abgrenzung zu anderen Wortarten (Partikeln und Routinen) und der Rolle der Intonation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Verständnisses von Interjektionen, ihre morpho-phonologische und semantische Klassifizierung, die Abgrenzung zu Partikeln und Routinen sowie die Funktion der Intonation bei Interjektionen. Die Bedeutung von Interjektionen für die Kommunikation wird ebenfalls thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Interjektionen als Wortart (inkl. Abgrenzung zu anderen Wortarten), Klassifikation von Interjektionen (morpho-phonologisch und semantisch), Funktion der Intonation bei Interjektionen und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Klassifikationen von Interjektionen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert morpho-phonologische Klassifikationen (primäre und sekundäre Interjektionen) und semantische Klassifikationen (expressive, konative und phatische Interjektionen). Die Notwendigkeit verschiedener Klassifikationsansätze für ein vollständiges Verständnis wird betont.
Welche Rolle spielt die Intonation?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Tonverlauf, Tonhöhenniveau und Tondehnung auf die semantische und pragmatische Funktion von Interjektionen. Die enge Verknüpfung der Intonation mit der Bedeutung und kommunikativen Funktion wird hervorgehoben.
Wie werden Interjektionen von Partikeln und Routinen abgegrenzt?
Die Arbeit vergleicht Interjektionen mit Partikeln und Routinen, um ihre komplexen linguistischen Eigenschaften herauszuarbeiten und ein differenziertes Verständnis zu entwickeln. Dies geschieht durch den Vergleich verschiedener grammatikalischer Traditionen und moderner linguistischer Perspektiven.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Interjektionen, Wortart, Klassifikation, Morpho-Phonologie, Semantik, Intonation, Kommunikation, Partikeln, Routinen, Expressiv, Konativ, Phatisch, deutsche Sprache, Linguistik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die wesentlichen Inhalte und Argumentationslinien jedes Kapitels wiedergibt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Interjektionen in der Linguistik zu beleuchten und verschiedene Klassifikationsansätze zu präsentieren. Sie möchte ein umfassendes Verständnis der Interjektionen im Deutschen vermitteln.
- Quote paper
- Anne Hamburger (Author), 2015, Interjektionen. Ein integraler Bestandteil unserer Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129098