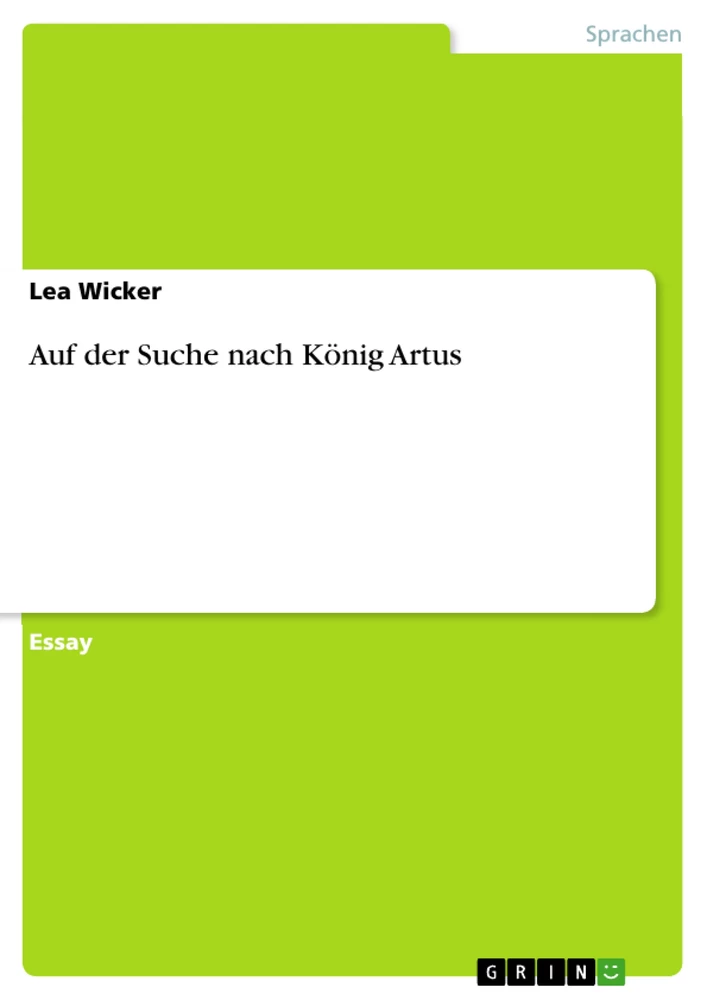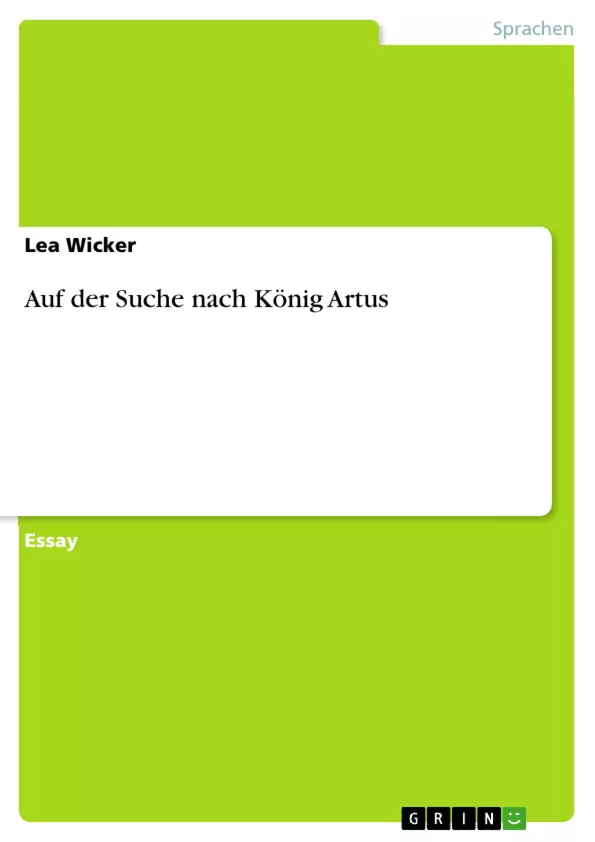Dieses Essay handelt über die Frage, welche Elemente dazu beigetragen haben, dass Artus zu einer historisch-literarischen Integrationsfigur wurde.
Geschichten und Sagen, Legenden und Mythen rund um den berühmten König Artus existieren bereits seit dem frühen Mittelalter. Bis in die gegenwärtige Zeit konnte nicht eindeutig belegt werden, ob Artus eine reale historische Person war, oder lediglich eine literarische Figur. Fest steht jedenfalls, dass Artus eine historisch-literarische Integrationsfigur darstellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die Anfänge der Artussage
- Nennius und die Christianisierung der Artussage
- Geoffrey of Monmouth und die Verbreitung der Artussage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Artussage im frühen und hohen Mittelalter. Ziel ist es, die Faktoren zu analysieren, die Artus zu einer historisch-literarischen Integrationsfigur machten und zu beleuchten, wie sich die Erzählungen im Laufe der Zeit veränderten und verbreiteten.
- Die Frage nach der historischen Existenz Artus
- Die Rolle von Geschichtsschreibern wie Gildas, Beda und Nennius
- Der Einfluss des Christentums auf die Artussage
- Die Bedeutung mündlicher Überlieferung
- Die Popularisierung der Artussage durch Geoffrey of Monmouth
Zusammenfassung der Kapitel
Die Anfänge der Artussage: Der Text untersucht die frühen Zeugnisse über Artus, beginnend mit dem späten 5. Jahrhundert. Er beleuchtet die Schriften von Gildas und Beda, die zwar keine explizite Erwähnung Artus machen, aber Hinweise auf historische Ereignisse enthalten, die später mit der Artussage in Verbindung gebracht wurden. Die Abwesenheit Artus in diesen frühen Quellen, die den historischen Kontext Artus' Lebenszeit unmittelbar umfassen, legt nahe, dass die heute bekannte Figur des Königs Artus nicht auf einer historisch belegten Person basiert, sondern möglicherweise eine im Laufe der Zeit aus mündlichen Überlieferungen und historischen Ereignissen entstandene literarische Schöpfung ist. Die Schlacht am Berg Badon wird als ein Beispiel für ein historisches Ereignis genannt, das später der Artussage zugeschrieben wurde. Die Analyse zeigt, wie bereits in frühen Erzählungen Elemente der zukünftigen Artussage angelegt waren, die jedoch noch nicht explizit mit einer Artusfigur verbunden wurden.
Nennius und die Christianisierung der Artussage: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die „Historia Brittonum“ von Nennius (Anfang des 9. Jahrhunderts), das erste Werk, das Artus explizit erwähnt. Nennius stützte sich auf schriftliche Quellen wie Gildas und Beda, vor allem aber auf mündliche Überlieferungen. Der Text analysiert, wie Nennius Artus zu einem idealen christlichen Vorbild formte, indem er ihm zwölf siegreiche Schlachten zuschrieb – eine symbolträchtige Zahl im Christentum. Die Einbettung der Artussage in den christlichen Kontext wird detailliert untersucht, wobei die Rolle der Mönche und der schriftlichen Übertragung der Texte hervorgehoben wird. Fehler und Eigeninterpretationen bei den Abschriften werden als Faktoren genannt, die zur Entwicklung weiterer Mythen um Artus beitrugen. Der Abschnitt betont Nennius' Absicht, den christlichen Glauben mit der britischen Geschichte zu verbinden und den Menschen im Mittelalter ein positives Vorbild zu bieten.
Geoffrey of Monmouth und die Verbreitung der Artussage: Der Fokus liegt auf Geoffrey of Monmouths „Historia Regum Britanniae“ (12. Jahrhundert). Monmouth sammelte und vereinte schriftliche und mündliche Überlieferungen über Artus, um seine Version der Artussage zu schaffen. Der Text beschreibt, wie Monmouth Artus glorifizierte und ihn mit den acht bedeutendsten Herrschern der Geschichte gleichsetzte, darunter biblische und antike Figuren. Die politische Situation des 12. Jahrhunderts und die Verbreitung der Artussage über die Grenzen Britanniens hinaus werden beleuchtet. Die Analyse zeigt, wie Monmouths Werk zur Popularisierung und weiteren Verbreitung der Artussage beitrug und Artus zu einer europäischen Integrationsfigur machte.
Schlüsselwörter
König Artus, Artussage, historisch-literarische Integrationsfigur, Gildas, Beda, Nennius, Geoffrey of Monmouth, Historia Brittonum, Historia Regum Britanniae, mündliche Überlieferung, Christianisierung, Mittelalter, Britannien, Held, Christliches Vorbild, politische und religiöse Symbolik.
Häufig gestellte Fragen zur Entstehung und Entwicklung der Artussage
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Artussage im frühen und hohen Mittelalter. Sie analysiert die Faktoren, die Artus zu einer historisch-literarischen Integrationsfigur machten und beleuchtet die Veränderungen und Verbreitung der Erzählungen im Laufe der Zeit.
Welche Quellen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schriften von Gildas und Beda (ohne explizite Artus-Erwähnung, aber mit Hinweisen auf historische Ereignisse, die später mit der Artussage in Verbindung gebracht wurden), die „Historia Brittonum“ von Nennius (früheste explizite Erwähnung Artus), und die „Historia Regum Britanniae“ von Geoffrey of Monmouth (Sammlung und Vereinigung schriftlicher und mündlicher Überlieferungen).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Frage nach der historischen Existenz Artus, die Rolle von Geschichtsschreibern, den Einfluss des Christentums auf die Artussage, die Bedeutung mündlicher Überlieferung, und die Popularisierung der Artussage durch Geoffrey of Monmouth.
Wie wird die Rolle von Nennius in der Entwicklung der Artussage dargestellt?
Nennius wird als der erste Autor dargestellt, der Artus explizit erwähnt. Die Arbeit analysiert, wie er Artus zu einem idealen christlichen Vorbild formte, indem er ihm zwölf siegreiche Schlachten zuschrieb. Die Einbettung der Artussage in den christlichen Kontext und die Rolle der Mönche und der schriftlichen Übertragung der Texte werden hervorgehoben. Fehler und Eigeninterpretationen bei den Abschriften werden als Faktoren für die Entwicklung weiterer Mythen genannt.
Welche Bedeutung hat Geoffrey of Monmouths Werk für die Artussage?
Geoffrey of Monmouths „Historia Regum Britanniae“ wird als das Werk dargestellt, welches die Artussage sammelte, vereinte und verbreitete. Die Arbeit beschreibt, wie Monmouth Artus glorifizierte und ihn mit bedeutenden Herrschern der Geschichte gleichsetzte. Die politische Situation des 12. Jahrhunderts und die Verbreitung der Artussage über die Grenzen Britanniens hinaus werden beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit bezüglich der historischen Existenz Artus?
Die Abwesenheit Artus in frühen Quellen, die den historischen Kontext seiner Lebenszeit unmittelbar umfassen, legt nahe, dass die heute bekannte Figur des Königs Artus nicht auf einer historisch belegten Person basiert, sondern möglicherweise eine im Laufe der Zeit aus mündlichen Überlieferungen und historischen Ereignissen entstandene literarische Schöpfung ist.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
König Artus, Artussage, historisch-literarische Integrationsfigur, Gildas, Beda, Nennius, Geoffrey of Monmouth, Historia Brittonum, Historia Regum Britanniae, mündliche Überlieferung, Christianisierung, Mittelalter, Britannien, Held, Christliches Vorbild, politische und religiöse Symbolik.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu den Anfängen der Artussage, Nennius und der Christianisierung der Artussage, und Geoffrey of Monmouth und der Verbreitung der Artussage.
- Quote paper
- Lea Wicker (Author), 2021, Auf der Suche nach König Artus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129070