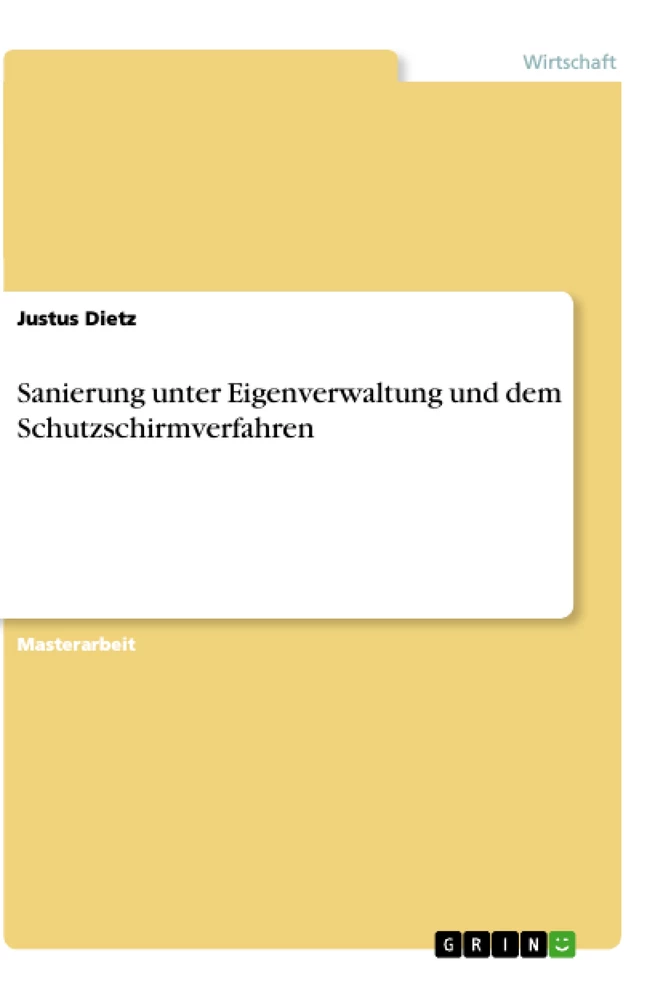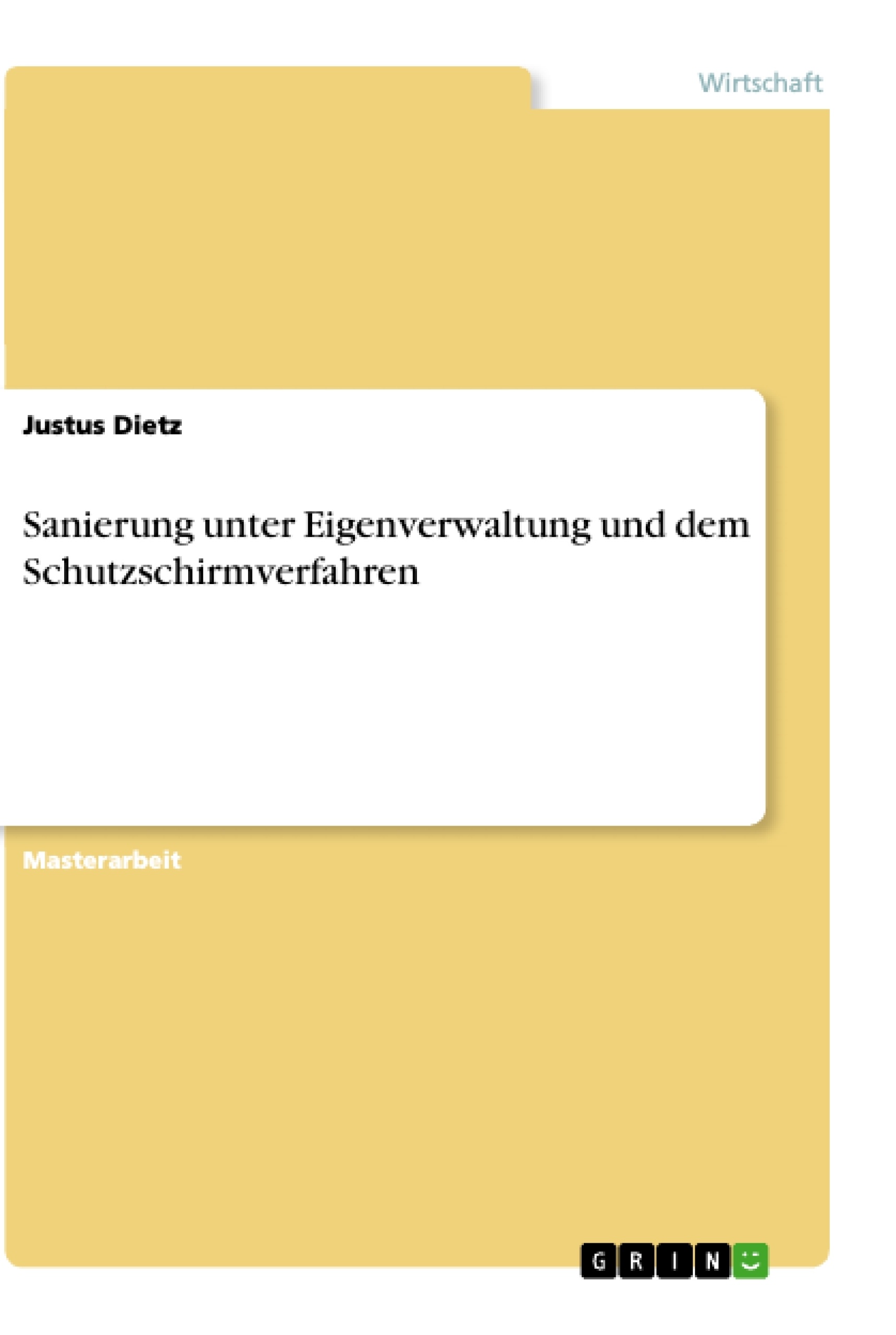Welchen Einfluss hat die Reform des Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes (SanInsFoG) mit dem Kernstück des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) auf die Sanierung unter Eigenverwaltung und dem Schutzschirmverfahren sowie deren Gebrauch? Manifestiert sich der präventive Restrukturierungsrahmen als der Mittelweg zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Sanierung?
Die Definition unternehmerischen Scheiterns soll speziell vor dem Hintergrund der grassierenden Pandemie neu betrachtet werden. Daher wird zuerst der unternehmerische Krisenverlauf im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt und anschließend in die gerichtlichen Sanierungsverfahren übergeleitet. Dabei wird der rechtliche Rahmen erläutert, der gegeben sein muss, um das Regelverfahren der Insolvenz zu umgehen und eine rechtzeitige Einleitung eines Verfahrens unter Eigenverwaltung und dem Schutzschirmverfahren nach §§ 270 ff der Insolvenzordnung beanspruchen und einleiten zu können. Insbesondere wird die neu strukturierte Eigenverwaltung nach § 270 ff. InsO genauer erläutert und im Anschluss unter Berufung auf Experteninterviews genauer diskutiert werden.
Die Kritik an diesen Verfahren, die im Rahmen des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) geschaffen wurden, gepaart mit der Vorgabe der EU-Richtlinie des Europäischen Parlaments zum präventiven Restrukturierungsrahmen führten zu dem zum 01.01.2021 in Kraft getretenen SanInsFoG, dessen Kernteil, das StaRUG, als eine Antwort auf diese Vorgabe und auch situationsbedingt die Pandemie aufgefasst wird. Die wesentlichen rechtlichen und sanierungstechnischen Veränderungen werden, gekoppelt mit der COVID-bedingten Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, erläutert. Im Anschluss soll der Einfluss nochmals kritisch hinterfragt werden, wobei punktuelle Erkenntnisse aus den Experteninterviews mit einbezogen werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Unternehmenskrisen entlang der Ertragskurve
- 2.1 Die Typologie der Unternehmenskrise
- 2.2 Endogene Krisenfaktoren
- 2.3 Exogene Krisenfaktoren
- 2.4 Verlaufsszenario nach R. Müller
- 2.5 Verlaufsszenario nach U. Krystek
- 2.6 Kombination der Verlaufsszenarien
- 3 Insolvenzgründe, -ablauf, -beteiligte und -verfahrensarten
- 3.1 Eröffnungsgründe
- 3.1.1 Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO
- 3.1.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO
- 3.1.3 Überschuldung nach § 19 InsO
- 3.2 Vor- und Nachteile des Insolvenzverfahrens
- 3.3 Zielsetzung und Fortentwicklung des Insolvenzrechts
- 3.4 Wesen und Zielsetzung des Insolvenzverfahrens
- 3.5 Verfahrensbeteiligte
- 3.6 Verfahrensaufbau der Insolvenz im Regel- und Planverfahren
- 3.6.1 Vorläufiges Insolvenzverfahren
- 3.6.2 Regelabwicklung versus Insolvenzplan
- 3.7 Eigenverwaltung nach §§270 ff InsO
- 3.7.1 Vorläufige Eigenverwaltung nach § 270b f InsO
- 3.7.2 Vor- und Nachteile der Eigenverwaltung
- 3.8 Schutzschirmverfahren nach § 270d InsO
- 3.8.1 Einleitung des Schutzschirmverfahrens
- 3.8.2 Anforderungen an die Bescheinigung
- 3.8.3 Vorlage des Insolvenzplans und gerichtliche Prüfung
- 3.8.4 Fortführung der operativen Tätigkeiten im Schutzschirmverfahren
- 3.8.4.1 Masseverbindlichkeiten
- 3.8.4.2 Insolvenzgeldvorfinanzierung
- 3.8.4.3 Interaktion mit Gläubigern
- 3.8.4.4 Zahlungsunfähigkeiten im vorläufigen Verfahren und Aufhebungsgründe
- 3.8.4.5 Rolle des Sanierungsberaters im Schutzschirmverfahren
- 3.8.4.6 Überführung des Sanierungskonzepts in einen Insolvenzplan
- 3.9 ESUG-Evaluation und Schaffung neuer Instrumente
- 3.1 Eröffnungsgründe
- 4 COVID-19 und neue Möglichkeiten zur Sanierung
- 4.2 Insolvenzrechtliche Situation im Zuge der COVID-19-Krise
- 4.2.1 Reaktionen des Gesetzgebers
- 4.2.2 Auswirkungen auf Insolvenzantragspflicht, Eigenverwaltung und Restschuldbefreiung
- 4.2.2.1 Der Schuldnerantrag nach § 1 Satz 1 bis 3 COVInsAG
- 4.2.2.2 Der Gläubigerantrag nach § 3 COVINSAG
- 4.2.2.3 Erhöhte Anforderungen an die Eigenverwaltung
- 4.2.2.4 Auswirkungen auf die Restschuldbefreiung
- 4.3 Ein Überblick über das SanlnsFoG und das StaRUG
- 4.3.1 Insolvenzantragsgründe und Geschäftsleiterpflichten
- 4.3.2 Ein modernes und modulares Restrukturierungsplanverfahren
- 4.4 Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen als Kernelement des StaRUG
- 4.4.1 Der Restrukturierungsplan
- 4.4.1.1 Darstellende Teil des Restrukturierungsplans nach § 6 StaRUG
- 4.4.1.2 Gestaltende Teil des Restrukturierungsplans nach § 7 StaRUG
- 4.4.2 Instrumente des StaRUG nach § 29
- 4.4.2.1 Gerichtliches Planabstimmungsverfahren
- 4.4.2.2 Gerichtliche Vorprüfung
- 4.4.2.3 Stabilisierungsanordnung
- 4.4.2.4 Planbestätigung
- 4.4.2.5 Streichung der Vertragsbeendigung
- 4.4.3 Restrukturierungsbeauftragter
- 4.4.1 Der Restrukturierungsplan
- 4.5 Neuregelung der Geschäftsleiterpflichten und -haftung
- 4.6 Schlussfolgerungen und Einordnung der Experteninterviews
- 4.2 Insolvenzrechtliche Situation im Zuge der COVID-19-Krise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht Sanierungsverfahren unter Eigenverwaltung und dem Schutzschirmverfahren. Ziel ist es, die Verfahren im Kontext des Insolvenzrechts zu analysieren und ihre Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den neuen Möglichkeiten der Sanierung im Zuge der Krise.
- Analyse von Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren im deutschen Insolvenzrecht
- Bewertung der Vor- und Nachteile beider Verfahren
- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Insolvenzverfahren
- Einfluss des StaRUG auf Restrukturierungsmaßnahmen
- Untersuchung der Rolle von Sanierungsberatern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Unternehmensinsolvenz und der Bedeutung von Sanierungsverfahren ein. Sie beschreibt den Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage.
2 Unternehmenskrisen entlang der Ertragskurve: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen und den Verlauf von Unternehmenskrisen. Es werden verschiedene Typologien und Verlaufsszenarien vorgestellt, um die Komplexität von Krisenprozessen zu beleuchten. Endogene (innerbetriebliche) und exogene (außerbetriebliche) Faktoren werden differenziert untersucht und ihre Wechselwirkungen beleuchtet. Die unterschiedlichen Ansätze von Müller und Krystek zum Krisenverlauf werden verglichen und zu einem kombinierten Modell zusammengefügt.
3 Insolvenzgründe, -ablauf, -beteiligte und -verfahrensarten: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Grundlagen der Insolvenz in Deutschland. Es definiert Insolvenzgründe wie Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung (§§ 17, 18, 19 InsO) und detailliert den Ablauf eines Insolvenzverfahrens. Die Rolle der Verfahrensbeteiligten wird erläutert, und die verschiedenen Verfahrensarten (Regelverfahren, Planverfahren, Eigenverwaltung) werden verglichen. Der Fokus liegt auf den Zielen und der Entwicklung des Insolvenzrechts.
4 COVID-19 und neue Möglichkeiten zur Sanierung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Insolvenzrecht und die Unternehmens-sanierung. Es analysiert die gesetzlichen Reaktionen des Gesetzgebers (COVInsAG) und deren Einfluss auf die Insolvenzantragspflicht, Eigenverwaltung und Restschuldbefreiung. Das Kapitel bietet außerdem einen Überblick über das SanInsFoG und das StaRUG und beleuchtet den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen als Kernelement des StaRUG, einschließlich der Instrumente und des Restrukturierungsplans.
Schlüsselwörter
Sanierung, Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, Insolvenzrecht, Insolvenzordnung (InsO), StaRUG, COVID-19, Restrukturierung, Unternehmenskrise, Krisenmanagement, Sanierungsberater, Restschuldbefreiung, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Sanierungsverfahren unter Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert Sanierungsverfahren unter Eigenverwaltung und dem Schutzschirmverfahren im deutschen Insolvenzrecht. Sie untersucht die Vor- und Nachteile dieser Verfahren und beleuchtet insbesondere die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Gesetzesänderungen auf die Möglichkeiten der Unternehmens-sanierung.
Welche Verfahren werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren im Kontext des deutschen Insolvenzrechts. Es werden die rechtlichen Grundlagen, der Ablauf und die beteiligten Akteure dieser Verfahren detailliert beschrieben und verglichen.
Welche Rolle spielt die COVID-19-Pandemie in der Arbeit?
Die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Gesetzesänderungen (z.B. COVInsAG, SanInsFoG, StaRUG) haben einen erheblichen Einfluss auf Insolvenzverfahren und Sanierungsmöglichkeiten. Die Arbeit analysiert diese Auswirkungen auf die Insolvenzantragspflicht, die Eigenverwaltung, die Restschuldbefreiung und die neuen Instrumente zur Restrukturierung.
Was ist das StaRUG und welche Bedeutung hat es für die Arbeit?
Das Gesetz zur weiteren Stärkung der Restrukturierung im Unternehmensbereich (StaRUG) spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit. Es wird untersucht, wie der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen des StaRUG die Möglichkeiten der Unternehmens-sanierung erweitert und welche neuen Instrumente (z.B. Restrukturierungsplan) zur Verfügung stehen.
Welche Insolvenzgründe werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesetzlichen Insolvenzgründe nach der Insolvenzordnung (InsO), insbesondere Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) und Überschuldung (§ 19 InsO).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 (Unternehmenskrisen entlang der Ertragskurve), Kapitel 3 (Insolvenzgründe, -ablauf, -beteiligte und -verfahrensarten) und Kapitel 4 (COVID-19 und neue Möglichkeiten zur Sanierung). Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Unternehmensinsolvenz und -sanierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sanierung, Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren, Insolvenzrecht, Insolvenzordnung (InsO), StaRUG, COVID-19, Restrukturierung, Unternehmenskrise, Krisenmanagement, Sanierungsberater, Restschuldbefreiung, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Sanierungsverfahren unter Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren umfassend zu analysieren und ihre Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bewertung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der neuen Möglichkeiten der Sanierung im Zuge der Krise.
Wer sind die relevanten Akteure in einem Insolvenzverfahren?
Die Arbeit beschreibt die Rolle verschiedener Akteure in Insolvenzverfahren, einschließlich des Schuldners, der Gläubiger, des Insolvenzverwalters und des Sanierungsberaters.
Gibt es einen Ausblick oder Schlussfolgerungen?
Die Arbeit enthält Schlussfolgerungen und eine Einordnung der Ergebnisse basierend auf den analysierten Daten und Experteninterviews (falls vorhanden).
- Quote paper
- Justus Dietz (Author), 2021, Sanierung unter Eigenverwaltung und dem Schutzschirmverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128999