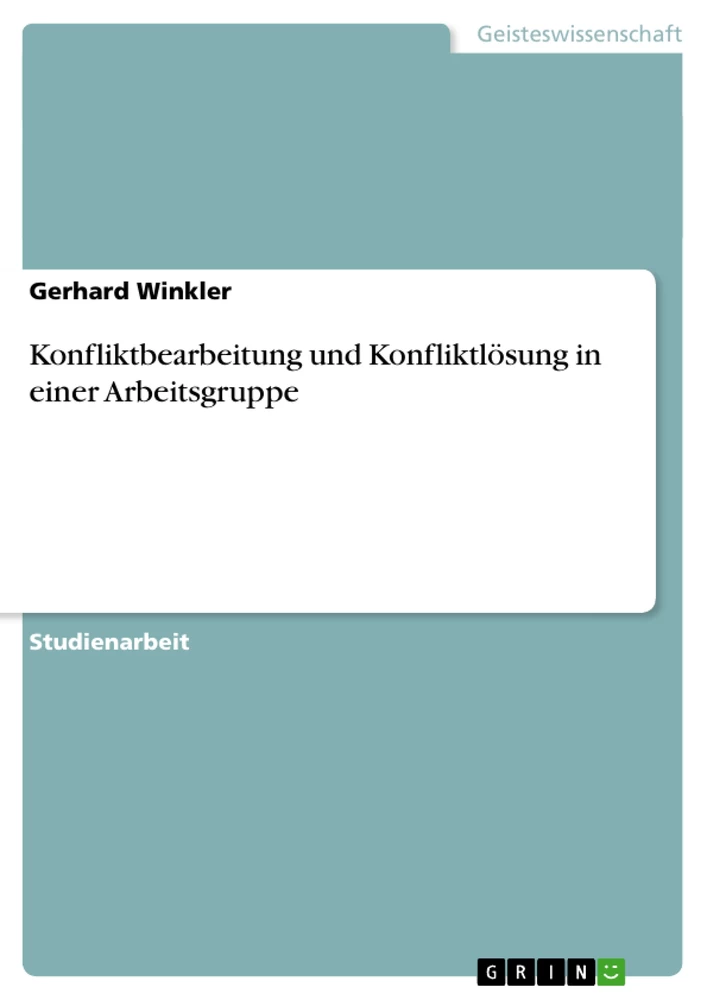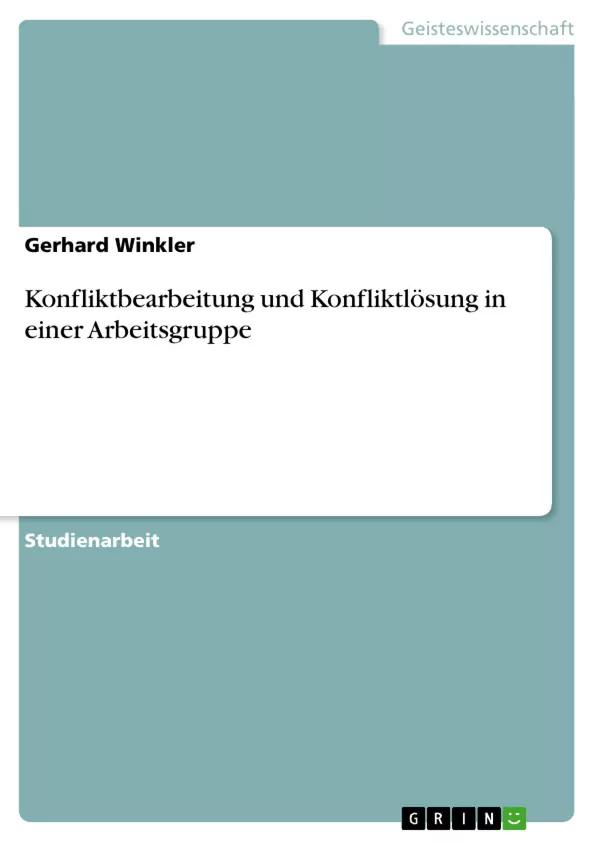Auf Grund des steigenden Konkurrenzdrucks müssen Firmen immer flexibler und anpassungsfähiger werden. Das hat zur Folge, dass Arbeitstechniken, Strukturen und Aufgabenstellungen einem ständigen Wechsel unterliegen, die immer mehr hoch spezialisiertes Fach-wissen erfordern. Zur Erreichung der Ziele gewinnt daher die Arbeit in Gruppen immer weiter an Bedeutung, da die einzelnen Mitglieder ihr unterschiedliches Spezialwissen ergänzen und untereinander abstimmen können.
Durch die enge Zusammenarbeit in Gruppen oder Teams kommt es jedoch durch die verschiedenen Persönlichkeiten, ihr spezielles Wissen, ihre Erfahrungen und Sichtweisen auch unweigerlich zu Spannungen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden dabei durch Sympathie oder Antipathie, eigene Wünsche, Ängste, Ansprüche und Zielvorstellungen ge-prägt. Dies betrifft in noch stärkerem Maße Arbeitsgruppen, die im Zuge eines Montageeinsatzes fern von direkten Vorgesetzten arbeiten und oft problematische Situationen auch außerhalb der Arbeit gemeinsam meistern müssen. Das kann dazu führen, dass schwerwiegende Konflikte aus vermeintlichen Kleinigkeiten entstehen. Rüttinger und Sauer bemerken hierzu, dass die Heftigkeit mancher Konflikte nicht voll verständlich ist, wenn nur die Streitfrage, der Grund der Auseinandersetzung und die gegebene Situation betrachtet werden (vgl. RÜTTINGER/SAUER 2000).
2 Die Gruppe
Der Begriff „Gruppe“ ist allgemein bekannt und wird im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet. Es handelt sich dabei um eine Anzahl von Personen, die sich mehr oder weniger gut kennen. Die Mitglieder einer Gruppe arbeiten gemeinsam in derselben Firma, sind in einem Verein oder einfach unorganisiert eine Menge von Personen, die sich öfters trifft. Überall dort wo Menschen beisammen sind und miteinander kommunizieren sprechen wir von Gruppen. Es sollte noch erwähnt werden, dass die Gruppe eine Mindestdauer bestehen muss um als solche zu gelten, und meist verfolgen die Gruppenmitglieder gemeinsame Ziele. Vom wissenschaftlichen Standpunkt her betrachtet, stellt sich die Frage, wie wird „Gruppe“ definiert, also welche Eigenschaften zutreffen müssen, um von einer Gruppe sprechen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1 Gruppenarbeit und Konflikte – eine Einführung
2 Die Gruppe
2.1 Definition Gruppe
2.2 Arten von Gruppen
2.2.1 Die informelle Gruppe
2.2.2 Die formelle Gruppe
2.2.3 Die Gruppe in der betrieblichen Organisation
3 Konflikte
3.1 Definition Konflikte
3.2 Erscheinungsformen eines Konflikts
3.2.1 Der latente Konflikt
3.2.2 Der offene Konflikt
3.2.3 Der heiße und der kalte Konflikt
4 Der Konfliktverlauf
5 Die Konfliktbewältigung
5.1 Die Phasen der Konfliktbewältigung
5.2 Konfliktbewältigung durch Hinzuziehung eines Dritten
5.3 Verschiedene Modelle zur Konfliktbewältigung
6 Konflikte in einer Arbeitsgruppe – ein Erfahrungsobjekt
6.1 Die Konfliktgruppe und ihre Aufgaben
6.2 Der Konflikt in der Gruppe
6.3 Die Konfliktbearbeitung
7. Bewertung des Konflikts
7.1 Verhalten der Gruppe
7.2 Verhalten der Teammitglieder
7.3 Ursachen für den Konflikt im Team
8. Mögliche Maßnahmen zur Konfliktvermeidung
9. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1 Gruppenarbeit und Konflikte – eine Einführung
Auf Grund des steigenden Konkurrenzdrucks müssen Firmen immer flexibler und anpassungsfähiger werden. Das hat zur Folge, dass Arbeitstechniken, Strukturen und Aufgabenstellungen einem ständigen Wechsel unterliegen, die immer mehr hoch spezialisiertes Fachwissen erfordern. Zur Erreichung der Ziele gewinnt daher die Arbeit in Gruppen immer weiter an Bedeutung, da die einzelnen Mitglieder ihr unterschiedliches Spezialwissen ergänzen und untereinander abstimmen können.
Durch die enge Zusammenarbeit in Gruppen oder Teams kommt es jedoch durch die verschiedenen Persönlichkeiten, ihr spezielles Wissen, ihre Erfahrungen und Sichtweisen auch unweigerlich zu Spannungen. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden dabei durch Sympathie oder Antipathie, eigene Wünsche, Ängste, Ansprüche und Zielvorstellungen geprägt. Dies betrifft in noch stärkerem Maße Arbeitsgruppen, die im Zuge eines Montageeinsatzes fern von direkten Vorgesetzten arbeiten und oft problematische Situationen auch außerhalb der Arbeit gemeinsam meistern müssen. Das kann dazu führen, dass schwerwiegende Konflikte aus vermeintlichen Kleinigkeiten entstehen. Rüttinger und Sauer bemerken hierzu, dass die Heftigkeit mancher Konflikte nicht voll verständlich ist, wenn nur die Streitfrage, der Grund der Auseinandersetzung und die gegebene Situation betrachtet werden (vgl. RÜTTINGER/SAUER 2000).
2 Die Gruppe
Der Begriff „Gruppe“ ist allgemein bekannt und wird im alltäglichen Sprachgebrauch verwendet. Es handelt sich dabei um eine Anzahl von Personen, die sich mehr oder weniger gut kennen. Die Mitglieder einer Gruppe arbeiten gemeinsam in derselben Firma, sind in einem Verein oder einfach unorganisiert eine Menge von Personen, die sich öfters trifft. Überall dort wo Menschen beisammen sind und miteinander kommunizieren sprechen wir von Gruppen. Es sollte noch erwähnt werden, dass die Gruppe eine Mindestdauer bestehen muss um als solche zu gelten, und meist verfolgen die Gruppenmitglieder gemeinsame Ziele. Vom wissenschaftlichen Standpunkt her betrachtet, stellt sich die Frage, wie wird „Gruppe“ definiert, also welche Eigenschaften zutreffen müssen, um von einer Gruppe sprechen zu können.
2.1 Definition Gruppe
Unter Gruppe ist eine überschaubare Anzahl (ab zwei oder drei) von Personen zu verstehen, die sich persönlich gegenüberstehen.
Wenn zwei oder mehr Personen in irgendeiner Beziehung zueinander stehen, bilden sie eine Gruppe (LINDGREN 1973, 347).
Eine Gruppe kann definiert werden als eine Mehrheit von Individuen, die in Kontakt miteinander stehen, aufeinander reagieren und in wesentlichen Punkten Gemeinsamkeiten erleben. (SADER 2002, 38).[1]
Eine sozialpsychologische Gruppe ist ein organisiertes System von zwei oder mehr Individuen, die so miteinander verbunden sind, dass in einem gewissen Grade gemeinsame Funktionen möglich sind, Rollenbeziehungen zwischen den Mitgliedern bestehen und Normen existieren, die das Verhalten der Gruppe und aller ihrer Mitglieder regeln. (SADER 2002, 38).[2]
2.2 Arten von Gruppen
Gruppen dürfen nicht isoliert gesehen werden, sondern im zeitlichen Zusammenhang von Vorgeschichte und in der Umgebung. Mehrfache Gruppenzugehörigkeiten sind die Regel, was zu Widersprüchen und Unvereinbarkeiten führen kann. Gruppengrenzen sind oft unklar und können von den Beteiligten unterschiedlich interpretiert werden. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann fließend sein, oft mit zeitlichen Schwankungen. Gruppen bestehen oft nicht aus einer gleichbleibenden Zahl von Mitgliedern, sondern es sind schnelle Wechsel möglich. In der Literatur finden
sich viele Möglichkeiten um Gruppen zu differenzieren. Sader unterscheidet Gruppen nach der Größe, der zeitlichen Erstreckung, nach dem Lebensalter der Beteiligten, nach der Art der Zusammensetzung und nach der Konstanz der teilnehmenden Mitglieder (vgl. SADER 2002, 40). Die für diese Ausarbeitung wichtigste Unterscheidung ist die Einteilung in informelle und formelle Gruppen.
2.2.1 Die informelle Gruppe
Eine informelle Gruppe ist eine Gruppe „… die durch die informellen Beziehungen, die sich durch Bekanntschaften, privaten Freundschaften, gleichem Herkunftsort, gemeinsamer Vereins- oder Parteizugehörigkeit, gemeinsamer Hobbys usw. … entwickeln“ (BOSETZKY u. a. 2002, 161) definiert. Informelle Gruppen entstehen also nicht durch Organisationsstrukturen, sondern durch persönliche Beziehungen, Interessen und Einstellungen.
2.2.2 Die formelle Gruppe
Im Gegensatz dazu sind formelle Gruppen diejenigen Personen einer Organisation, die unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung infolge der formalen Betriebsstruktur zu Gruppen zusammengefasst werden (vgl. BOSETZKY u. a. 2002, 161). Das Verhalten der formalen Gruppen wird durch übergeordnete Ziele festgelegt oder zu der Erfüllung der Ziele gelenkt (vgl. STRUNZ, 4). Die Führung einer solchen Gruppe liegt in der Hand eines von der Organisationshierarchie vorgegebenen Leiters (vgl. STRUNZ, 12).
2.2.3 Die Gruppe in der betrieblichen Organisation
Offensichtlich wird der Zwangscharakter von Gruppenarbeit, wenn diese aufgrund eines formalen Aktes, an dem die späteren Mitglieder nicht beteiligt sind, eingeführt wird. Bergknapp beschreibt die Schwierigkeiten, die durch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen zustande kommen. „Die Strukturentscheidungen werden von den Mächtigen getroffen. Ob dies auch den Interessen der Zielakteure entspricht, ist dabei zweitrangig. Aus Mangel an formaler Macht haben zwar diese nicht die Möglichkeit, direkten Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen, wohl aber kann die Umsetzung der Entscheidungen durch passive Widerstandsformen erheblich behindert werden. Damit entfällt auch weitgehend das Zugehörigkeitsgefühl als tragendes Systemprinzip, und die emotionale Qualität der Kooperation bleibt prekär“ (BERGKNAPP 2002, 284).
Die Bedingungen die die Organisation vorgibt unterscheiden betriebliche von sozialen Gruppen. Die soziale Gruppe setzt sich im Wesentlichen freiwillig zusammen während die betriebliche Arbeitsgruppe durch die Organisation bestimmt wird. Esser betont die Notwendigkeit und den Sinn der Arbeitsgruppe „Dies ist zum einen organisational intendiert, denn wäre die Gruppen- mit der Organisationsstruktur identisch, entfiele ein zentraler Vorteil von Gruppenarbeit: die erhöhte Flexibilität und Kreativität aufgrund offener Strukturen“ (ESSER 1975, 106).
Auch bei Keese finden sich Hinweise auf die Spannungen die durch die zwangsweise zusammengestellten Gruppe, er spricht von der Verengung der (informellen) Spielräume der Akteure, aufgrund deren „… das Unterlaufen von Vorgaben, die vor Ort als unpraktisch, unsinnig oder unerfüllbar erscheinen – zumindest bis zu einem gewissen Grad – thematisiert werden“ (BERGKNAPP 2002, 289)[3] müssen. Durch die Einführung von Gruppenarbeit werden aber auch neue Spielräume geschaffen, häufig fehlen fest definierte Vorgaben, dadurch bieten sich günstige Gelegenheiten “(…) für einzelne Individuen oder Personengruppen, durch mikropolitisches Agieren ungeachtet der allgemeinen betrieblichen Zielsetzungen Vorteile auszuhandeln bzw. durch das Spiel mit Machtpotentialen zu erkämpfen“ (BERGKNAPP 2002, 289).[4]
3 Konflikte
Durch das Aufeinandertreffen von zwei unvereinbaren Interessen können Konflikte entstehen die in unterschiedlichen Formen auftreten. Die wesentlichen Ursachen für die Entstehung eines Konflikts sind grundsätzliche Unterschiede in den Zielen, Einstellungen, Werten oder Normen,
Gründen die in den Personen selbst zu suchen sind, Kommunikationsdefizite und unterschiedlicher Informationsstand, sowie die Organisation und deren Strukturen.
3.1 Definition Konflikte
Der Begriff Konflikt kommt vom lateinischen „confligere“ und bedeutet zusammenstoßen, kämpfen.
Für den Konflikt sind verschiedene Definitionen bekannt:
Dahrendorf nennt die soziologische Sichtweise, nach dieser ist ein Konflikt jede Beziehung zwischen Elementen, die sich durch latente und manifeste Gegensätzlichkeiten kennzeichnen lässt. Der Gegensatz kann bewusst oder bloß erschließbar, gewollt oder nur situationsbedingt sein (vgl. DAHRENDORF 1961, 201f).
Eine psychologische Sichtweise zeigt Drever auf. Er bezeichnet damit einen Zustand, der dann auftritt, wenn zwei einander entgegen gerichtete Handlungstendenzen oder Motivationen zusammen auftreten und sich als Alternativen in Bezug auf ein Ziel möglichen Handelns im Erleben des Betroffenen äußern. Dieses Erleben führt zu Spannungen emotionaler Art, die oft als unangenehm empfunden werden (vgl. FRÖHLICH/DREVER 1981, 204).
Bei Kirsch wird der Konflikt unter dem betriebswirtschaftlichen Aspekt betrachtet. Ein Konflikt besteht dann, wenn „… zwei oder mehr Entscheidungsträger nicht gleichzeitig die in ihrem Sinne optimale oder befriedigende Alternative realisieren können“ (KIRSCH 1977, 71).
[...]
[1] zitiert nach OLMSTED 1959, 21
[2] zitiert nach MCDAVID / HARARI 1968, 237
[3] zitiert nach KEESE 1995, 354
[4] zitiert nach KEESE 1995, 354
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer formellen und einer informellen Gruppe?
Formelle Gruppen werden durch die Organisationsstruktur vorgegeben, um Ziele zu erreichen. Informelle Gruppen entstehen spontan durch persönliche Beziehungen, Sympathien oder gemeinsame Hobbys.
Wie entstehen Konflikte in Arbeitsgruppen?
Ursachen sind oft unterschiedliche Ziele, Werte oder Normen, Kommunikationsdefizite sowie Spannungen durch Sympathie oder Antipathie zwischen den Mitgliedern.
Was versteht man unter einem "latenten Konflikt"?
Ein latenter Konflikt ist unterschwellig vorhanden, aber noch nicht offen ausgebrochen. Er äußert sich oft durch Spannungen oder passive Widerstände.
Welche Phasen durchläuft die Konfliktbewältigung?
Der Prozess umfasst die Erkennung des Konflikts, die Analyse der Ursachen, die Suche nach Lösungen und die Umsetzung von Maßnahmen zur Beilegung.
Wann ist die Hinzuziehung eines Dritten bei Konflikten sinnvoll?
Wenn die Fronten verhärtet sind und die Gruppe selbst keine Lösung mehr findet, kann ein neutraler Dritter (Mediator) helfen, den Dialog wiederherzustellen.
- Citar trabajo
- Dipl. Informatiker (FH) Gerhard Winkler (Autor), 2007, Konfliktbearbeitung und Konfliktlösung in einer Arbeitsgruppe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112898