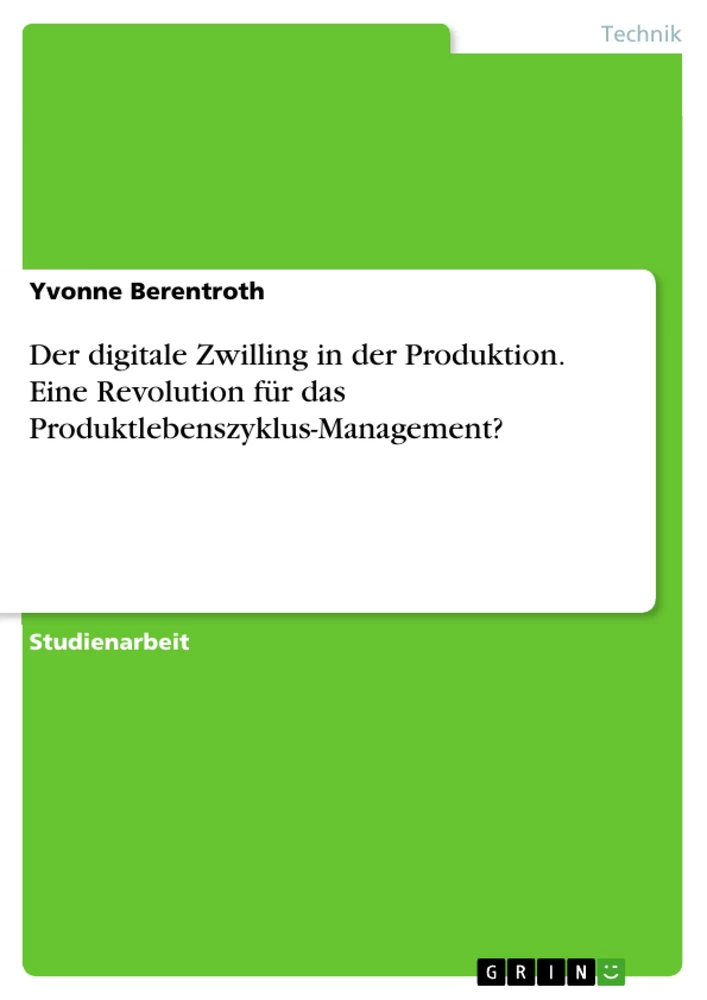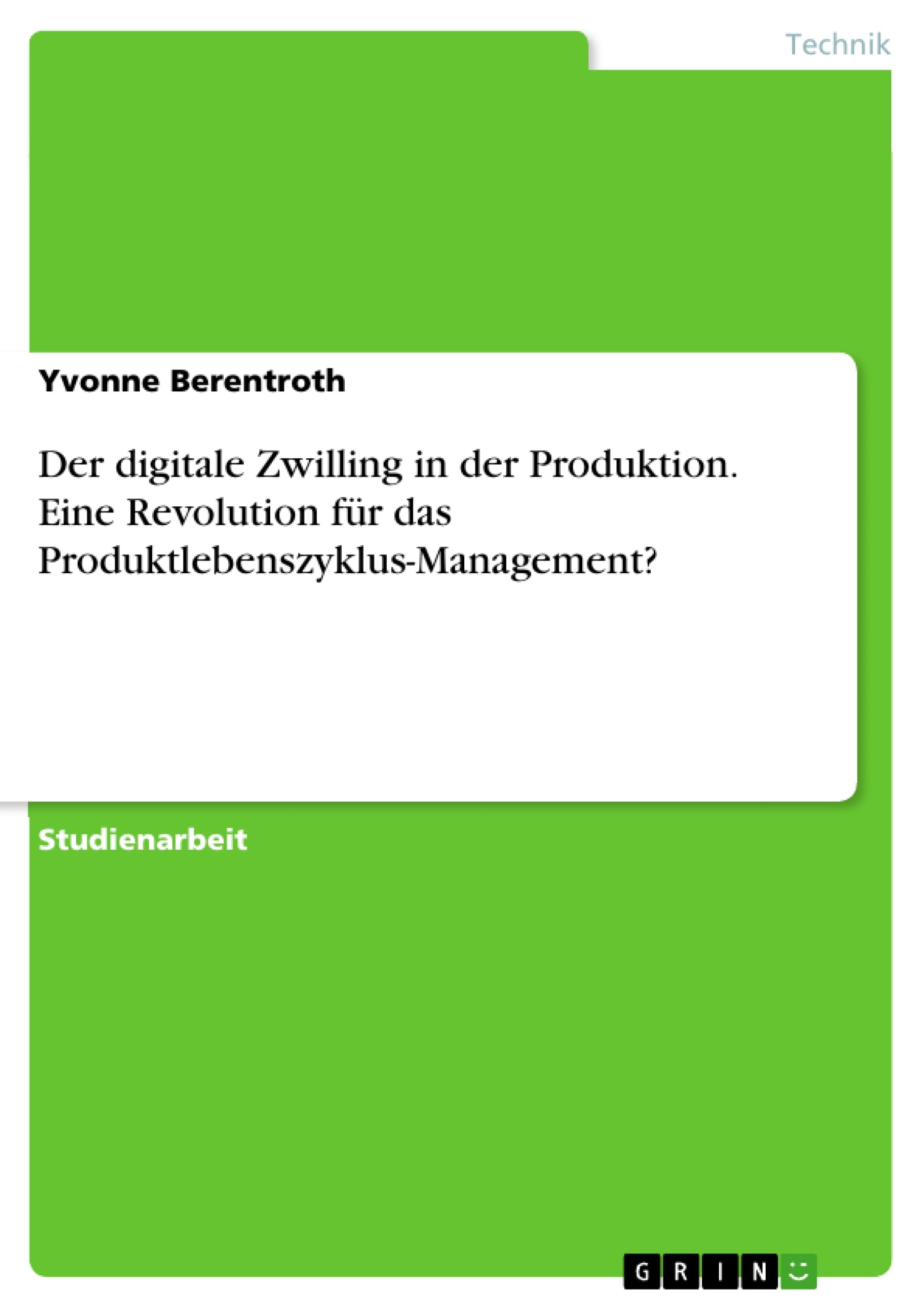Diese Arbeit hat das Ziel, eine Definition des digitalen Zwillings, auch digital Twin genannt, aufzustellen. Darauf aufbauen wird der technische Hintergrund erläutert sowie der aktuelle Status quo ermittelt. Ebenfalls sollten die Voraussetzungen für dessen Einsatz aufgezeigt werden. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Produktlebenszyklus Management, kurz PLM. Welche Voraussetzungen sind für die Implementierung notwendig und welche Phasen beinhaltet dieses. Auch soll ein kurzer Blick auf zukünftige Veränderungen durch den digitalen Umbruch geworfen werden.
Die sog. vierte industrielle Revolution ist geprägt von den Schlagwörtern disruptive Technologien und Digitalisierung. Im Vordergrund steht hierbei die Vernetzung zwischen Objekten und Menschen auf verschiedenen Ebenen. Auch bekannt unter Industrie 4.0 erlebt die Arbeitswelt einen Wandel, den es als Unternehmen gilt mitzugestalten und umzusetzen. Hierbei stellt vor allem das Internet of Things aufgrund der großen, verfügbaren Menge von Daten, die Branche vor vermeintlich unlösbaren Herausforderungen. Oft werden diese zwar erhoben, jedoch nicht vollumfänglich genutzt. Als Lösung, vor allem im Bereich des Produktlebenszyklus Managements, soll hier der digitale Zwilling helfen. Dabei ist vielen Unternehmen die große Brandbreite an Einsatzmöglichkeiten nicht bewusst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Digitaler Zwilling
- 2.1.1 Definition und technische Voraussetzungen
- 2.1.2 Aktueller Status Quo und Herausforderungen
- 2.2 Produktlebenszyklus Management
- 2.2.1 Definition und Kernkompetenzen
- 2.2.2 Phase des Produktlebenszyklus
- 2.2.3 Wandel des Produktlebenszyklus Management in der Industrie 4.0
- 2.1 Digitaler Zwilling
- 3 Das Produktionslebenszyklusmanagement
- 3.1 Einsatzbereiche des digitalen Zwillings entlang des Produktlebenszyklus
- 3.2 Anwendungsbeispiele
- 3.2.1 Siemens - Smart Factory
- 3.2.2 Detecon - Immobilienmanagement
- 3.3 Chancen und Risiken
- 3.3.1 Vorteile des digitalen Zwillings
- 3.3.2 Herausforderungen bei der Implementierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit dem digitalen Zwilling und seiner Bedeutung im Kontext des Produktlebenszyklus Managements (PLM). Das Ziel ist es, die Funktionsweise des digitalen Zwillings zu erläutern, seine technischen Voraussetzungen aufzuzeigen und seine Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedenen Phasen des PLM zu untersuchen. Zudem werden die Chancen und Herausforderungen der Implementierung eines digitalen Zwillings in Unternehmen beleuchtet.
- Definition und technische Voraussetzungen des digitalen Zwillings
- Aktuelle Herausforderungen und der Status Quo der Implementierung
- Definition und Kernkompetenzen des Produktlebenszyklus Managements
- Anwendungsbeispiele des digitalen Zwillings in der Praxis
- Chancen und Risiken des Einsatzes des digitalen Zwillings
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema des digitalen Zwillings im Kontext der Industrie 4.0 und seiner Bedeutung für das Produktlebenszyklus Management. Im zweiten Kapitel werden die Definition und die technischen Voraussetzungen des digitalen Zwillings sowie der aktuelle Stand seiner Implementierung in Unternehmen erläutert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Produktlebenszyklus Management, seinen Kernkompetenzen und den verschiedenen Phasen. Hierbei wird auch der Einfluss der Industrie 4.0 auf das PLM thematisiert. Das vierte Kapitel untersucht die Einsatzbereiche des digitalen Zwillings entlang des Produktlebenszyklus und präsentiert zwei praxisnahe Anwendungsbeispiele.
Abschließend werden die Chancen und Risiken des digitalen Zwillings für das PLM diskutiert, um eine abschließende Bewertung zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Digitaler Zwilling, Digital Twin, Produktlebenszyklus Management, PLM, Industrie 4.0, Internet of Things, IoT, Smart Factory, Datenanalyse, Prozessoptimierung, Chancen, Risiken, Implementierung.
- Quote paper
- Yvonne Berentroth (Author), 2021, Der digitale Zwilling in der Produktion. Eine Revolution für das Produktlebenszyklus-Management?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128916