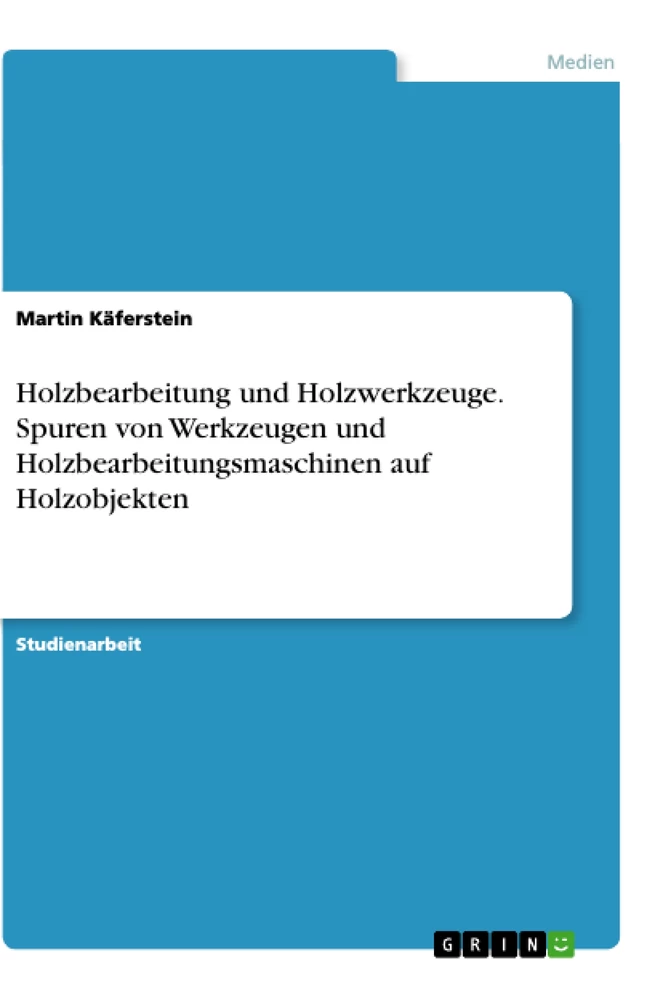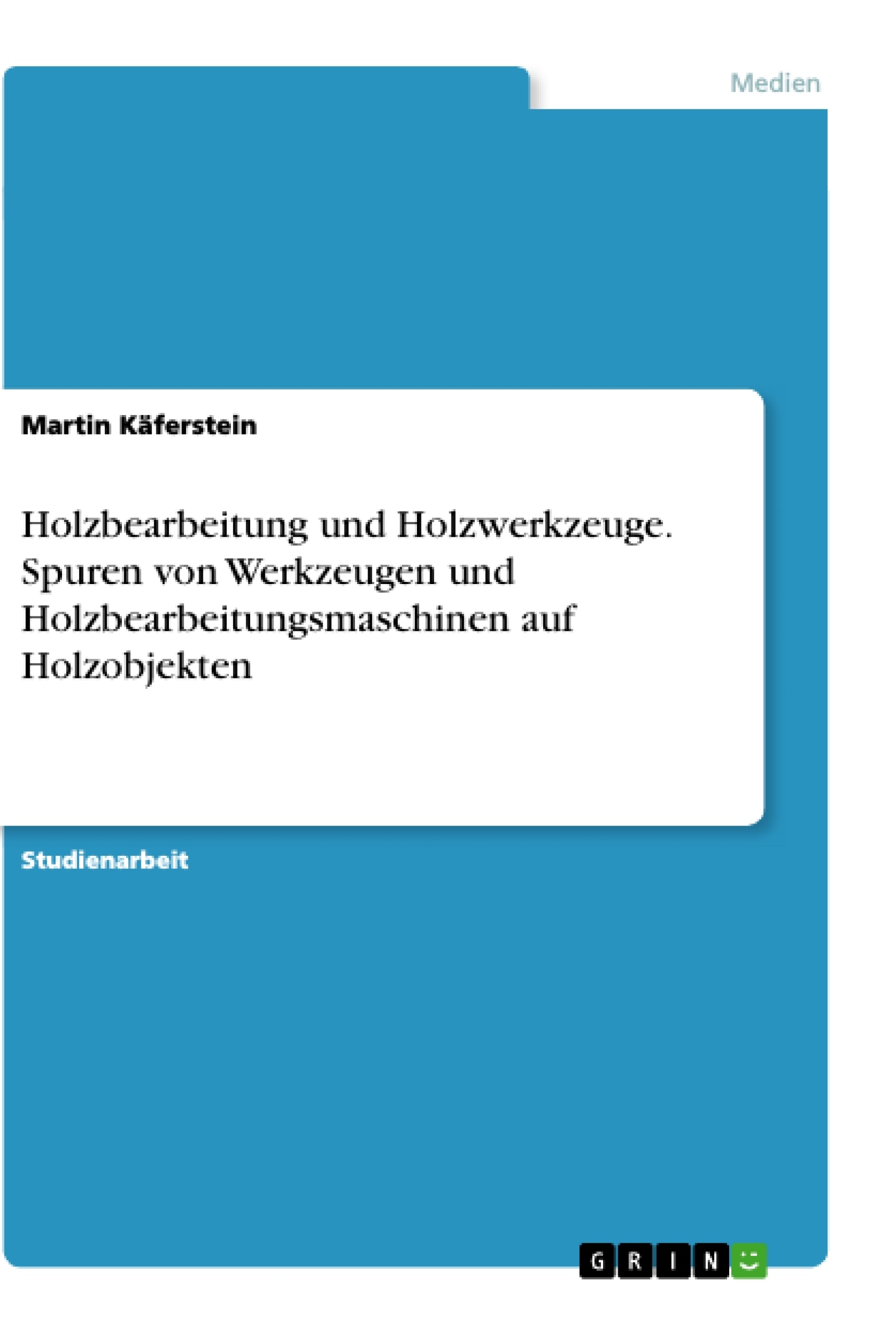Diese Arbeit befasst sich aus kunsthistorischer und aus konservatorischer Sicht mit den Spurren, die Holzwerkzeuge bei der Bearbeitung von Holzobjekten hinterlassen.
Ebenso alt wie die Bearbeitung des Werkstoffes Holz mit Werkzeugen sind die dem unsensibilisierten Auge verborgenen Spuren, die Werkzeuge auf Holzoberflächen hinterlassen - vom Faustkeil bis zur CNC-gesteuerten Oberfräse. Unter Spuren werden nachfolgend alle regel- oder unregelmäßigen Strukturen verstanden, die Handwerkzeuge und Holzbearbeitungsmaschinen mit zerspanender oder spanabhebender Wirkung oder allein durch äußeren Druck zwangsläufig auf dem weicheren Material Holz hinterlassen. Neben mikroskopisch sichtbaren „Quetschungen“ von Holzfasern zählen zu den Spuren auch Markierungen von Schreibwerkzeugen wie Blei- oder Rötelstiften (Farbmittelauftrag und Druckwirkung) und Anreißwerkzeugen wie Reißnadeln oder -ahlen (Kombination von Druck- und Schneidwirkung), die zum Beispiel an handwerklich hergestellten Möbeln wichtige Informationen über den Herstellungsprozess liefern können. Gelingt die Interpretation einer solchen Spur, kann diese neben naturwissenschaftlichen Untersuchungen und stilistischen Merkmalen zum Beispiel einen Anhaltspunkt zur Datierung liefern. Hierzu muß die Spur vor dem Hintergrund einer technikgeschichtlichen Entwicklung der Handwerkzeuge und Maschinen "synoptisch gelesen" werden. Für die Herstellungszeit von Kulturgut lässt sich mit dieser Methode ein terminus post quem bestimmen, wenn die zeitliche Verwendung einzelner Werkzeuge und Bearbeitungsmaschinen bekannt ist.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1 Spuren zerspanender Werkzeuge und Maschinen
1.1 Rahmensäge
1.2 Handsägen
1.3 Kreissäge
1.4 Bandsäge
2 Spuren spanabhebender Werkzeuge und Maschinen
2.1 Nuteisen
2.2 Ratter-oder Hobelmarken
2.3 Schrupphobel
2.4 Hobelmaschine
2.5 B eschlagspuren
2.5.1 Dechselspuren
2.6 Stemm-und Stecheisen
2.7 Bohrer
3 Markierungen
3.1 Farbmittelauftrag
3.2 Anreißspuren
4 Sonstige Spuren
4.1 Messerschnitt
4.2 Brandstempel
4.3 Aufspalten von Holz
4.4 Handschleifmaschine
5 Quellen
5.1 Literatur
5.2 Bildnachweis
Einführung
Neben den klassischen Werkzeugmonographien von G. Heine (1990), R.A. Sa- laman (1997) und H.-T. Schadwinkel / G. Heine (1999), den im 19. Jahrhundert aufkommenden Werkzeugkatalogen einzelner Hersteller, die wichtige Informationen über Werkzeugtypen und Verkaufspreise enthalten, und Darstellungen zur technikgeschichtlichen Entwicklung der Holzbearbeitung (e.g. E. Finsterbusch / W. Thiele 1987), finden sich kaum Veröffentlichungen, in denen Werkzeuge, bzw. Holzbearbeitungsmaschinen und die Spuren gegenübergestellt werden, die sie, ob Faustkeil oder CNC-gesteuerte Oberfräse, bei jeder Holzbearbeitung zwangsläufig hinterlassen. Nicht immer sind diese mit bloßem Auge zu erkennen, wie zum Beispiel „Quetschungen“ von Holzfasern.
Unter Spuren werden nachfolgend alle regelmäßigen oder unregelmäßigen Strukturen verstanden, die Werkzeuge und Holzbearbeitungsmaschinen mit spanender oder schneidender Wirkung oder durch äußeren Druck auf Holz hinterlassen. Dazu zählen auch Spuren von Schreibwerkzeugen (Farbmittelauftrag und Druckwirkung) und Anreißwerkzeugen (Kombination von Druck- und Schneidwirkung), mit denen für den Herstellungsprozeß wichtige Markierungen auf Holzobjekten vorgenommen wurden, sowie Spuren von Werkzeugen mit thermischer Wirkung wie z.B. Brandstempel.
Das Wort Werkzeug bezeichnet jene Arbeitsgeräte, die, wie etwa die Zange, der Hammer, die Raspel, die Feile, die Säge, der Hobel, die Maurerkelle, das Schustermesser, der Drehbohrer, das Polierrad oder der Winkelhaken der Drucker von der Hand des Arbeitenden bewegt werden. Alle übrigen Arbeitsgeräte wie die Hobelbank, der Knecht der Schreiner, der Amboss der Schmiede, der Schraubstock der Schlosser oder die Satzform der Drucker sind eher Geräte als Werkzeuge. Das gleiche gilt auch für die von einem Motor angetriebenen Geräte, die durch direkte Einwirkung auf das Material der Herstellung von Gütern dienen, ohne daß sie von einem Arbeiter geführt, gelenkt oder gehandhabt werden. Diese nennen wir Maschinen, Apparate, Instrumente.1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 1: (Englische) Werkzeuge und Arbeitsgeräte des Tischlers, die z T charakteristische Spuren auf Werkstücken hinterlassen, um 1678, in ihrer Grundform seit der Antike bis heute nahezu unverändert. (Aus: Moxon, J.: Mechanick exercises 3rd ed London 1703) Gelingt eine eindeutige Interpretation einer Bearbeitungsspur, kann diese - neben stilistischen Kriterien und Material Untersuchungen - einen Anhaltspunkt bei der Datierung von Holzobjekten liefern. Für die Entstehung von Holzobjekten läßt sich ein Terminus ante quem2 3 oder ein Terminus post quem2 festlegen, wenn die zeitliche Verwendung einzelner Werkzeuge und Bearbeitungsmaschinen genau bekannt ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Em Terminus ante quem läßt sich bestimmen, wenn an einem Holzobjekt Spuren von Werkzeugen oder Maschinen vorkommen, die nach einer bestimmten Zeit nur noch selten oder überhaupt nicht mehr verwendet wurden. Emen Terminus post quem ergeben die Spuren von Werkzeugen oder Maschinen, die vor einem bestimmten Zeitpunkt nicht bekannt oder in Gebrauch waren.
Berücksichtigt werden muß dabei die territorial unterschiedliche zeitliche Verbreitung bestimmter Werkzeuge und Maschinen zum Beispiel wurde bereits 1844 in Amerika die Hobelmesserwelle erfunden und fand dort rasche Verbreitung, während man in Deutschland zu dieser Zeit den Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen noch zaghaft probte und beim größten Teil der Tischler noch Handarbeit vorherrschte. Im Handbuch für Sägemüller, 1877 vom amerikanischen Werkzeughersteller Henry Disston & Söhne in Philadelphia für den deutschen Markt herausgegeben, sind Holzbearbeitungsmaschinen abgebildet, die den Vorsprung der amerikanischen Werkzeug- und Maschmenindustrie vor den deutschen Herstellern um mehrere Jahrzehnte belegen.
In den Spuren von Werkzeugen und Maschinen manifestieren sich technikgeschichtliche und damit kulturgeschichtliche Informationen.
Sie können Aufschluß über den Herstellungsprozeß und das Zustandekommen von Holzobjekten geben, aber auch über Arbeitsbedingungen zu bestimmten Zeiten.
Werkspuren lassen Aussagen über die Authentizität von Holzobjekten und von einzelnen Teilen zu. Insgesamt stellen sie also historische Zeugnisse dar, die zu erhalten sind.
Auf die Nachahmung historischer Werkspuren bei Fälschungen, wie sie im Kunsthandel an Holzobjekten anzutreffen sind, und die Unterscheidung von echten und „gefälschten“ Werkspuren wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden einige Werkspuren vorgestellt, um deren Wahrnehmung zu fördern - frei nach dem Spruch: Man sieht nur, was man kennt.
1 Spuren zerspanender Werkzeuge und Maschinen
1.1 Rahmensäge
Die Klobsäge ist die größte der gespannten Rahmensägen und wurde von zumeist zwei4 Zimmerleuten oder berufsmäßigen Sägern zum Auftrennen von Stammholz der Länge nach zu Balken, Bohlen und Brettern, von Tischlern aber auch zum Aufschneiden von Edelholzstämmen zu Furnieren bis ca. 5 mm Stärke verwendet. Sie besitzt ein relativ breites Sägeblatt von 120 bis 130 mm, das einen geradlinigen Sägeschnitt ermöglicht, und eine Sägeblattlänge von 1200 bis 1500 mm.
Ihr Gebrauch läßt sich vom klassischen Altertum anhand von Darstellungen auf Mosaiken, Fresken, Gefäßen und Grabdenkmalen über die Graphiken des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit bis zu den noch erhaltenen Exemplaren des 18., 19. und 20. Jahrhunderts fast lückenlos verfolgen.5
Meist wurde der Rahmen mit dem Sägeblatt von zwei Männern waagerecht geführt, während der Stamm stehend eingespannt war. Nur zur Herstellung langer Bretter oder Bohlen lag der Stamm auf Böcken, während die Sägenden auf und unter dem Stamm standen. Dies geschah meist in langen Gruben, die wegen Raummangel außerhalb der Stadtmauern lagen; die Säge schnitt dann nur beim Niedergang.6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Zimmerleute, die mit der großen Rahmensäge an Ort und Stelle Bretter und Balken für den Hausbau herstellen (um 1530).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 3: Unterseite eines Regalunterbodenbrettes in der Goldenen Kammer (um 1700) der Kirche St. Ursula / Köln. Deutlich zu erkennen ist das Zusammentreffen der beiden Sägerichtungen in der Balkenmitte, dem eine Umlagerung des Balkens, aus dem das Brett geschnitten wurde, auf den Böcken vorausging.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Ausschnitt einer Brettertür (um 1800) in Brandenburg / Havel mit (ebenfalls) im Winkel von ca. 80° zur Brettkante verlaufenden, unregelmäßigen Sägespuren einer Rahmensäge
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Unterseite eines 3 bis 4 mm dicken Kirschbaum- fumiers von einem Schreibsekretär von 1821, die neben unregelmäßigen Spuren des Aufsägens von Hand auch Spuren eines Zahnhobeleisens zeigt.
1.2 Handsägen
Handsägen sind ungespannte Sägen wie Fuchsschwänze und Stich- o. Lochsägen, die im Vergleich zu den gespannten Sägen relativ unregelmäßige Sägespuren hinterlassen.
Auf Darstellungen ist der Gebrauch von Fuchsschwanzsägen seit dem 17. Jahrhundert belegt, der von kürzeren, schmalen Sägen mit geradem Heft, d.h. von stich- oder lochsägenähnlichen, seit dem Mittelalter.7
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Spuren einer Handsäge
1.3 Kreissäge
Der erste urkundliche Nachweis einer Säge mit allen wesentlichen Merkmalen einer Kreissäge ist die Patentschrift des Segelmachers Samuel Miller (British Patent Nr. 1152) aus Southampton aus dem Jahr 1777. In den modernsten Holzbearbeitungsbetrieben der damaligen Zeit, den mechanischen Holzwerkstätten und Schiffswerften zu Woolwich, Chatham und Portsmouth, zählte die neue Maschine schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Standardausrüstung.8
Über fast drei Jahrzehnte hinweg war sie eigentlich nur in England zu Hause, in dem Land, wo sie erfunden und schnell zu voller Funktionsreife gebracht worden war.9
Auf dem europäischen Kontinent tauchte die Kreissäge zuerst seit etwa 1840 in Fumierfabriken auf (s. auch Plena 2000, Abb. 17, S. 31), wohl erst seit 1880 fand sie allgemeine Verbreitung in den Sägewerken.10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 7: Schnittspuren einer Kreissäge
1.4 Bandsäge
Nach einer ersten Konzeption einer „Säge ohne Ende'" (Patent von W. Newberry 1808) wurden die ersten funktionsfähigen (kleineren) Bandsägen 1855 auf der ersten Pariser Weltausstellung von der französischen Firma Perin vorgeführt. Mit ihrem dünnen Blatt hinterläßt sie nur wenig Sägespäne und eignet sich zudem für geschweifte Schnitte. In Nordamerika ist sie seit 1864 bekannt, auf dem europäischen Kontinent um 1875 in allen größeren Holzbearbeitungsbetrieben anzutreflfen.11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Spuren einer Bandsäge. Typisch sind die sauber vertikal verlaufenden, sehr regelmäßigen und sich rauh anfühlenden Schnittspuren des umlaufenden Bandsägeblattes, die sich z.B an den Innenseiten geschweifter Möbelteile aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden.
2 Spuren spanabhebender Werkzeuge und Maschinen
2.1 Nuteisen
An einem Holzstück einer Spundwand aus Haithabu / Schleswig (um 900 n. Chr), aber auch an gotischen Truhen der Lüneburger Heideklöster finden sich auf dem Boden von Nuten für Nut- und Federverbindungen keine eckigen, son - dem rundlich gestaltete Ausgründungen mit einer kleinen „Nase“ (s. Abb. 9), die auf die Verwendung eines Nuteisens (s. Abb. 10) schließen lassen. Dieses wohl zum Körper des Handwerkers hin, ziehend geführte Werkzeug besteht aus einer leicht gebogenen, rechteckigen Eisenstange von etwa 15 mm Breite und 400 mm Länge, in deren Mitte im rechten Winkel ein Holzgriff angebracht ist. Beide Enden der Eisenstange sind zu dünnen Klingen ausgeschmiedet, seitlich umgebogen und an den zum Griff hinzeigenden Seiten zu Schneiden geschärft. Durch ständiges Wenden des Nuteisens schneidet es mit der jeweils unteren Klingenrundung einmal von rechts und einmal von links die Nuten in das Holz ein, wodurch die „Nase“ am Boden der Nuten entsteht. Viele Nuten sind auch nicht von einem Ende der Bohle bis zum anderen Ende durchgezogen worden.
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verschwand nicht nur das Nuteisen, sondern auch die mit diesem Werkzeug ausgeführte Holzverbindung der Spundung zwischen den Bohlen von Holzdecken und Holzwänden.12
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Nut mit „Nase“ auf dem Boden. Teil einer Spundwand aus Haithabu / Schleswig.
[...]
1 vgl. Larousse, Pierre: Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Paris 1876
2 „spätestmöglicher Entstehungszeitpunkt“
3 „frühestmöglicher Entstehungszeitpunkt“
4 Es gibt auch Ausführungen für vier Arbeiter.
5 vgl. Heine 1990, S. 98
6 Bemt 1939, S. HO
7 vgl Heine 1990, S 90
8 vgl Heine 1990, S 90
9 vgl Heine 1990, S 90
10 vgl Heine 1990, S 90
11 vgl Heine 1990, S 90
12 vgl Stülpnagel 2000, S 19, S. 23
- Quote paper
- Martin Käferstein (Author), 1999, Holzbearbeitung und Holzwerkzeuge. Spuren von Werkzeugen und Holzbearbeitungsmaschinen auf Holzobjekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128747