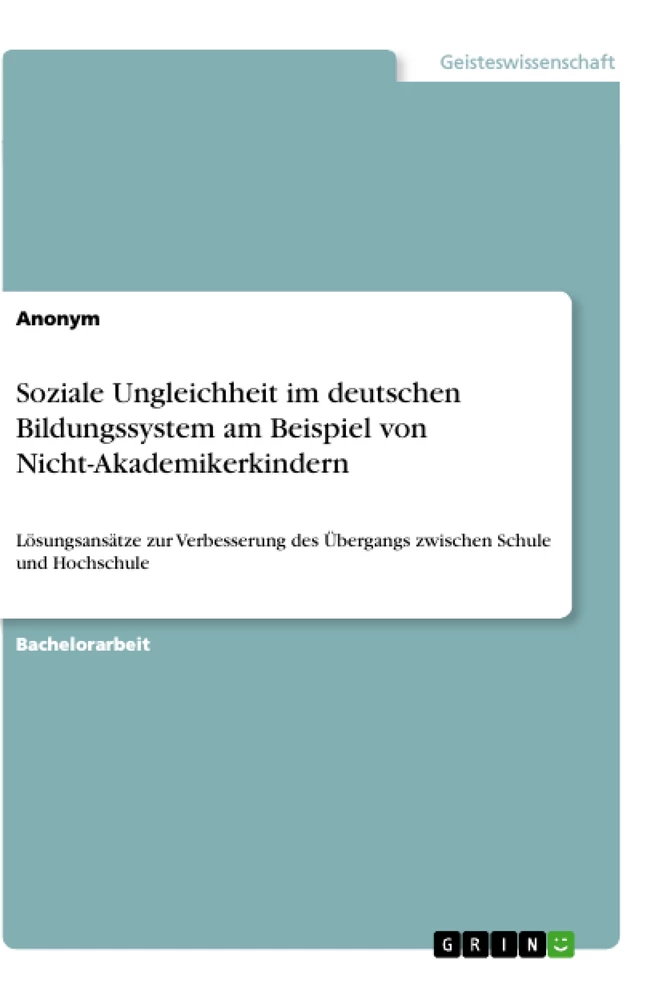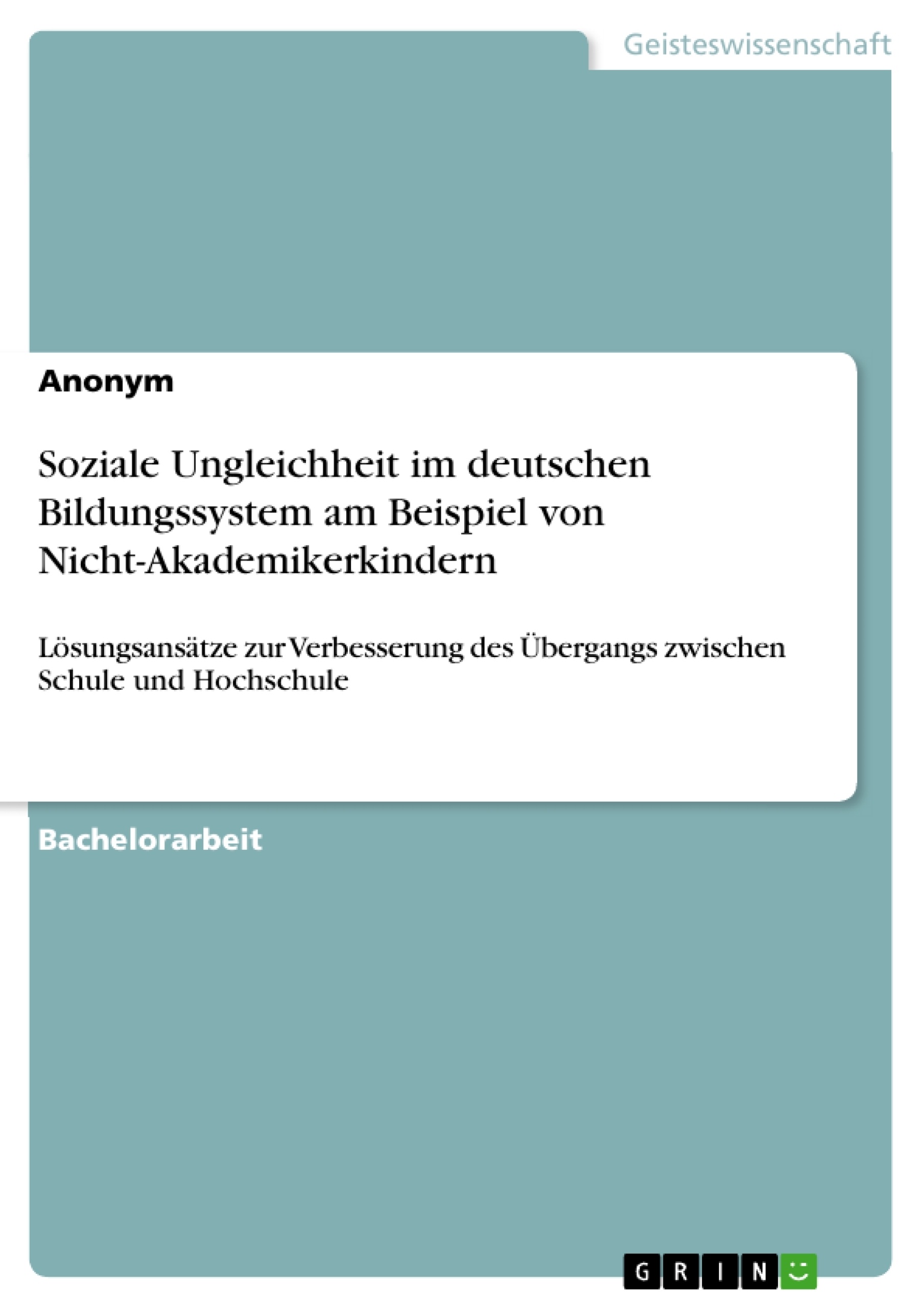Diese Arbeit untersucht die Frage, wie die Entscheidung zur Aufnahme eines Hochschulstudiums für Nicht-Akademikerkinder in Deutschland positiv beeinflusst werden kann. Bevor dieser Frage nachgegangen werden kann, müssen in diesem Zusammenhang zunächst folgende weitere Fragen beantwortet werden: Wodurch entsteht soziale Ungleichheit für Nicht-Akademikerkinder? Wie sieht deren aktuelle Situation im Bildungssystem aus? Sind Maßnahmen tatsächlich nötig? Im Mittelpunkt der Arbeit sollen Ansätze stehen, mit denen soziale Ungleichheit für Nicht-Akademikerkinder reduziert werden kann. Dabei wird hauptsächlich der Übergang von der Schule zur Hochschule in den Blick genommen. Ziel der Arbeit ist es, geeignete Lösungsansätze für den Abbau von sozialer Ungleichheit von Nicht-Akademikerkindern herauszustellen.
Kinder treten, je nach sozialer Herkunft, mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Bildungssystem ein. So haben Nicht-Akademikerkinder häufig ein geringeres Kompetenzniveau als Akademikerkinder. Nicht-Akademikerkinder werden darüber hinaus an verschiedenen Stellen des Bildungssystems benachteiligt und damit selektiert. Beispielsweise werden beim Übergang von der Grundschule in den Sekundarbereich I für Kinder aus nichtakademischen und akademischen Elternhäusern unterschiedliche Empfehlungen für weiterführende Schulen ausgesprochen, trotz gleicher Schulleistungen. Die Benachteiligungen haben Auswirkungen auf den Erfolg von Nicht-Akademikerkindern im Bildungssystem. Nur selten schaffen sie es in die gymnasiale Oberstufe und damit auch an die Hochschule. Haben es Nicht-Akademikerkinder trotz Hindernissen geschafft, die Hochschulzugangsberechtigung zu erlagen, bedeutet dies nicht automatisch die Aufnahme eines Studiums. Im Gegensatz zu Akademikerkindern entscheidet sich nur ein kleiner Teil für den Hochschulbesuch. Dadurch bleibt ihnen oftmals ein Bildungsaufstieg verwehrt. Es ist wahrscheinlicher, dass dieselbe soziale Lage reproduziert wird. Dies deutet auf eine soziale Ungleichheit im Bildungssystem hin. Das Thema soziale Ungleichheit ist noch immer aktuell, dies wird u.a. durch die empirischen Ergebnisse von PISA und der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks belegt. Daher kann angezweifelt werden, ob Deutschland den oben genannten Ansprüchen in der Realität tatsächlich gerecht wird. Das Thema ist somit relevant, da jeder Mensch in einer demokratischen Gesellschaft dieselben Chancen auf Ausstieg durch Bildung haben sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN
- 2.1 DEFINITION SOZIALE UNGLEICHHEIT
- 2.2 DEFINITION NICHT-AKADEMIKERKIND
- 2.3 DIE STRUKTUR DES DEUTSCHEN BILDUNGSSYSTEMS
- 3 ERKLÄRUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG VON BILDUNGSUNGLEICHHEIT
- 3.1 THEORETISCHE ERKLÄRUNGEN ZUR ENTSTEHUNG VON SOZIALER UNGLEICHHEIT
- 3.1.1 Pierre Bourdieus Reproduktionstheorie
- 3.1.2 Raymond Boudons Herkunftseffekte
- 3.2 DIE BEDEUTUNG VON INFORMATIONSDEFIZITEN
- 3.3 DIE WICHTIGKEIT DER ELTERN
- 3.4 DIE BENACHTEILIGUNGEN DURCH DAS DEUTSCHE BILDUNGSSYSTEM
- 3.1 THEORETISCHE ERKLÄRUNGEN ZUR ENTSTEHUNG VON SOZIALER UNGLEICHHEIT
- 4 DIE AKTUELLE SITUATION VON NICHT-AKADEMIKERKINDERN
- 4.1 STUDIEN ZUR SOZIALEN UNGLEICHHEIT IM BILDUNGSSYSTEM
- 4.2 STUDIEN ZUM ÜBERGANG SCHULE - HOCHSCHULE
- 4.3 SOZIALE MOBILITÄT IN DEUTSCHLAND
- 5 LÖSUNGSANSÄTZE ZUR VERBESSERUNG DER BILDUNGSCHANCEN
- 5.1 PRÄVENTIVE MAßNAHMEN
- 5.1.1 Frühkindliche Förderung
- 5.1.2 Ganztagsschulen
- 5.1.3 Reformen im Bildungssystem
- 5.1.4 Familienzentren
- 5.2 NACHHOLENDE MAßNAHMEN
- 5.2.1 Finanzierungshilfen
- 5.2.2 Studieninformationen
- 5.2.2.1 Berufs- und Studienorientierung in der Schule
- 5.2.2.2 Angebote der Hochschulen
- 5.2.3 Förderprogramme
- 5.2.3.1 ArbeiterKind.de
- 5.2.3.2 Chance hoch 2
- 5.1 PRÄVENTIVE MAßNAHMEN
- 6 DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere die Benachteiligung von Nicht-Akademikerkindern beim Übergang von der Schule zur Hochschule. Ziel ist es, die Ursachen dieser Ungleichheit zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit aufzuzeigen.
- Soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Benachteiligung von Nicht-Akademikerkindern
- Theoretische Erklärungsansätze (Bourdieu, Boudon)
- Analyse der aktuellen Situation
- Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem ein und verweist auf den Widerspruch zwischen dem Recht auf Bildung (Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) und der Realität, in der Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten ungleiche Bildungschancen haben. Sie hebt die bestehenden Benachteiligungen von Nicht-Akademikerkindern hervor, die sich in verschiedenen Bildungsphasen manifestieren und zu eingeschränkten Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten führen. Die Arbeit begründet die Relevanz des Themas mit dem Hinweis auf empirische Befunde von PISA und der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, die die anhaltende soziale Ungleichheit im Bildungssystem belegen.
2 Begriffliche Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die notwendigen Definitionen für die Arbeit. Es definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und präzisiert, was unter „Nicht-Akademikerkindern“ zu verstehen ist. Weiterhin wird die Struktur des deutschen Bildungssystems skizziert, um den Kontext der Untersuchung zu schaffen und die unterschiedlichen Bildungswege und -möglichkeiten darzustellen. Diese Grundlagen schaffen eine gemeinsame Basis für die Analyse der folgenden Kapitel.
3 Erklärungsansätze zur Entstehung von Bildungsungleichheit: Dieses Kapitel beleuchtet theoretische Erklärungsansätze für die Entstehung von Bildungsungleichheit. Es diskutiert Pierre Bourdieus Reproduktionstheorie und Raymond Boudons Konzept der Herkunftseffekte, um die Mechanismen zu verdeutlichen, wie soziale Ungleichheit durch das Bildungssystem reproduziert wird. Zusätzlich werden die Rolle von Informationsdefiziten, die Bedeutung elterlicher Unterstützung und die systemischen Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem analysiert.
4 Die aktuelle Situation von Nicht-Akademikerkindern: Dieses Kapitel präsentiert empirische Befunde aus Studien zur sozialen Ungleichheit im Bildungssystem und zum Übergang Schule-Hochschule. Es analysiert die soziale Mobilität in Deutschland und zeigt auf, wie stark die Bildungschancen von der sozialen Herkunft abhängen. Die Kapitel beleuchten die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf Chancengleichheit und der tatsächlichen Situation von Nicht-Akademikerkindern.
5 Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungschansen: Dieser Abschnitt präsentiert präventive und nachholende Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit. Präventive Maßnahmen wie frühkindliche Förderung, Ganztagsschulen und Reformen im Bildungssystem werden ebenso diskutiert wie nachholende Maßnahmen, einschließlich Finanzierungshilfen, Studieninformationen und Förderprogramme (z.B. ArbeiterKind.de, Chance hoch 2). Der Fokus liegt auf der Schaffung von gleicheren Bildungschancen für Nicht-Akademikerkinder.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Nicht-Akademikerkinder, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Hochschulzugang, Bourdieu, Boudon, Reproduktionstheorie, Herkunftseffekte, Förderprogramme, Präventive Maßnahmen, Nachholende Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem und die Benachteiligung von Nicht-Akademikerkindern
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere die Benachteiligung von Kindern aus nicht-akademischen Familien beim Übergang von der Schule in die Hochschule. Sie analysiert die Ursachen dieser Ungleichheit und schlägt Lösungsansätze für mehr Bildungsgerechtigkeit vor.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Aspekte: Definition von sozialer Ungleichheit und Nicht-Akademikerkindern, Struktur des deutschen Bildungssystems, theoretische Erklärungsansätze (Bourdieu, Boudon), Analyse der aktuellen Situation von Nicht-Akademikerkindern anhand empirischer Studien, und die Vorstellung präventiver und nachholender Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit.
Welche theoretischen Erklärungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Reproduktionstheorie von Pierre Bourdieu und das Konzept der Herkunftseffekte von Raymond Boudon, um die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem zu erklären. Zusätzlich werden die Rolle von Informationsdefiziten, elterlicher Unterstützung und systemische Benachteiligungen analysiert.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf empirische Befunde aus Studien zur sozialen Ungleichheit im Bildungssystem und zum Übergang Schule-Hochschule. Sie analysiert die soziale Mobilität in Deutschland und zeigt den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungschancen auf.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt sowohl präventive als auch nachholende Maßnahmen vor. Zu den präventiven Maßnahmen gehören frühkindliche Förderung, Ganztagsschulen und Reformen im Bildungssystem. Nachholende Maßnahmen umfassen Finanzierungshilfen, verbesserte Studieninformationen (inkl. Berufs- und Studienorientierung) und Förderprogramme wie ArbeiterKind.de und Chance hoch 2.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Nicht-Akademikerkinder, Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Hochschulzugang, Bourdieu, Boudon, Reproduktionstheorie, Herkunftseffekte, Förderprogramme, Präventive Maßnahmen, Nachholende Maßnahmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffliche Grundlagen, Erklärungsansätze zur Entstehung von Bildungsungleichheit, Die aktuelle Situation von Nicht-Akademikerkindern, Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungschansen und Diskussion. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Ursachen der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem und die Benachteiligung von Nicht-Akademikerkindern zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2016, Soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem am Beispiel von Nicht-Akademikerkindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1128141