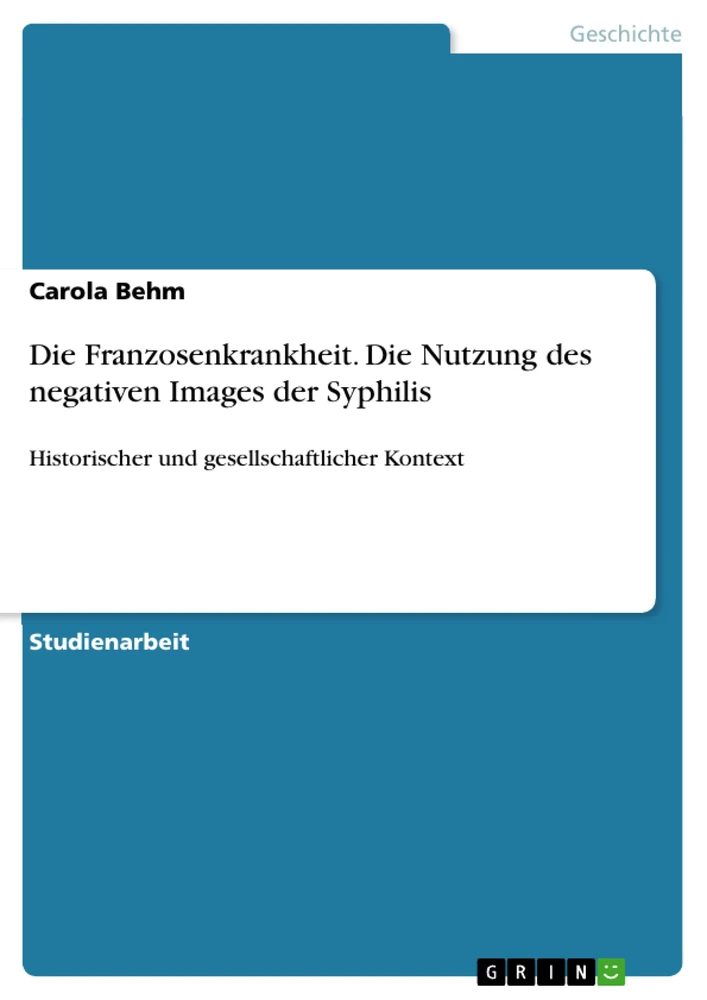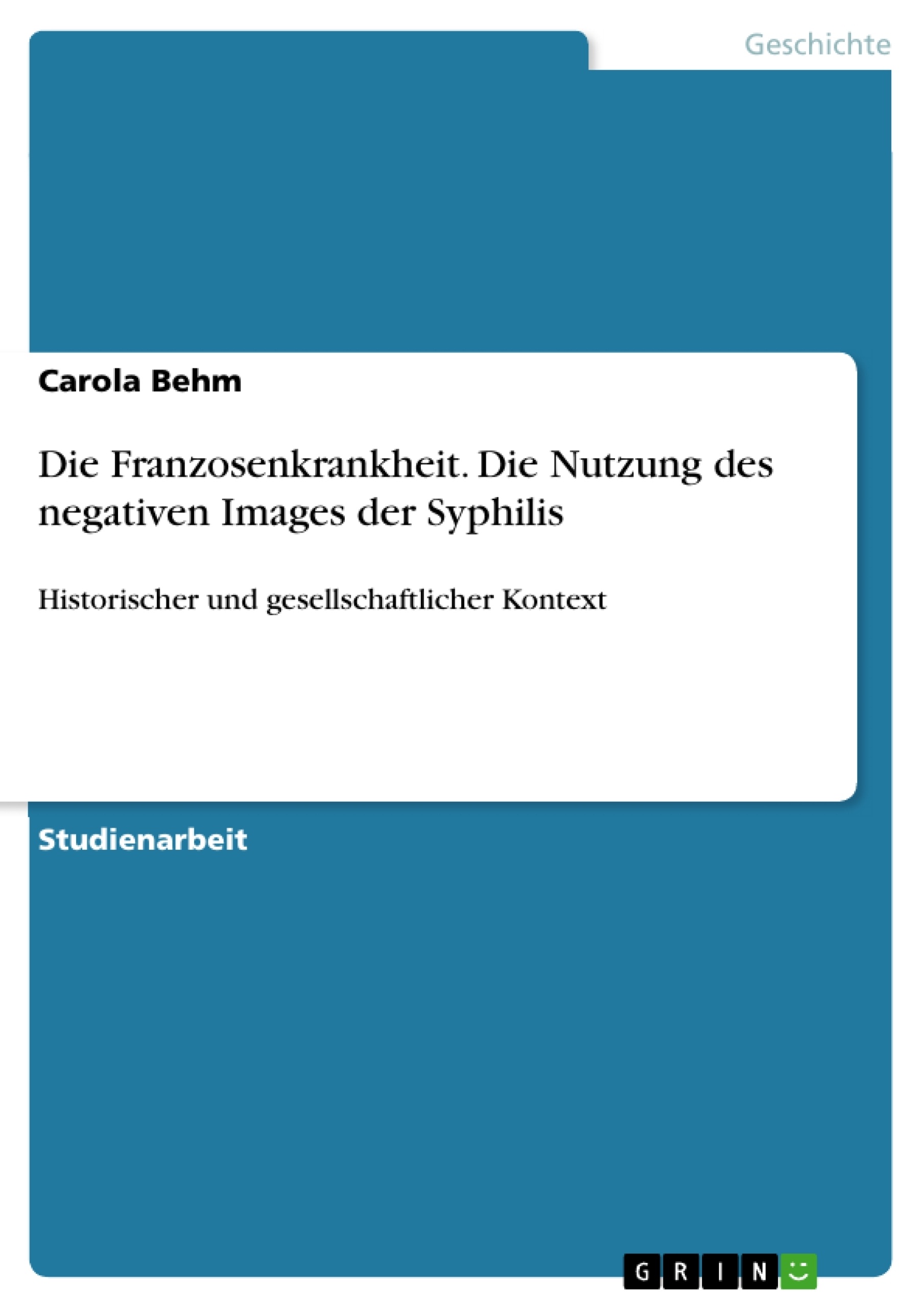Dieser Arbeit liegt der Ansatz zugrunde, sich näher mit den negativ besetzten Konnotationen der Syphilis zu unterschiedlichen Zeiten und deren auch politische Nutzung im historischen und gesellschaftlichen Kontext zu befassen. Die jeweilige Namensgebung gibt Hinweise auf den Ursprung, wie er zu den jeweiligen Verbreitungszeiten angenommen wurde; auch die Verbreitung innerhalb Europas kann dadurch vermutet werden.
In der Arbeit wird der These nachgegangen, dass die Namensgebung direkt oder indirekt nicht nur auf den angenommenen Ursprung verweist, sondern auch der Beförderung von Vorurteilen, dem Aufbau eines Feindbildes und als Mittel der Propaganda zur Erreichung von Zielen diente und dient. Dementsprechend wird neben der Ausbreitung in Europa und der Namensgebung die dadurch resultierende Abgrenzung gegenüber dem Fremden, auch in Bezug auf bestimmte, durch die Erkrankung stigmatisierte Bevölkerungsgruppen (Prostituierte/Söldner), thematisiert.
Im Zuge dessen sollen die Zusammenhänge von Kriegen und Seuchen insbesondere im Hinblick auf diese Gruppen betrachtet und mit z. B. Änderungen im Heerkonzept zur Deckung gebracht werden. Ein weiteres Kapitel folgt der Darstellung und Instrumentalisierung der Krankheit im Zuge des Wandels von der Strafe Gottes zur Strafe für unmoralischen Lebenswandel und dem Schutz der Familie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg der Syphilis nach und durch Europa
- Zusammenhang von Kriegen, Seuchen und Söldnertum – Namensgebung und Fremdenfeindlichkeit
- Wandlung der Schuldfrage von der Strafe Gottes zur Strafe für unmoralischen Lebenswandel - Namensgebung und die ewige Schuld der Frau
- Quarantäne und Ausgrenzung
- Gesellschaftliche Auswirkungen in der Renaissance
- Ergänzende Anmerkungen zum Langen 19. Jahrhundert und der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den negativen Konnotationen der Syphilis in verschiedenen Epochen und deren politischer Nutzung im historischen und gesellschaftlichen Kontext.
- Die Ausbreitung der Syphilis in Europa und die dabei stattfindende Namensgebung.
- Die Verbindung von Kriegen, Seuchen und Söldnertum und die Rolle der Syphilis als Mittel zur Konstruktion von Feindbildern.
- Die Entwicklung der Schuldfrage im Zusammenhang mit der Syphilis und die Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen wie Prostituierten und Söldnern.
- Die Auswirkungen der Syphilis auf die Gesellschaft während der Renaissance.
- Die Instrumentalisierung der Syphilis als Strafe für unmoralischen Lebenswandel und die Rolle der Familie.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert das Ziel der Hausarbeit, die sich mit den negativen Konnotationen der Syphilis und ihrer Nutzung im historischen und gesellschaftlichen Kontext beschäftigt.
- Kapitel 2 beleuchtet den Weg der Syphilis nach und durch Europa, beginnend mit ihrer vermuteten Herkunft aus der Neuen Welt und ihrer Ausbreitung im 15. Jahrhundert.
- Kapitel 3 untersucht den Zusammenhang zwischen Kriegen, Seuchen und Söldnertum und die Rolle der Syphilis in der Konstruktion von Feindbildern und Vorurteilen.
- Kapitel 4 analysiert die Entwicklung der Schuldfrage im Zusammenhang mit der Syphilis und die Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, wie Prostituierten und Söldnern.
- Kapitel 5 behandelt die gesellschaftlichen Auswirkungen der Syphilis während der Renaissance und die Maßnahmen zur Quarantäne und Ausgrenzung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Syphilis, ihre Namensgebung, die Konstruktion von Feindbildern, Vorurteile, Stigmatisierung, die Rolle der Krankheit im Zusammenhang mit Kriegen, Seuchen und Söldnertum, die gesellschaftlichen Auswirkungen in der Renaissance und die Instrumentalisierung der Syphilis als Strafe für unmoralischen Lebenswandel.
- Quote paper
- Carola Behm (Author), 2021, Die Franzosenkrankheit. Die Nutzung des negativen Images der Syphilis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127167