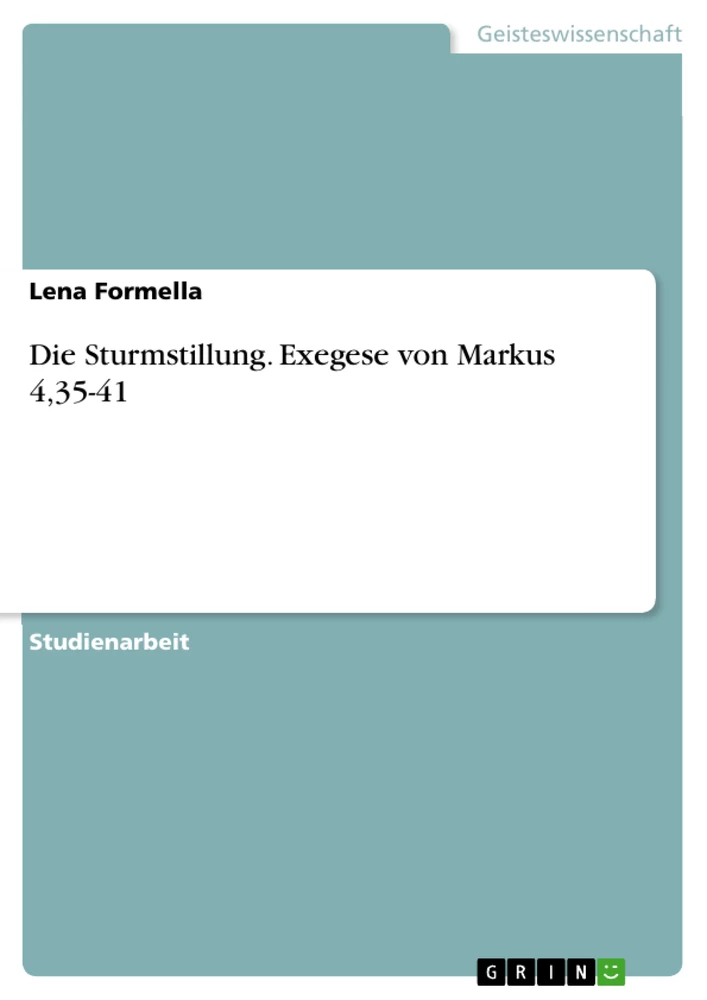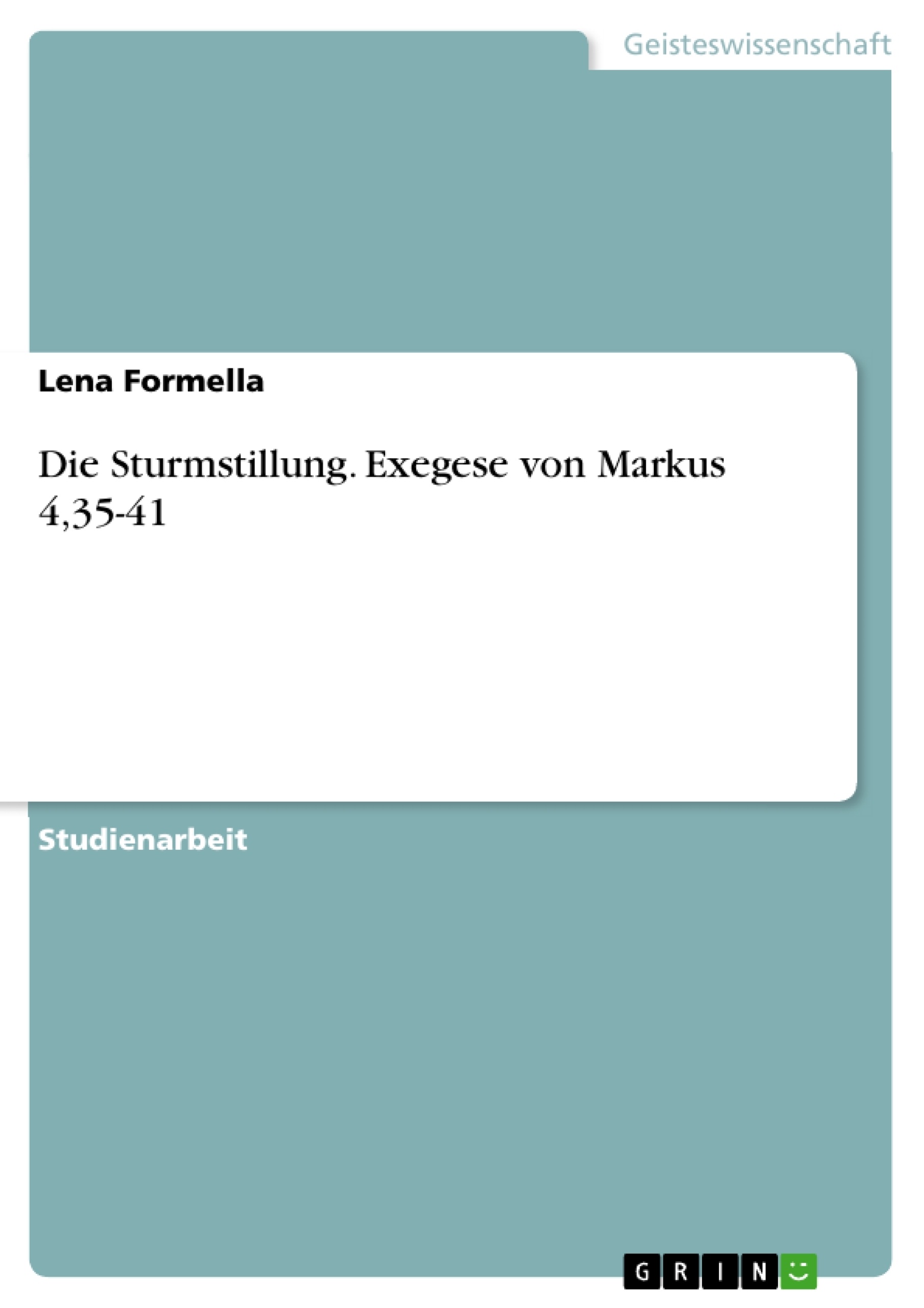Diese Exegese beschäftigt sich mit der synoptischen Wundererzählung über die Sturmstillung in Markus 4,35-41. Hierfür sollen Fragen an den Text gestellt werden, die die Bedeutung der Sturmsymbolik herausarbeiten und beantworten, welche Aussage der Autor des Markusevangeliums zu treffen versuchte, insbesondere bezogen auf die Darstellung der Person Jesu und seinen Anspruch auf Vollmacht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung
- Textkritik
- Sprachlich-Sachliche Analyse
- Sozialgeschichtliche und Historische Fragen
- Abgrenzung der Perikope und Textlinguistische Fragestellungen
- Aussageabsicht des Autors
- Formkritik
- Textpragmatische Analyse
- Kontextuelle Analyse/ Das innovative Potential
- Traditionsgeschichte und Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Synoptischer Vergleich
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts
- Kompositionskritische Analyse
- Redaktionskritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Exegese des Markusevangeliums 4,35-41 zielt darauf ab, die Wundererzählung der Sturmstillung zu analysieren und ihre Bedeutung im Kontext des neutestamentlichen Textes zu erschließen. Die Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Analyse des Textes, untersucht die historischen und soziokulturellen Hintergründe der Erzählung und erforscht die theologische Botschaft, die der Autor des Markusevangeliums durch diese Geschichte vermitteln möchte.
- Die Bedeutung der Sturmsymbolik in der biblischen Tradition und im Kontext des Markusevangeliums
- Die Darstellung Jesu als Herr über die Naturgewalten und seine Autorität in der Welt
- Die Rolle des Glaubens der Jünger und der Herausforderungen, die sie in ihrem Verhältnis zu Jesus erfahren
- Die theologische Aussage der Erzählung im Kontext der Gesamtkomposition des Markusevangeliums
- Die Relevanz der Sturmstillung für das heutige Verständnis von Glaube, Hoffnung und Vertrauen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Exegese vor und erläutert den persönlichen Zugang der Autorin zum Text sowie die Forschungsfragen, die im Zentrum der Arbeit stehen.
- Übersetzung: Die Übersetzung des Textes liefert die Grundlage für die nachfolgenden Analysen und bietet eine sprachliche Grundlage für die Interpretation der Geschichte.
- Textkritik: Die textkritische Analyse untersucht verschiedene Lesarten des Textes und bewertet ihre jeweilige Wahrscheinlichkeit, um die ursprüngliche Fassung des Textes zu rekonstruieren.
- Sprachlich-Sachliche Analyse: Dieser Abschnitt analysiert die sprachlichen Besonderheiten des Textes und untersucht die Bedeutung der verwendeten Bilder und Metaphern. Er beleuchtet zudem die historischen und soziokulturellen Kontexte, die für das Verständnis der Erzählung relevant sind.
- Formkritik: Die Formkritik untersucht die literarische Gattung der Sturmstillungserzählung und analysiert ihre narrative Struktur und die Besonderheiten ihrer literarischen Umsetzung.
- Textpragmatische Analyse: Die textpragmatische Analyse untersucht die sprachlichen Mittel und rhetorischen Strategien, die der Autor des Markusevangeliums in der Erzählung einsetzt, um die gewünschte Wirkung beim Leser zu erzielen.
- Kontextuelle Analyse/ Das innovative Potential: Dieser Abschnitt untersucht die Sturmstillungserzählung im Vergleich zu anderen biblischen Texten und analysiert ihre spezifischen Merkmale und ihre Relevanz im Kontext der neutestamentlichen Tradition.
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts: Die Analyse des Textes im Kontext des gesamten Markusevangeliums beleuchtet die theologische Botschaft der Sturmstillungserzählung und ihre Funktion innerhalb der Gesamtkomposition des Textes.
Schlüsselwörter
Die Exegese der Sturmstillungserzählung in Markus 4,35-41 befasst sich mit zentralen Themen wie Wundererzählungen, Jesus als Herr über die Naturgewalten, der Glaube der Jünger, die Bedeutung der Sturmsymbolik, die theologische Aussage des Textes und die Analyse der literarischen Gattung und der Textoptik.
- Quote paper
- Lena Formella (Author), 2021, Die Sturmstillung. Exegese von Markus 4,35-41, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127164