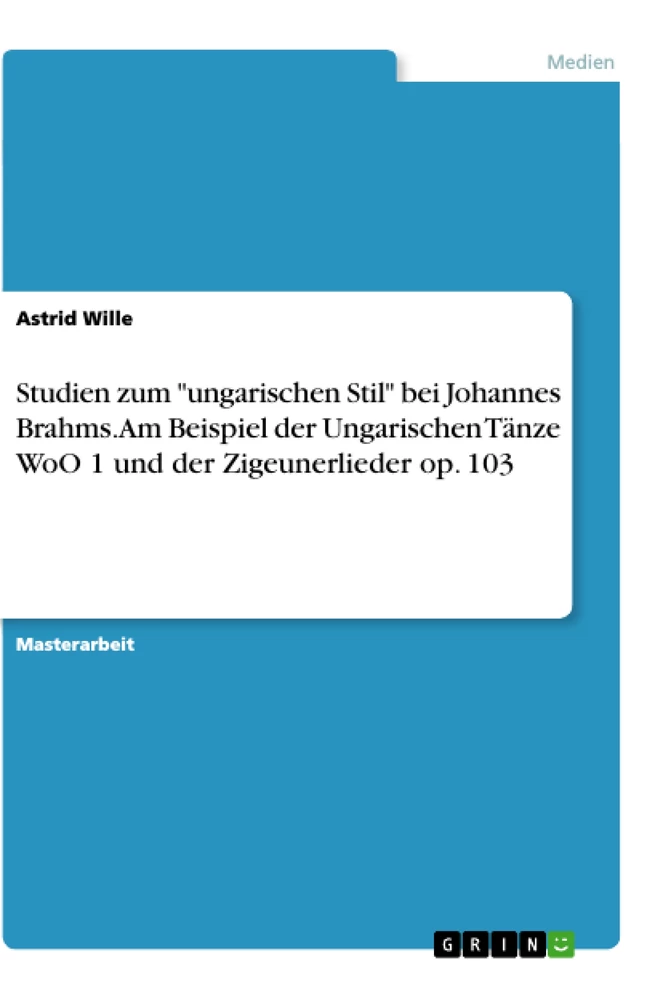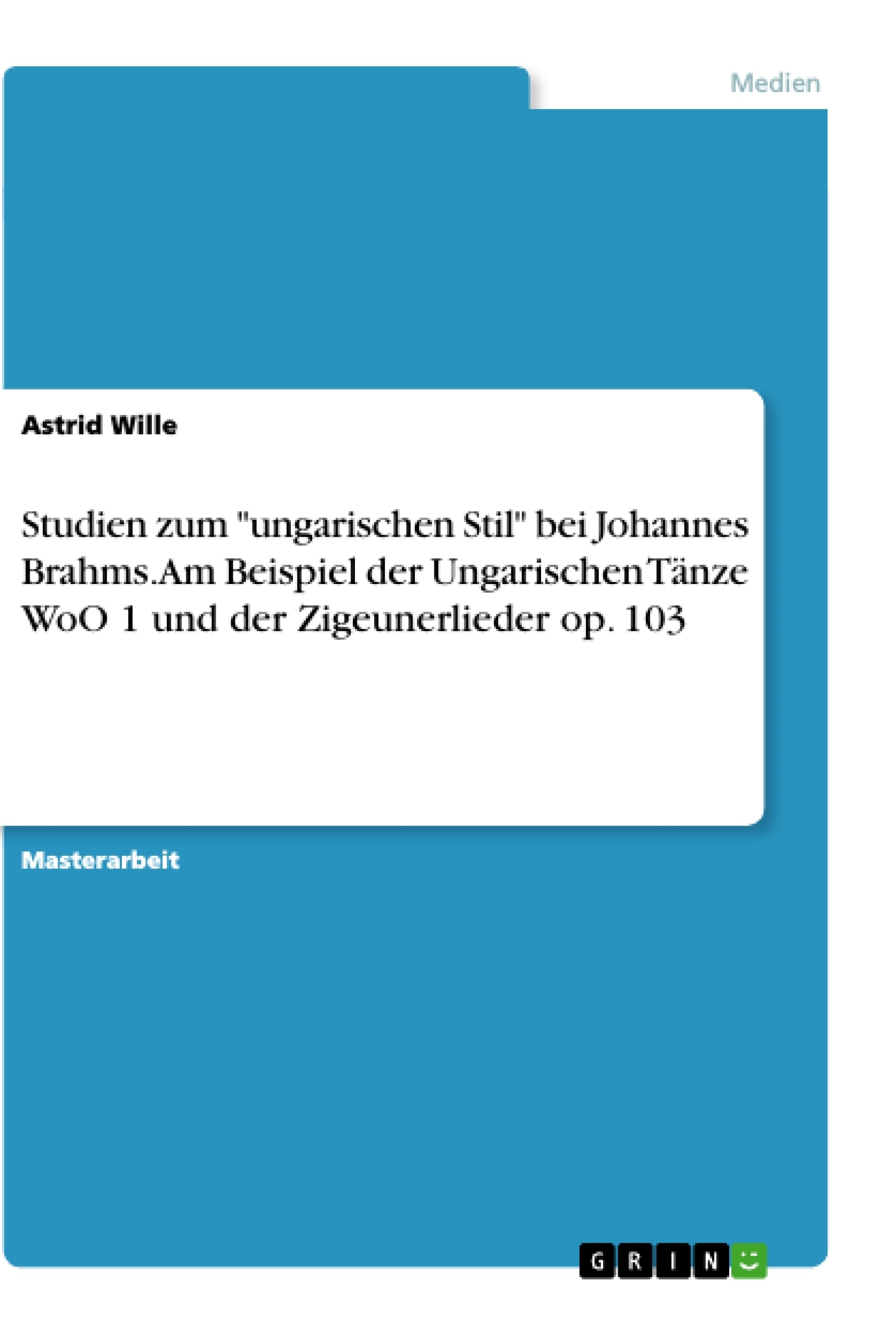Diese Arbeit befasst sich mit den Werken "Ungarische Tänze WoO 1" und den "Zigeunerlieder op. 103" von Johannes Brahms. Beide Kompositionen sollen sowohl auf ihre unterschiedliche Ausprägung und Gestaltung hinsichtlich des "ungarischen Stils" als auch auf ihr Verhältnis zu den ungarischen Vorlagen und der westeuropäischen Kunstmusik untersucht werden.
Dazu werden im Folgenden, nach Erläuterung der Entstehungsgeschichte beider Werke, Brahms` Verbindung zu Ungarn sowie die musikalischen Entwicklungen des Landes im 19. Jahrhundert betrachtet. Des Weiteren werden in einem Überblick Brahms´ kompositorische Umsetzung den Vorlagen gegenübergestellt und schließlich die Ungarischen Tänze Nr. 6 und 11 sowie das erste und das achte der Zigeunerlieder diesbezüglich analysiert und verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Johannes Brahms und der „ungarische Stil“
- 2. Der Entstehungsprozess der Ungarischen Tänze WoO 1 und der Zigeunerlieder op. 103
- 2.1 Die Ungarischen Tänze WoO 1
- 2.2 Die Zigeunerlieder op. 103
- 3. Brahms´ Beziehung zu Ungarn
- 4. Musikalische Entwicklungen im Ungarn des 19. Jahrhunderts
- 4.1 Geschichtliche und gesellschaftliche Aspekte
- 4.2 Ungarische Musikstile
- 4.2.1 Die einstimmigen ungarischen Volkslieder
- 4.2.2 Verbunkos und Csárdás
- 4.2.3 Das volkstümliche Kunstlied
- 4.2.4 Zusammenfassung der Stilmerkmale
- 4.3 Die Zigeunermusiker und ihre Vortragsweise
- 4.4 Die Integration der Stile in die westeuropäische Kunstmusik
- 5. Brahms´ Kompositionen und die Vorlagen im Vergleich
- 5.1 Die Ungarischen Tänze und die Vorlagen des Brahms-Nachlasses
- 5.1.1 Die Melodien
- 5.1.2 Anlage der Werke
- 5.1.3 Form
- 5.1.4 Beispiele der Umsetzung des „ungarischen Stils“
- 5.1.5 Schlussfolgerung
- 5.2 Die Zigeunerlieder op. 103 und die Ungarischen Liebeslieder
- 5.2.1 Verwandtschaft
- 5.2.2 Anlage der Werke
- 5.2.3 Form
- 5.2.4 Beispiele für die Umsetzung des ungarischen Stils und der zigeunerischen Vortragsweise
- 5.5 Schlussfolgerung
- 6. Werkbetrachtungen
- 6.1 Beispiele zweier unterschiedlicher Ausdrucksmöglichkeiten des „ungarischen Stils“
- 6.1.1 Ungarischer Tanz Nr. 6
- 6.1.2 Zigeunerlied Nr. 1: He, Zigeuner, greife in die Saiten ein
- 6.2 Der „ungarische Stil“ als Inspiration für Komposition und Interpretation
- 6.2.1 Ungarischer Tanz Nr. 11
- 6.2.2 Lied Nr. 8: “Horch, der Wind klagt in den Zweigen traurig sacht”
- 7. Brahms´ Erhöhung der ungarischen Musik in der Kunstform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Verwendung des „ungarischen Stils“ in den Kompositionen von Johannes Brahms, speziell in den Ungarischen Tänzen WoO 1 und den Zigeunerliedern op. 103. Die Arbeit analysiert die Entstehungsgeschichte der Werke, Brahms' Beziehung zu Ungarn und die musikalischen Entwicklungen Ungarns im 19. Jahrhundert. Ein zentraler Punkt ist der Vergleich zwischen Brahms' Kompositionen und ihren ungarischen Vorlagen.
- Brahms' Umgang mit ungarischen Volksliedern und Tänzen
- Der Einfluss ungarischer Musikstile (Verbunkos, Csárdás, Magyar Nóta) auf Brahms' Werke
- Die Rolle der Zigeunermusiker und ihrer Vortragsweise in Brahms' Kompositionen
- Der "style hongrois" und seine Umsetzung bei Brahms
- Vergleichende Analyse ausgewählter Werke (Ungarische Tänze und Zigeunerlieder)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Johannes Brahms und der „ungarische Stil“: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt Johannes Brahms als wichtigen Vertreter des "style hongrois" vor, wobei es auf die Kategorisierung von Adam Gellen eingeht, welche die unterschiedliche Verwendung des ungarischen Stils in Brahms Werken beschreibt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine stilistische Differenzierung zwischen "ungarisch" und "zigeunerisch" in den Werken vorliegt und die Forschungsfrage der Arbeit formuliert.
2. Der Entstehungsprozess der Ungarischen Tänze WoO 1 und der Zigeunerlieder op. 103: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Ungarischen Tänze und Zigeunerlieder. Es beschreibt die Quellen, die Brahms verwendete, und die Umstände ihrer Entstehung und Herausgabe, inklusive der Herausforderungen bei der Verschriftung seiner improvisatorischen Spielpraxis und den damit verbundenen Herausforderungen hinsichtlich möglicher Plagiatsvorwürfe. Die unterschiedlichen Fassungen für Solo-Klavier und Orchester werden erklärt.
3. Brahms´ Beziehung zu Ungarn: Dieses Kapitel untersucht Brahms' persönliche und professionelle Beziehung zu Ungarn. Es beschreibt seine Begegnungen mit ungarischen Musikern, seine Konzertreisen ins Land, und die umfassende Sammlung ungarischer Musikstücke in seinem Besitz. Diese Beziehung wird als entscheidender Faktor für sein Verständnis und seine Verwendung ungarischer Musikelemente in seinen Kompositionen hervorgehoben.
4. Musikalische Entwicklungen im Ungarn des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die musikalischen Entwicklungen Ungarns im 19. Jahrhundert, mit Fokus auf die geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründe, die wichtigsten Musikstile (Volkslied, Verbunkos, Csárdás, Magyar Nóta), die Rolle der Zigeunermusiker und ihre Vortragsweise und die Integration dieser Stile in die westeuropäische Kunstmusik, was schlussendlich zum "style hongrois" führte.
5. Brahms´ Kompositionen und die Vorlagen im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die ungarischen Vorlagen im Brahms-Nachlass mit den Ungarischen Tänzen und Zigeunerliedern. Es analysiert Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Melodien, Formen, Rhythmen, Harmonien, und der Gestaltung des Vortrags. Es wird deutlich, wie Brahms die Melodien und Stilelemente der Vorlagen aufgreift und für seine eigenen Kompositionen umformt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die verschiedenen Arten der stilistischen Umsetzung gelegt.
6. Werkbetrachtungen: Dieses Kapitel enthält detaillierte Analysen des Ungarischen Tanzes Nr. 6, des Zigeunerliedes Nr. 1, des Ungarischen Tanzes Nr. 11 und des Zigeunerliedes Nr. 8. Die Analysen zeigen den unterschiedlichen Umgang Brahms mit dem "ungarischen Stil" auf – mal als zentrales Element, mal als subtiler Hinweis.
Schlüsselwörter
Johannes Brahms, Ungarischer Stil, style hongrois, Ungarische Tänze WoO 1, Zigeunerlieder op. 103, Ungarische Volksmusik, Verbunkos, Csárdás, Magyar Nóta, Zigeunermusiker, Volkslied, Kunstlied, Kompositionstechnik, Stilvergleich, Musikgeschichte, 19. Jahrhundert, Ungarn.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Brahms und der „ungarische Stil“
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Verwendung des „ungarischen Stils“ in den Kompositionen von Johannes Brahms, insbesondere in den Ungarischen Tänzen WoO 1 und den Zigeunerliedern op. 103. Sie analysiert die Entstehungsgeschichte der Werke, Brahms' Beziehung zu Ungarn und die musikalischen Entwicklungen Ungarns im 19. Jahrhundert. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zwischen Brahms' Kompositionen und ihren ungarischen Vorlagen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Brahms' Umgang mit ungarischen Volksliedern und Tänzen; den Einfluss ungarischer Musikstile (Verbunkos, Csárdás, Magyar Nóta) auf Brahms' Werke; die Rolle der Zigeunermusiker und ihrer Vortragsweise in Brahms' Kompositionen; den "style hongrois" und seine Umsetzung bei Brahms; und eine vergleichende Analyse ausgewählter Werke (Ungarische Tänze und Zigeunerlieder).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 führt in die Thematik ein; Kapitel 2 beleuchtet den Entstehungsprozess der Ungarischen Tänze und Zigeunerlieder; Kapitel 3 untersucht Brahms' Beziehung zu Ungarn; Kapitel 4 bietet einen Überblick über die musikalischen Entwicklungen Ungarns im 19. Jahrhundert; Kapitel 5 vergleicht Brahms' Kompositionen mit ihren ungarischen Vorlagen; Kapitel 6 enthält detaillierte Analysen ausgewählter Werke; und Kapitel 7 behandelt Brahms' Beitrag zur Erhöhung der ungarischen Musik in der Kunstform.
Wie werden Brahms' Kompositionen und ihre ungarischen Vorlagen verglichen?
Kapitel 5 vergleicht die ungarischen Vorlagen im Brahms-Nachlass mit den Ungarischen Tänzen und Zigeunerliedern. Die Analyse umfasst Melodien, Formen, Rhythmen, Harmonien und die Gestaltung des Vortrags. Es wird gezeigt, wie Brahms die Melodien und Stilelemente der Vorlagen aufgreift und für seine eigenen Kompositionen umformt.
Welche Werke werden im Detail analysiert?
Kapitel 6 enthält detaillierte Analysen des Ungarischen Tanzes Nr. 6, des Zigeunerliedes Nr. 1, des Ungarischen Tanzes Nr. 11 und des Zigeunerliedes Nr. 8. Die Analysen verdeutlichen den unterschiedlichen Umgang Brahms' mit dem „ungarischen Stil“ – mal als zentrales Element, mal als subtiler Hinweis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Johannes Brahms, Ungarischer Stil, style hongrois, Ungarische Tänze WoO 1, Zigeunerlieder op. 103, Ungarische Volksmusik, Verbunkos, Csárdás, Magyar Nóta, Zigeunermusiker, Volkslied, Kunstlied, Kompositionstechnik, Stilvergleich, Musikgeschichte, 19. Jahrhundert, Ungarn.
Wie wird die Beziehung Brahms' zu Ungarn dargestellt?
Kapitel 3 beschreibt Brahms' persönliche und professionelle Beziehung zu Ungarn, einschließlich seiner Begegnungen mit ungarischen Musikern, seiner Konzertreisen und seiner umfangreichen Sammlung ungarischer Musikstücke. Diese Beziehung wird als entscheidend für sein Verständnis und seine Verwendung ungarischer Musikelemente in seinen Kompositionen hervorgehoben.
Welche musikalischen Entwicklungen Ungarns werden betrachtet?
Kapitel 4 bietet einen Überblick über die musikalischen Entwicklungen Ungarns im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet geschichtliche und gesellschaftliche Hintergründe, wichtige Musikstile (Volkslied, Verbunkos, Csárdás, Magyar Nóta), die Rolle der Zigeunermusiker und ihre Vortragsweise sowie die Integration dieser Stile in die westeuropäische Kunstmusik.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit untersucht, ob eine stilistische Differenzierung zwischen "ungarisch" und "zigeunerisch" in Brahms' Werken vorliegt, ausgehend von der Kategorisierung des "style hongrois" durch Adam Gellen.
- Quote paper
- Astrid Wille (Author), 2019, Studien zum "ungarischen Stil" bei Johannes Brahms. Am Beispiel der Ungarischen Tänze WoO 1 und der Zigeunerlieder op. 103, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126250