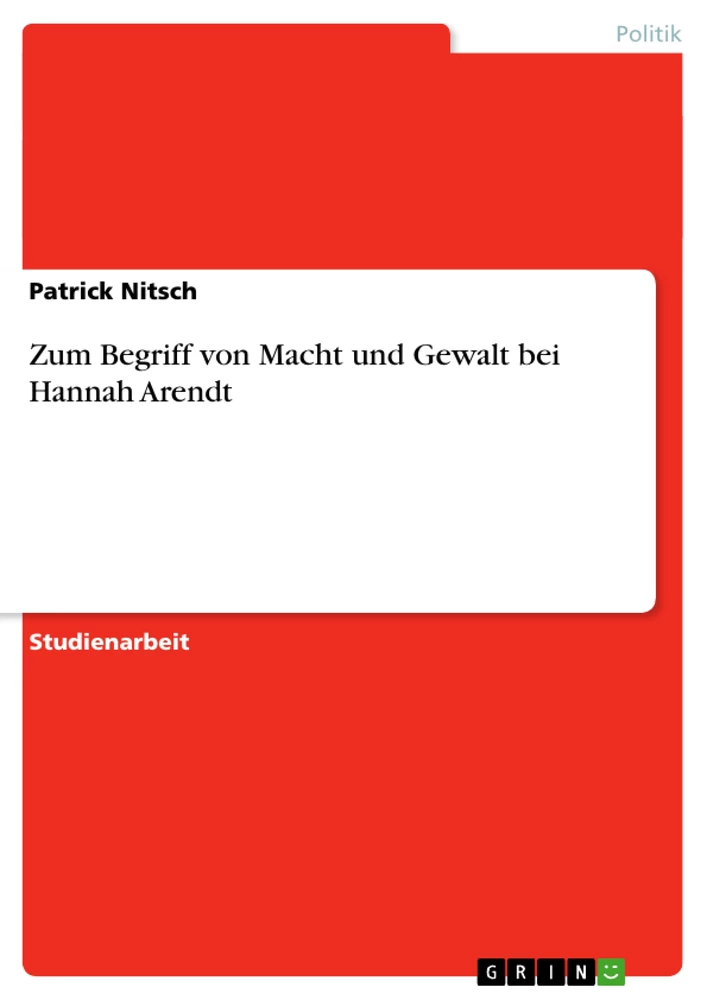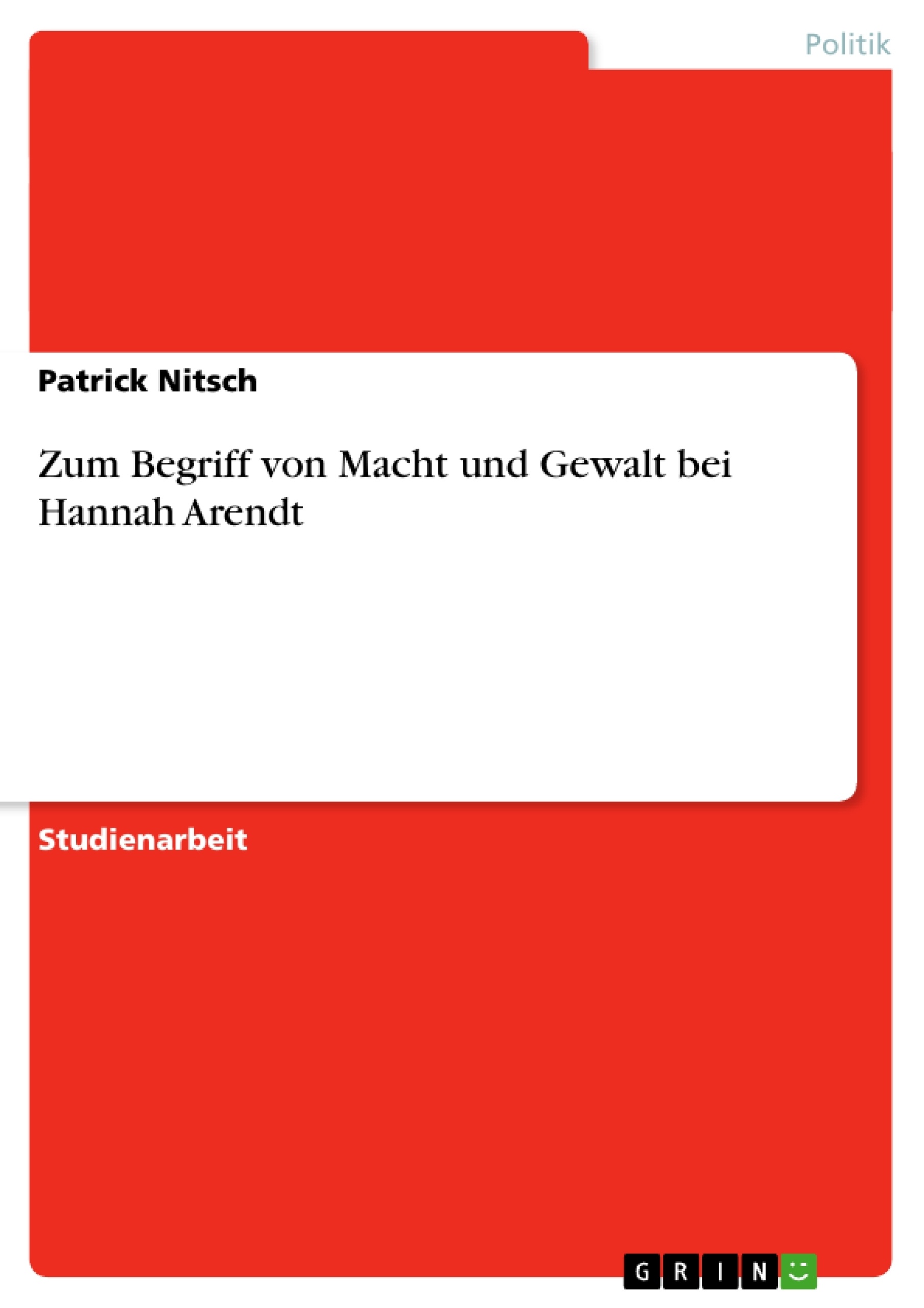ZUM BEGRIFF VON MACHT UND GEWALT BEI HANNAH ARENDT
EINLEITUNG
„Es gibt nämlich keine wissenschaftliche Disziplin, deren spezifisches Objekt die Natur, der Ursprung und die Ausübung der Macht ist, obwohl dieses Phänomen seit langem die Überlegungen der großen Denker angeregt hat“(1).
Als Arendt die wichtigsten politischen Theoretiker der Neuzeit studierte, kam sie zu dem Ergebnis, dass es von Links bis Rechts eine Übereinstimmung gäbe, dass Macht und Gewalt dasselbe wären, oder sogar dass „Gewalt nichts weiter ist als die eklatanteste Manifestation von Macht“(2). Im Gegenteil dazu will sie aber auf eine ganz andere Tradition hinweisen, nämlich auf die griechische Polis und die römische Res publica(3), denen ein ganz anderer Machtbegriff vorschwebte.
Die Hauptintention, die man bei Arendt zu einer klaren Definition des Begriffs der Macht ausformuliert findet, ist die Kritik an der politischen Wissenschaftler, die die Begriffe Macht, Stärke, Kraft, Autorität, Gewalt nicht gut trennt. Das resultiert nach Arendt aus einer theoretischen Überzeugung heraus, dass die einzige wichtige Frage in der Politik die nach der Herrschaft Wessen über Wen sei, und nur noch die dazu erforderlichen Mittel weiteres Interesse haben. Die Vermischung dieser Begriffe führt dazu, auch die Begriffe von Macht und Gewalt zu vermischen. Gewalt ist nach ihr nie als eigenständiges Phänomen betrachtet worden. Dies ist der Grund, warum „die Probleme der Gewalt (...) immer noch sehr dunkel“(4)sind.
Hannah Arendt wollte diese Probleme der Gewalt „heller“ machen. Dafür versucht sie, die Begriffe Macht, Stärke, Kraft, Autorität und Gewalt(5)zu klären, um besonders die zwei Begriffe der Macht und der Gewalt stark zu unterscheiden. Mit ihrem auf Theorie beruhenden Verständnis des Verhältnisses der Macht und der Gewalt als „absolute Gegensätze“ trennt sich Arendt scharf von den traditionellen Denkern wie Max Weber.
In der Praxis sind aber Macht und Gewalt nicht so stark getrennt, und Arendt gibt selbst zu, dass sie fast nie in ihrer Reinheit zu finden sind, und dass sie öfters zusammen auftreten. [...]
____
1 Lefort, S. 25, von mir übersetzt.
2 Arendt, S. 36.
3 Arendt, S. 41.
4 Sorel, zitiert nach Arendt, S. 36.
5 Arendt, S. 45 ff.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I. DER BEGRIFF DER MACHT: INWIEFERN UNTERSCHEIDET SICH ARENDTS „VERSTEHEN DER MACHT“ VON DEM DER TRADITIONELLEN DENKER (WIE WEBER)
- A. DIE TRADITIONELLEN MACHTBEGRIFFE
- B. ARENDTS BEGRIFF DER MACHT.
- II. DAS VERHÄLTNIS VON MACHT UND GEWALT BEI HANNAH ARENDT
- A. MACHT UND GEWALT ALS „ABSOLUTE GEGENTEILE“.
- B. DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN MACHT UND GEWALT IN DER PRAXIS.
- III. INWIEFERN SIND ARENDTS UND WEBERS BEGRIFFE DER MACHT UND DER GEWALT NICHT SO ENTFERNT VONEINANDER
- SCHLUSS
- ANHANG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Definition von Macht und Gewalt im Werk von Hannah Arendt. Er untersucht, inwiefern sich Arendts Verständnis von Macht von traditionellen Machtbegriffen unterscheidet, insbesondere von dem Max Webers. Der Text beleuchtet das Verhältnis von Macht und Gewalt als „absolute Gegensätze“ und analysiert deren praktische Umsetzung. Abschließend werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Arendts und Webers Definitionen von Macht und Gewalt herausgearbeitet.
- Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt im Werk von Hannah Arendt
- Kritik an der Vermischung von Machtbegriffen in der politischen Theorie
- Das Verhältnis von Macht und Gewalt als „absolute Gegensätze“
- Die Rolle der griechischen Polis und der römischen Res publica für Arendts Machtverständnis
- Vergleich von Arendts und Webers Definitionen von Macht und Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert Arendts Kritik an der Vermischung von Machtbegriffen in der politischen Theorie und stellt ihre Intention zur Klärung des Begriffs der Macht vor. Sie argumentiert, dass Gewalt oft als eine bloße Manifestation von Macht betrachtet wird und die Bedeutung von Macht in ihrer Eigenschaft als Ausdruck gemeinsamer Handlungsfähigkeit vernachlässigt wird.
Kapitel I beschäftigt sich mit Arendts Verständnis von Macht im Vergleich zu traditionellen Denkern wie Max Weber. Es wird dargestellt, dass Weber Macht als die Fähigkeit zur Durchsetzung des Willens definiert, während Arendt Macht als die Fähigkeit einer Gruppe versteht, im zwanglosen Miteinander Einverständnis zu erzielen. Der Abschnitt beleuchtet auch Webers Definition des Staates als „ein auf das Mittel der legitimen Gewaltsamkeit gestütztes Herrschaftsverhältnis von Menschen über Menschen“ und verweist auf die Bedeutung von Gewalt im Staatsbegriff Webers.
Kapitel II untersucht das Verhältnis von Macht und Gewalt bei Hannah Arendt. Es stellt die These auf, dass Macht und Gewalt „absolute Gegensätze“ sind und dass Gewalt nie als eigenständiges Phänomen betrachtet wurde. Der Abschnitt analysiert die praktische Beziehung zwischen Macht und Gewalt und zeigt auf, dass sie selten in ihrer Reinheit zu finden sind und oft zusammen auftreten.
Kapitel III vergleicht Arendts und Webers Definitionen von Macht und Gewalt und untersucht, inwiefern diese nicht so weit voneinander entfernt liegen, wie es zunächst scheint. Es wird gezeigt, dass trotz unterschiedlicher Begrifflichkeiten sowohl Arendt als auch Weber die Bedeutung von Macht und Gewalt in der politischen Theorie betonen.
Schlüsselwörter
Die Kernthemen des Textes sind die Unterscheidung von Macht und Gewalt, die Kritik an traditionellen Machtbegriffen, das Verständnis von Macht als Ausdruck gemeinsamer Handlungsfähigkeit, die Bedeutung der griechischen Polis und der römischen Res publica für Arendts Machtverständnis, und der Vergleich von Arendts und Webers Definitionen von Macht und Gewalt.
- Quote paper
- Patrick Nitsch (Author), 2002, Zum Begriff von Macht und Gewalt bei Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11259