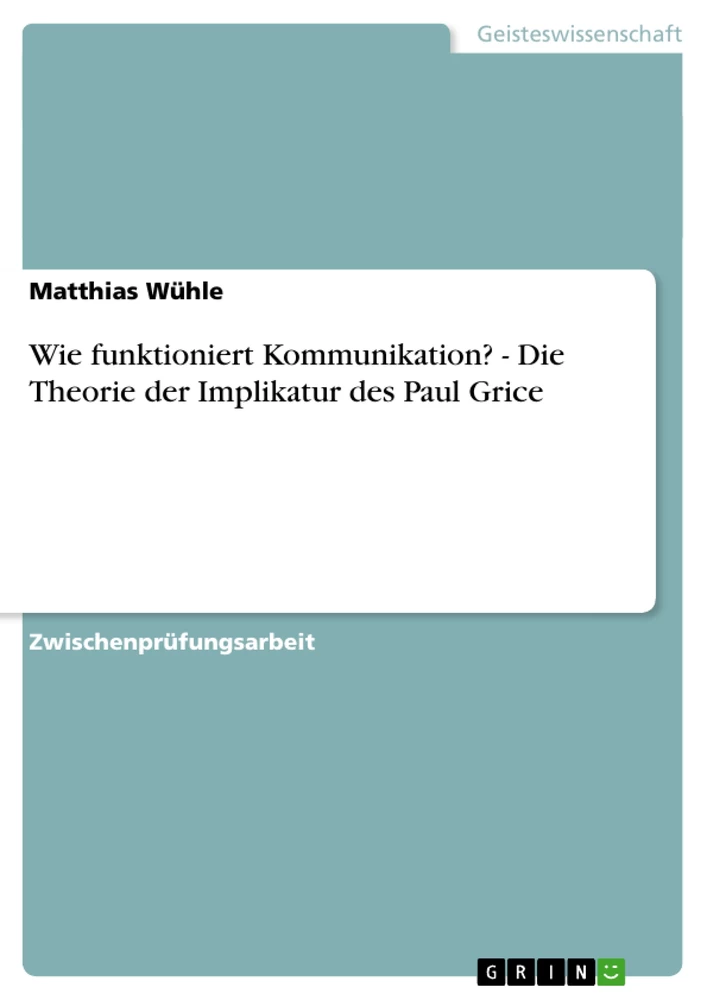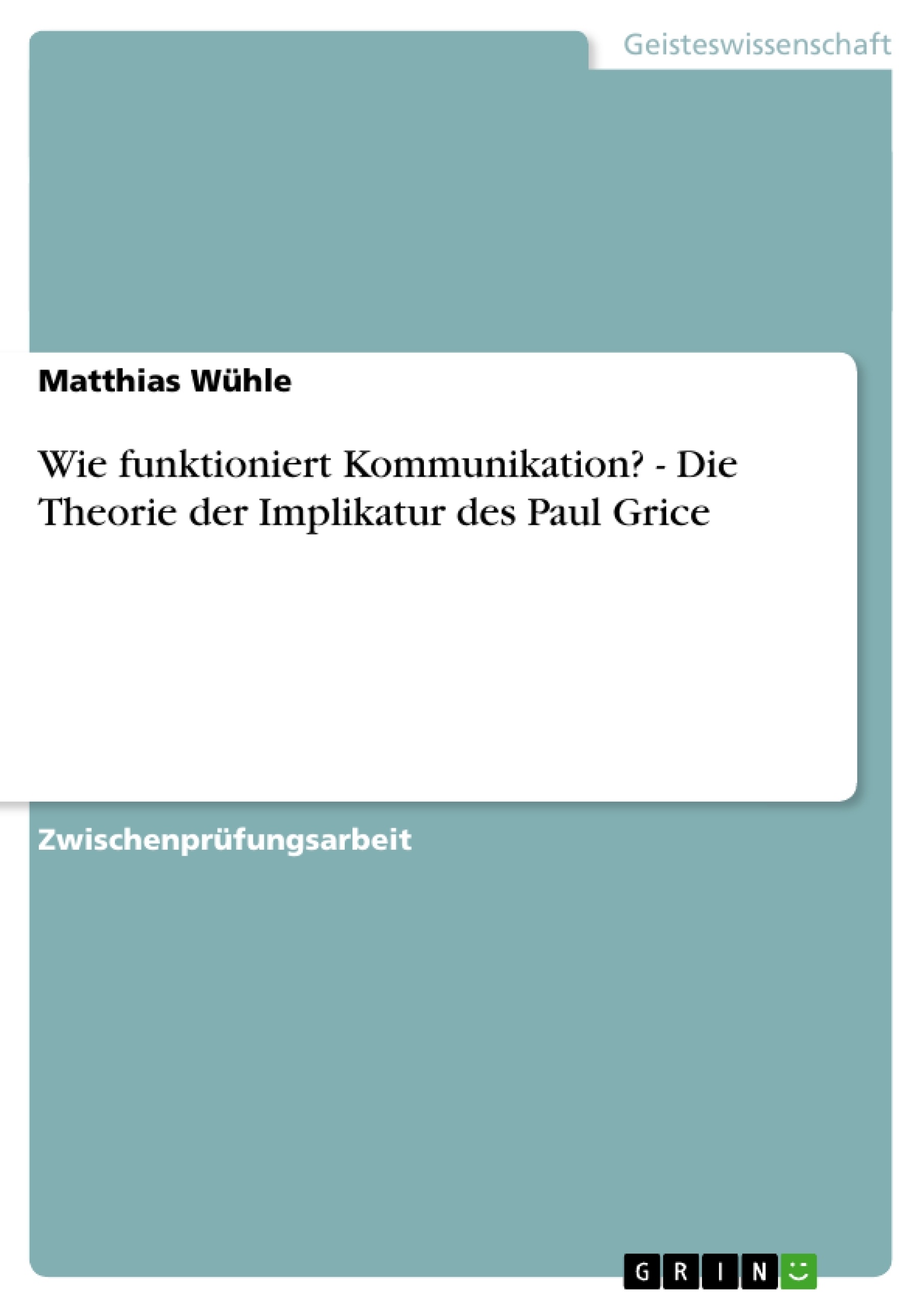Ein Sprecher, nennen wir Ihn S, äußert einen Satz: „Ich muss heute Abend noch einen Bericht schreiben“. Was meint S mit diesem Satz? Dass er zum Zeitpunkt der Äußerung plant, einen Bericht zu schreiben. Setzen wir diesen Satz jedoch in einen bestimmten Gesprächskontext, so kommt es zu einem Bedeutungswandel der Äußerung. Ging z.B. die Frage eines Gesprächspartners, nennen wir ihn G1 voraus, „Kommst Du heute mit, ein Bier trinken?“, so beabsichtigt S mit seiner Äußerung, das Angebot abzulehnen, und zwar mit der implizierten Begründung, dass er noch einen Bericht schreiben müsse. Setzen wir den Satz des S in einen anderen Gesprächskontext, bei dem ein anderer Gesprächspartner, nennen wir Ihn G2 die Frage äußert: „Kannst Du für mich diesen Text übersetzen?“, so könnten wir den Satz des S interpretieren als „Ja, solange es bis Morgen Zeit hat“. Der Gesprächskontext verleiht einundderselben Aussage jeweils eine unterschiedliche Bedeutung, die im Falle des G1 eine Ablehnung und im Falle des G2 eine einschränkende Zustimmung bedeuten könnte.
Ein anderes Beispiel – mit höherer Praxisrelevanz: Ein Bewerber, Herr B., erhält von seinem letzten Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis, in dem der Satz steht: „Herr B. zeichnete sich durch stete Pünktlichkeit aus“. Wie kommt es, das ein Satz, der zunächst unverfänglich wirkt, da er eine positive Aussage transportiert, im Kontext des Arbeitszeugnisses ein mulmiges Gefühl bei Herrn B. hinterlässt, und auch beim Personalchef des neuen Arbeitgebers, dem dieses Arbeitszeugnis vorliegt?
Wie kommen derartige Bedeutungswechsel zustande und ist es tatsächlich so, dass die Mehrheit der Gesprächspartner genau diese Bedeutung korrekt erfasst? Und falls ja, wie ist es möglich, dass man mit einer Aussage unterschiedliches Meinen zum Ausdruck bringen kann, so dass es der Gesprächspartner auch im Sinne des Sprechers versteht? Durch Intuition? Durch Interpretation? Paul Grice hat in seiner Sprachphilosophie diese Fragen näher untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Kommunikation und Bedeutung
- 2 Die Bedeutung der Sprachphilosophie für die Kommunikation
- 3 Das Gricesche Programm
- 3.1 Die Maximen der rationalen Verständigung
- 3.2 Die Theorie der Implikatur
- 3.3 Die bedeutungstheoretische Funktion der Implikatur
- 4 Probleme, die sich aus der Implikatur ergeben
- 5 Fazit: Funktion und Bedeutung der Implikatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie der Implikatur von Paul Grice und deren Funktion in der Kommunikation. Ziel ist es, zu verstehen, wie Bedeutungswechsel in Abhängigkeit vom Kontext zustande kommen und wie Gesprächspartner diese Bedeutungen erfassen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Sprachphilosophie für das Verständnis von Kommunikation und analysiert Grices Programm zur Erklärung von Bedeutung und Äußerungsintention.
- Die Bedeutung von Kontext in der Kommunikation
- Grices Maximen der rationalen Verständigung
- Die Theorie der Implikatur und ihre bedeutungstheoretische Funktion
- Probleme und Herausforderungen der Implikaturtheorie
- Die Rolle der Sprachphilosophie im Verständnis von Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Kommunikation und Bedeutung: Die Einleitung illustriert anhand von Beispielen (Arbeitszeugnis, Einladung zum Biertrinken), wie ein und derselbe Satz je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. Dies führt zur zentralen Frage, wie diese Bedeutungsverschiebungen zustande kommen und ob und wie die Gesprächspartner diese korrekte Bedeutung erfassen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer Theorie, die diese Phänomene erklärt, und führt zur Vorstellung von Paul Grices Sprachphilosophie als ein mögliches Erklärungsmuster.
2 Die Bedeutung der Sprachphilosophie für die Kommunikation: Dieses Kapitel betont die Bedeutung der Sprachphilosophie für das Verständnis von Kommunikation. Es verweist auf den "linguistic turn" und die Erkenntnis, dass sprachliche Erkenntnisse nicht losgelöst von der Sprache untersucht werden können. Die Kapitel diskutiert die Ansichten von Locke, Wittgenstein und Austin zur Bedeutung von Sprache (als Abbildung der Wirklichkeit, Handlung, Mitteilung von Gedanken) und führt zu Grices Beschäftigung mit der Intersubjektivität von Sprache und der Übertragung von Wahrheitswerten zwischen Sender und Empfänger.
3 Das Gricesche Programm: Dieses Kapitel präsentiert Grices Theorie der propositionalen Einstellungen und unterscheidet zwischen subjektiven und intersubjektiven Äußerungsbedeutungen. Es erläutert Grices Maximen der rationalen Verständigung als Grundlage für erfolgreiches Kommunizieren innerhalb einer kooperativen Sprachgemeinschaft. Es wird dargelegt, dass die rekursive Semantik allein nicht ausreicht, um die Bedeutung eines Satzes vollständig zu erfassen und dass die Äußerungsintention im Kontext betrachtet werden muss.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Bedeutung, Implikatur, Paul Grice, Sprachphilosophie, Maximen der rationalen Verständigung, Kontext, Äußerungsintention, Sprechakte, Intersubjektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Implikaturtheorie nach Grice
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Implikaturtheorie von Paul Grice und ihre Funktion in der Kommunikation. Im Mittelpunkt steht das Verständnis, wie Bedeutungsverschiebungen kontextabhängig entstehen und wie Gesprächspartner diese Bedeutungen erfassen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, zu verstehen, wie Bedeutungswechsel in Abhängigkeit vom Kontext zustande kommen und wie Gesprächspartner diese Bedeutungen erfassen. Sie beleuchtet die Rolle der Sprachphilosophie für das Verständnis von Kommunikation und analysiert Grices Programm zur Erklärung von Bedeutung und Äußerungsintention.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Kontext in der Kommunikation, Grices Maximen der rationalen Verständigung, die Theorie der Implikatur und ihre bedeutungstheoretische Funktion, Probleme und Herausforderungen der Implikaturtheorie sowie die Rolle der Sprachphilosophie im Verständnis von Kommunikation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (Kommunikation und Bedeutung), Bedeutung der Sprachphilosophie für die Kommunikation, Das Gricesche Programm (inkl. Maximen, Implikatur und deren bedeutungstheoretische Funktion), Probleme der Implikatur und ein Fazit zur Funktion und Bedeutung der Implikatur. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was sind die zentralen Konzepte der Implikaturtheorie nach Grice?
Zentrale Konzepte sind Grices Maximen der rationalen Verständigung, die Unterscheidung zwischen subjektiven und intersubjektiven Äußerungsbedeutungen, die Rolle des Kontextes bei der Bedeutungserfassung und die Implikatur als Mittel zur Vermittlung von Bedeutungen über die wörtliche Bedeutung hinaus.
Welche Rolle spielt die Sprachphilosophie in dieser Arbeit?
Die Arbeit betont die Bedeutung der Sprachphilosophie für das Verständnis von Kommunikation. Sie verweist auf den "linguistic turn" und diskutiert die Ansichten von Philosophen wie Locke, Wittgenstein und Austin, um Grices Ansatz im Kontext der Sprachphilosophie zu verorten und zu begründen.
Welche Probleme werden im Zusammenhang mit der Implikaturtheorie angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen und Probleme, die sich aus der Anwendung der Implikaturtheorie ergeben, ohne konkrete Beispiele zu nennen. Die Zusammenfassung deutet an, dass diese Problematik im vierten Kapitel behandelt wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kommunikation, Bedeutung, Implikatur, Paul Grice, Sprachphilosophie, Maximen der rationalen Verständigung, Kontext, Äußerungsintention, Sprechakte, Intersubjektivität.
- Quote paper
- Matthias Wühle (Author), 2008, Wie funktioniert Kommunikation? - Die Theorie der Implikatur des Paul Grice, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112485