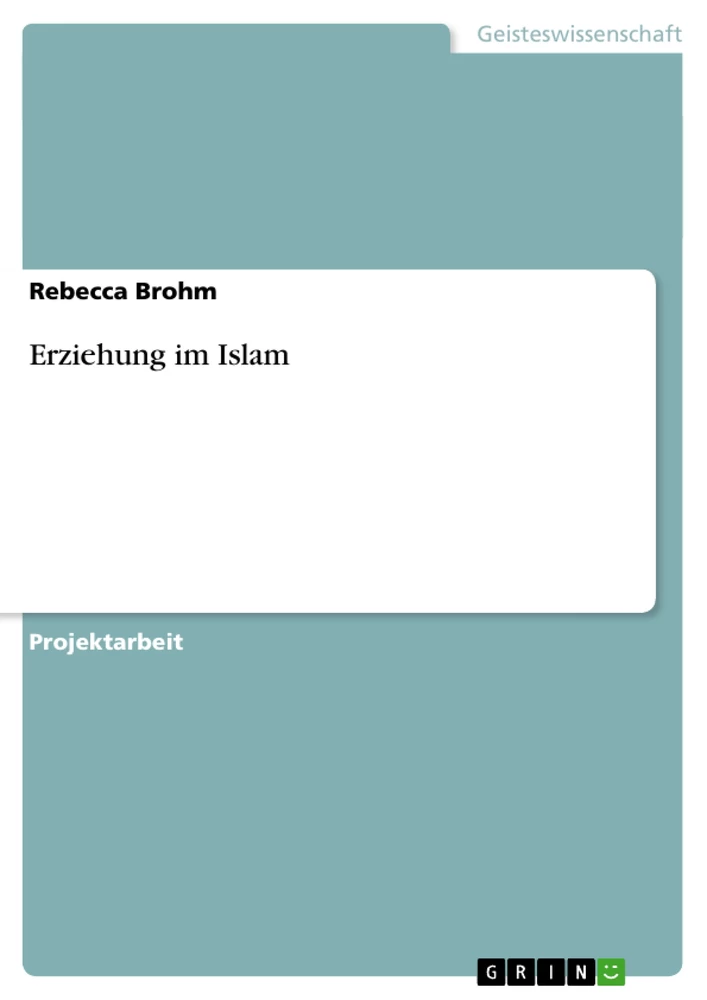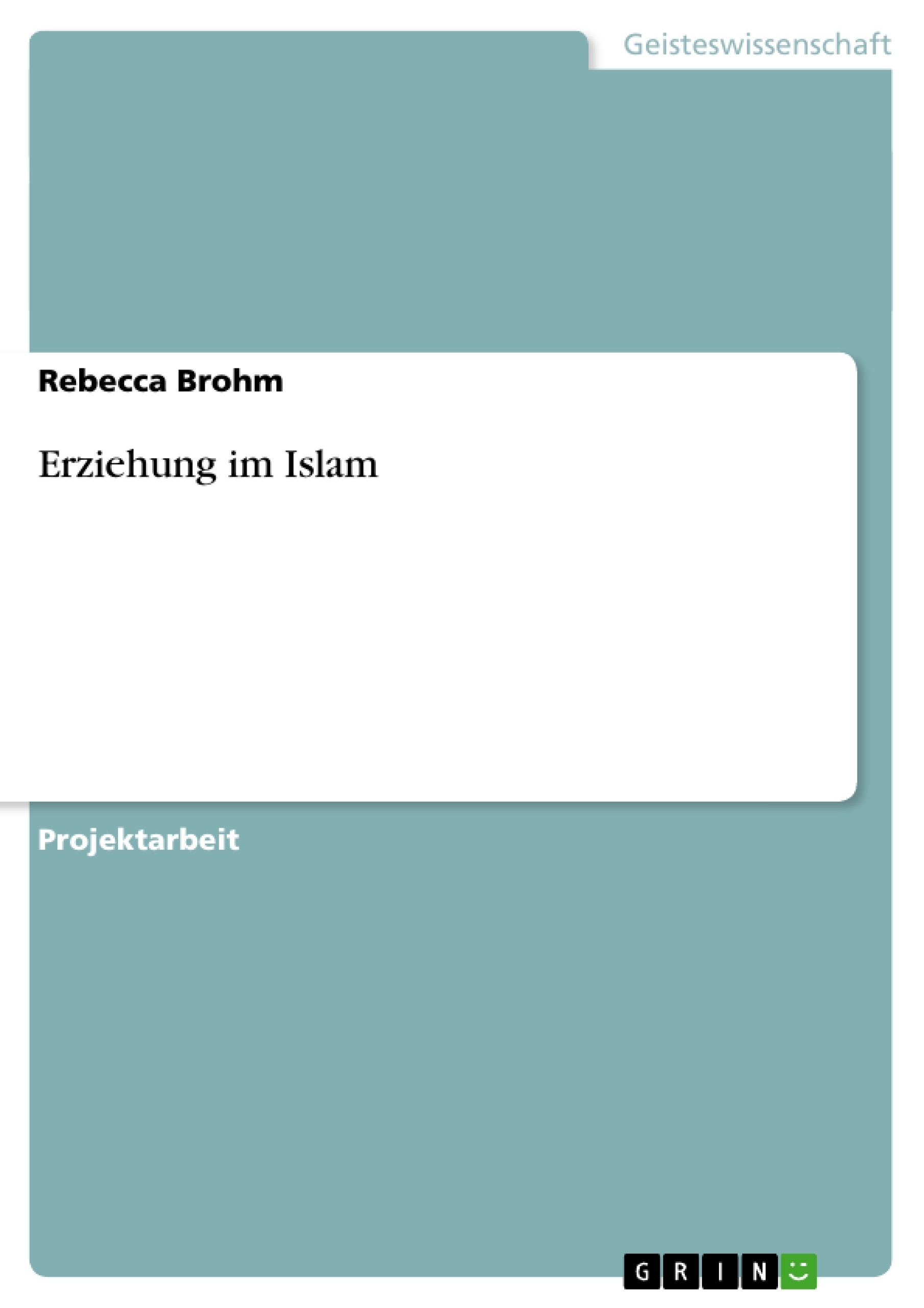Im Sommersemester 2005 machte ich ein Praktikum in einer Sozialen
Gruppenarbeit. In einer der Gruppen, die von 5 Mädchen und 7 Jungen im
Grundschulalter besucht wurde, kam es zu folgender Begebenheit:
Ayse und Zeynep (Namen geändert) kamen sehr aufgeregt in die Gruppe.
Sie erzählten von einem Monster, dass sie gesehen hätten und dass es wirklich
gäbe. Sie erzählten eine Geschichte von einem holländischen Mädchen, dass
Feuer gefangen hätte, weil es seinen Eltern ungehorsam war und außerdem
den Koran zerriss. Nun sei das Mädchen total entstellt und die Eltern würden es
einschläfern lassen wollen. Das ganze sei wirklich passiert, sie hätten ein Foto
von dem Mädchen gesehen. Wir –die Mitarbeiter der Sozialen Gruppenarbeitwollten
der Sache auf den Grund gehen. Wir fanden über das Internet heraus,
dass eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen das Bild des
vermeintlich entstellten Mädchens aufs Handy oder per Email geschickt
bekommen haben. Bei einer weiteren Recherche im Internet stieß ich
schließlich auf die Homepage einer amerikanischen Künstlerin, die das Thema
Gentechnologie in ihren Skulpturen kritisch bearbeitet. Das Foto von dem
angeblich entstellten Mädchen ist ein Ausschnitt aus einer ihrer Skulpturen. Auf
ihrer Homepage distanziert sie sich von der Geschichte des holländischen
Mädchens. Sie sei nicht ihrer Idee entwachsen, sondern irgendjemand hätte
unerlaubt ein Foto ihrer Skulptur hierzu verwendet. Überraschender Weise
glaubte die Mutter der Kinder selbst an die Echtheit der Geschichte, selbst
nachdem wir ihr die Homepage der Künstlerin zeigten. Auch von einer jungen
Muslima, der ich die vermeintliche Geschichte des Mädchens erzählte, kam
eine spontane Aussage in Richtung von „Und das ist wirklich passiert?“.
Hieraus ergaben sie folgende Fragestellungen: Wie werden Kinder im Islam
erzogen –sowohl von Seiten der Familie, als auch von Seiten islamischer
Vereine, Moscheen etc.? Und welche Bedeutung hat diese Erziehung für die
Arbeit in Kinder- und Jugendgruppen? In dem vorliegenden Text beschäftige ich
mich vorwiegend im mit der Situation von Kindern und Jugendlichen in
muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Projektidee
- 1.1 Entstehung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Erziehungsziele in der Familie
- 2.1 Vertraut machen mit religiösen Praktiken
- 2.2 Respekt und Gehorsam
- 2.3 Sexualmoral
- 2.4 Geschlechtsspezifische Erziehung
- 2.5 Wünsche von Eltern an Kinder- und Jugendgruppen
- 3. Erziehung von Seiten der Institution
- 3.1 In Deutschland
- 3.1.1 Koran und Freizeit
- 3.1.2 Muslimische Jugend Deutschland (MJD)
- 3.2 In der Türkei
- 4. Fazit für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht die Erziehungspraktiken in muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund und deren Bedeutung für die soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Studie basiert auf Literaturrecherche, Interviews und Fragebögen. Das Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die religiösen und kulturellen Einflüsse auf die Erziehung zu entwickeln und daraus Schlussfolgerungen für die interkulturelle Sozialarbeit zu ziehen.
- Erziehungsziele im Islam
- Der Einfluss religiöser Praktiken auf die Kindererziehung
- Geschlechtsspezifische Erziehung in muslimischen Familien
- Die Rolle islamischer Institutionen in der Erziehung
- Implikationen für die interkulturelle Sozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Projektidee: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Projektidee, ausgelöst durch eine Begebenheit in einer sozialen Gruppenarbeit mit Kindern, die eine erfundene Geschichte über ein bestraftes Mädchen glaubten. Diese Erfahrung führte zu den zentralen Forschungsfragen der Arbeit: Wie werden Kinder im Islam erzogen, und welche Bedeutung hat diese Erziehung für die Arbeit in Kinder- und Jugendgruppen? Der Fokus liegt auf Kindern und Jugendlichen in muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund. Die Methodik, bestehend aus Literaturstudium, Interviews und Fragebögen, wird ebenfalls erläutert.
2. Erziehungsziele in der Familie: Dieses Kapitel beleuchtet die Erziehungsziele in muslimischen Familien. Es betont, dass der Islam als natürliche Religion des Kindes angesehen wird, wobei die Religion des Vaters maßgeblich ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die konkreten Erziehungsziele von verschiedenen Faktoren abhängen, wie den Erfahrungen der Eltern und den gesellschaftlichen Bedingungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung religiöser Praktiken und Werte, die anhand von Beispielen und Zitaten aus Interviews illustriert werden. Werte wie Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Toleranz werden als wichtig hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Islam, Kindererziehung, muslimische Familien, Türkei, Deutschland, interkulturelle Sozialarbeit, religiöse Praktiken, Erziehungsziele, Migrationshintergrund, Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Erziehungspraktiken in muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Die Projektarbeit untersucht die Erziehungspraktiken in muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund und deren Bedeutung für die soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert Erziehungsziele, den Einfluss religiöser Praktiken, geschlechtsspezifische Erziehung und die Rolle islamischer Institutionen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie basiert auf einer Kombination aus Literaturrecherche, Interviews und Fragebögen, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu ermöglichen.
Welche Erziehungsziele werden in muslimischen Familien beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet die Vermittlung religiöser Praktiken und Werte wie Respekt, Gehorsam, Sexualmoral und die Bedeutung des Islam als natürliche Religion des Kindes (die Religion des Vaters ist maßgeblich). Weitere wichtige Werte sind Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Toleranz. Die konkreten Erziehungsziele hängen jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie den Erfahrungen der Eltern und den gesellschaftlichen Bedingungen.
Wie wird der Einfluss religiöser Praktiken dargestellt?
Die Projektarbeit untersucht, wie religiöse Praktiken die Kindererziehung beeinflussen. Sie zeigt anhand von Beispielen und Zitaten aus Interviews auf, wie der Islam den Alltag und die Erziehung prägt.
Welche Rolle spielt die geschlechtsspezifische Erziehung?
Die geschlechtsspezifische Erziehung in muslimischen Familien wird als wichtiger Aspekt der Studie behandelt und analysiert.
Welche Rolle spielen islamische Institutionen in der Erziehung?
Die Arbeit untersucht die Rolle islamischer Institutionen in Deutschland (z.B. Muslimische Jugend Deutschland (MJD)) und in der Türkei bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen.
Welche Schlussfolgerungen werden für die interkulturelle Sozialarbeit gezogen?
Die Projektarbeit zielt darauf ab, Schlussfolgerungen für die interkulturelle Sozialarbeit zu ziehen, um ein besseres Verständnis für die religiösen und kulturellen Einflüsse auf die Erziehung zu entwickeln und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus muslimischen Familien mit türkischem Migrationshintergrund zu verbessern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: 1. Die Projektidee (Entstehung und Vorgehensweise), 2. Erziehungsziele in der Familie (Religiöse Praktiken, Respekt, Gehorsam, Sexualmoral, Geschlechtsspezifische Erziehung, Elternerwartungen), 3. Erziehung von Seiten der Institution (Deutschland, Türkei) und 4. Fazit für die Soziale Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Islam, Kindererziehung, muslimische Familien, Türkei, Deutschland, interkulturelle Sozialarbeit, religiöse Praktiken, Erziehungsziele, Migrationshintergrund, Sozialisation.
Wie entstand die Projektidee?
Die Projektidee entstand aus einer Begebenheit in einer sozialen Gruppenarbeit mit Kindern, die eine erfundene Geschichte über ein bestraftes Mädchen glaubten. Diese Erfahrung führte zu den zentralen Forschungsfragen der Arbeit.
- Quote paper
- Bachelor Soziale Arbeit Rebecca Brohm (Author), 2007, Erziehung im Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112322