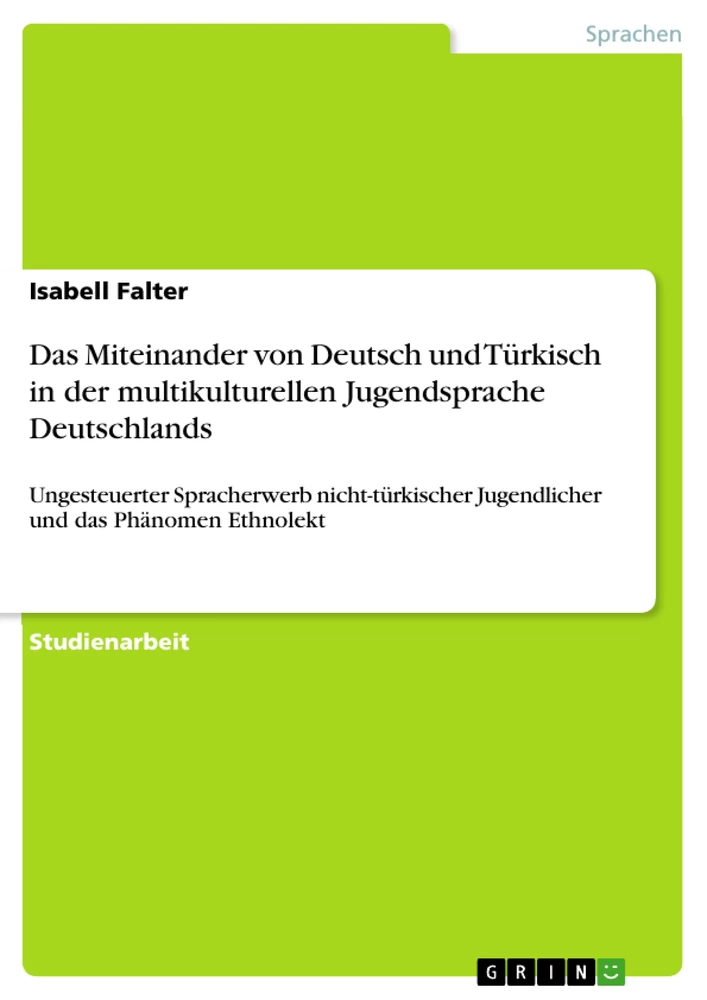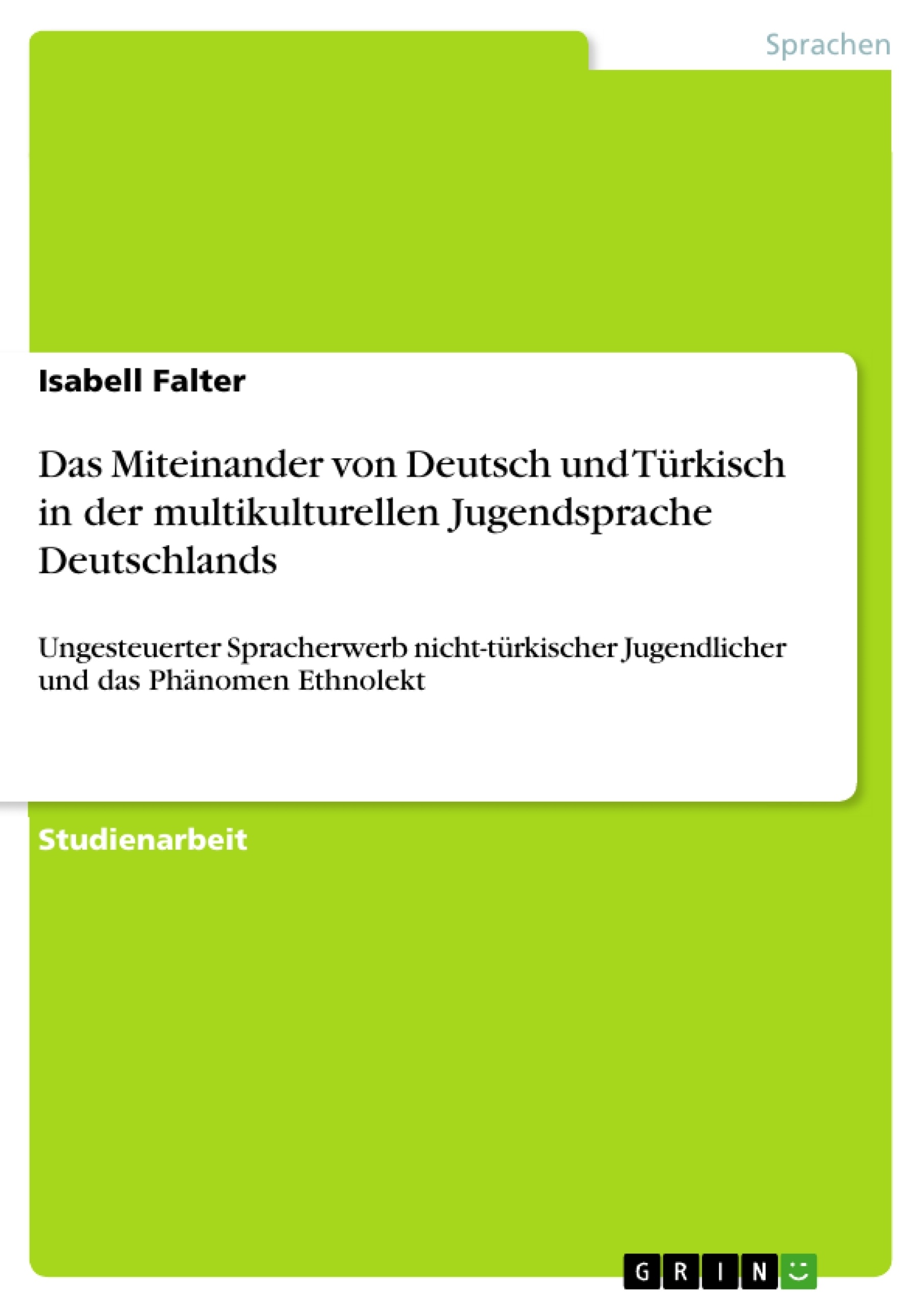Auch wer sich nicht von der wissenschaftlichen Seite mit dem Phänomen Sprachkontakt beschäftigt, dem bleibt die zunehmende Tendenz einer multikulturellen und damit eben auch gemischtsprachigen Gesellschaft in Deutschland nicht verborgen. In nahezu allen Situationen des alltäglichen Lebens, beim Einkauf, in Bus und Bahn sowie im Schul- und Arbeitsleben trifft auf man Menschen, die sich eben nicht nur monolingual in Deutsch unterhalten können. Gerade in Stadtteilen mit einer multiethnischen Bevölkerungszusammensetzung (wie etwa in Hamburg-Altona oder Berlin-Neukölln) liegt keine einheitliche Sprachlandschaft vor. Schilder, Aushänge, Werbeplakate, Speisekarten und sogar amtliche Formulare sind längst mehrsprachig oder in den jeweiligen Landessprachen formuliert.
Vor allem das Türkische ist in genau diesem multikulturellen Deutschland stets präsent. Bedingt durch die Zuwanderung in den 1960er Jahren existiert heute in der 3. Generation eine große Sprechergemeinschaft, die sowohl Türkisch als auch Deutsch beherrscht und anwendet. So kommt es gerade in der Schule und Freizeit zu Begegnungen zwischen türkischen Jugendlichen und Jugendlichen nicht-türkischer Herkunft.
Im Fokus dieser Arbeit steht genau dieser Sprachkontakt. Viele anderssprachige Jugendlichen beginnen bewusst oder unbewusst mit dem Erlernen des Türkischen. Hierbei geht es immer um den natürlichen, ungesteuerten Spracherwerb der im Alltag geschieht und nicht von Institutionen wie der Schule gesteuert wird. Die Türkischkompetenz der Lerner weist ein breites Spektrum auf und reicht von floskelhaften Begrüßungen bis hin zu einer Sprachkompetenz, die von der eines Muttersprachlers kaum zu unterscheiden ist. Im Vordergrund der Arbeit stehen weniger die soziokulturellen Beweggründe der Lerner, sondern die Strategien des Spracherwerbs sowie die pragmatische Anwendung der Kenntnisse in der Kommunikation.
Auf der anderen Seite steht der Bevölkerungsteil Deutschlands, der nicht zwangsläufig in direktem Kontakt zu Türkischsprechern stehen muss und dennoch den Eindruck vermittelt, mit den Grundzügen der Sprache vertraut zu sein. Der ethnolektale Sprachstil erfreut sich nicht nur unter Jugendlichen großer Beliebtheit und ist dank der Medien und einiger „Comedians“ in aller Munde. Auch diesem Phänomen wendet sich diese Arbeit zu, stellt die Grundzüge vor und grenzt gleichzeitig den Ethnolekt von anderen sprachlichen Registern wie dem Gastarbeiterdeutsch ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Türkischerwerb durch jugendliche Sprecher nicht-türkischer Herkunft
- Kontext der Datenerhebung
- Erwerbssituationen
- Strategien des Spracherwerbs
- Anwendung türkischer Sprachkenntnisse
- Türkische Routinen in der Anrede
- Sprachliche Routinen zu Beginn und Ende eines Diskurses
- Diskurssteuernde Elemente
- Das Phänomen Ethnolekt
- Definition
- Der primäre Ethnolekt
- Der sekundäre Ethnolekt
- Der tertiäre Ethnolekt
- Gründe für Aneignung und Verwendung des stilisierten Ethnolekts
- Definition
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den ungesteuerten Erwerb des Türkischen durch deutsche und anderssprachige Jugendliche und die Verwendung türkischer Sprachkenntnisse in der alltäglichen Kommunikation. Der Fokus liegt auf den Strategien des Spracherwerbs und der pragmatischen Anwendung des Türkischen, weniger auf den soziokulturellen Hintergründen. Zusätzlich wird das Phänomen des Ethnolekts beleuchtet und von anderen sprachlichen Registern abgegrenzt.
- Ungesteuerter Erwerb des Türkischen durch Jugendliche nicht-türkischer Herkunft
- Strategien des informellen Spracherwerbs
- Pragmatische Anwendung von Türkischkenntnissen im Alltag
- Das Phänomen Ethnolekt: Definition und Abgrenzung
- Analyse der Anwendung türkischer Elemente in der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext zunehmender Sprachmischung in Deutschland, besonders den Einfluss des Türkischen aufgrund der Zuwanderung. Sie führt das Thema des ungesteuerten Türkischerwerbs durch Jugendliche nicht-türkischer Herkunft ein und betont den Fokus auf die Erwerbsstrategien und die pragmatische Anwendung der erworbenen Sprachkenntnisse, sowie auf das Phänomen des Ethnolekts.
Türkischerwerb durch jugendliche Sprecher nicht-türkischer Herkunft: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Datenerhebung, basierend auf dem Forschungsprojekt „Türkisch in gemischtkulturellen Gruppen von Jugendlichen“. Es analysiert die Erwerbssituationen, die von einem allgegenwärtigen türkischen Sprachumfeld und persönlichen Kontakten zu türkischen Sprechern geprägt sind. Schließlich werden die Strategien des Spracherwerbs beleuchtet, die von aktivem Zuhören, Nachfragen und der Anwendung des Gelernten gekennzeichnet sind, wobei die Jugendlichen oft ihre Freunde als „Sprachexperten“ konsultieren. Der Erwerb erfolgt ungesteuert und ohne den Druck institutioneller Lernkontexte.
Anwendung türkischer Sprachkenntnisse: Dieses Kapitel behandelt die praktische Anwendung der erworbenen Türkischkenntnisse. Es werden verschiedene Aspekte der Kommunikation untersucht, darunter die Verwendung türkischer Routinen in Anreden, sprachliche Routinen zu Beginn und Ende von Diskursen, sowie diskurs-steuernde Elemente. Der Fokus liegt auf der pragmatischen Funktion der türkischen Elemente im alltäglichen Sprachgebrauch der Jugendlichen. Der Abschnitt hebt die Bedeutung der Kontextualisierung der Sprachverwendung hervor.
Das Phänomen Ethnolekt: Dieses Kapitel definiert den Ethnolekt und unterscheidet zwischen primärem, sekundärem und tertiärem Ethnolekt. Es untersucht die Gründe für die Aneignung und Verwendung des stilisierten Ethnolekts unter Jugendlichen, die oft aus der Bewunderung, Identifizierung oder dem Spaß an der Verwendung dieser sprachlichen Elemente resultieren. Das Kapitel positioniert den Ethnolekt im Kontext anderer sprachlicher Register.
Schlüsselwörter
Ungesteuerter Spracherwerb, Türkisch, Jugendsprache, multikulturelle Gesellschaft, Ethnolekt, Sprachkontakt, Kommunikationsstrategien, Pragmatik, interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zu: Ungesteuerter Türkischerwerb bei Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den informellen Erwerb der türkischen Sprache durch Jugendliche nicht-türkischer Herkunft in Deutschland und die Anwendung dieser Sprachkenntnisse im alltäglichen Sprachgebrauch. Der Fokus liegt auf den Strategien des Spracherwerbs und der pragmatischen Verwendung des Türkischen, einschließlich des Phänomens des Ethnolekts.
Welche Aspekte des Türkischerwerbs werden behandelt?
Die Arbeit analysiert den Kontext der Datenerhebung (basierend auf dem Forschungsprojekt „Türkisch in gemischtkulturellen Gruppen von Jugendlichen“), die Erwerbssituationen (z.B. Sprachumfeld, Kontakte zu türkischsprachigen Personen), und die Strategien des Spracherwerbs (aktives Zuhören, Nachfragen, Lernen von Freunden). Ein Schwerpunkt liegt auf dem ungesteuerten, informellen Charakter des Erwerbs.
Wie wird die Anwendung der Türkischkenntnisse beschrieben?
Die Arbeit untersucht die pragmatische Anwendung des Türkischen in der alltäglichen Kommunikation. Dies beinhaltet die Analyse von Anredeformen, sprachlichen Routinen am Anfang und Ende von Gesprächen, und diskurs-steuernden Elementen. Die Bedeutung der Kontextualisierung der Sprachverwendung wird hervorgehoben.
Was ist ein Ethnolekt und wie wird er in dieser Arbeit behandelt?
Der Ethnolekt wird definiert und in primären, sekundären und tertiären Ethnolekt unterschieden. Die Arbeit untersucht die Gründe für die Aneignung und Verwendung des stilisierten Ethnolekts bei Jugendlichen (z.B. Identifikation, Spaß, Bewunderung) und setzt ihn in Relation zu anderen sprachlichen Registern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Türkischerwerb bei Jugendlichen, ein Kapitel zur Anwendung türkischer Sprachkenntnisse, ein Kapitel zum Ethnolekt und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, Angaben zur Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ungesteuerter Spracherwerb, Türkisch, Jugendsprache, multikulturelle Gesellschaft, Ethnolekt, Sprachkontakt, Kommunikationsstrategien, Pragmatik, interkulturelle Kommunikation.
Wo liegen die Schwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf den ungesteuerten Erwerb des Türkischen durch Jugendliche nicht-türkischer Herkunft, deren Strategien des informellen Spracherwerbs, die pragmatische Anwendung von Türkischkenntnissen im Alltag, sowie die Definition und Abgrenzung des Phänomens Ethnolekt und dessen Analyse in der Jugendsprache. Soziokulturelle Hintergründe werden weniger detailliert behandelt.
Auf welcher Datenbasis basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert auf dem Forschungsprojekt „Türkisch in gemischtkulturellen Gruppen von Jugendlichen“. Die genauen Daten und Methoden der Datenerhebung werden im Kapitel zum Türkischerwerb detaillierter beschrieben.
- Quote paper
- Isabell Falter (Author), 2008, Das Miteinander von Deutsch und Türkisch in der multikulturellen Jugendsprache Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112253