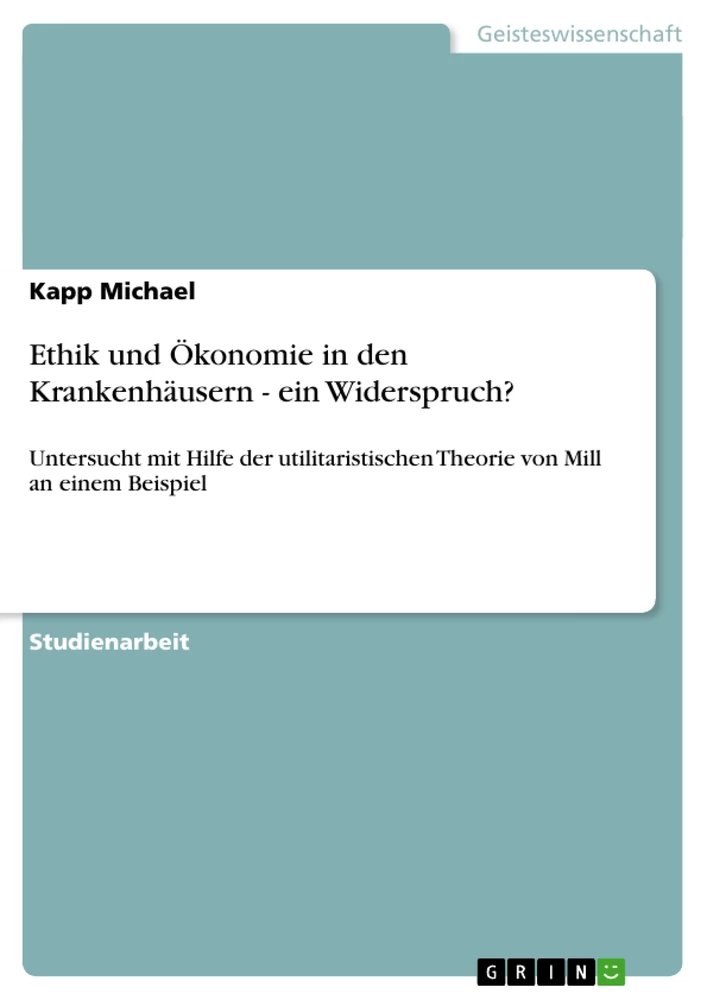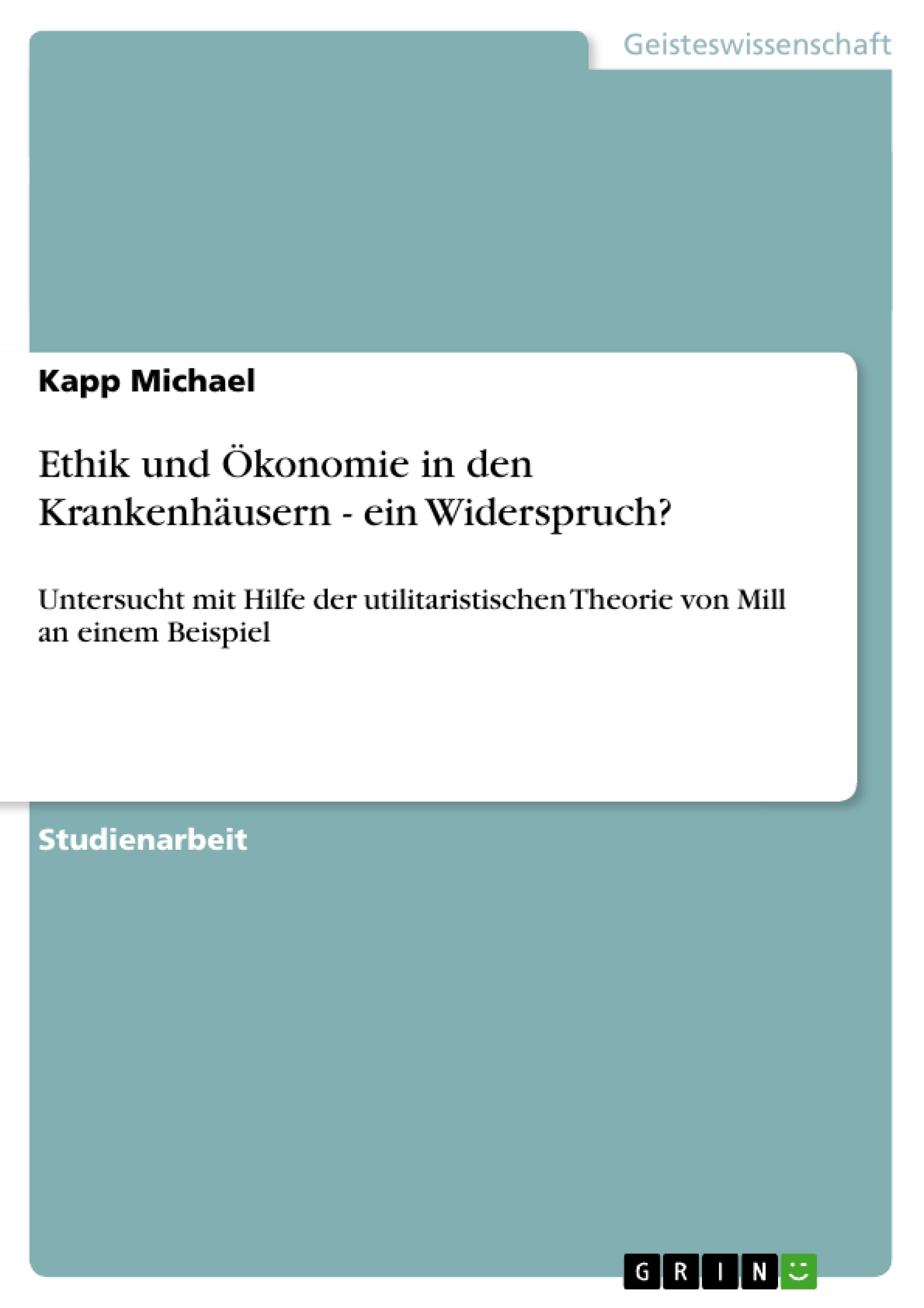Die Frage, ob Ethik und Ökonomie ein Widerspruch ist, stellt sich heute immer häufiger, in der Gesellschaft als Ganzes, sowie auch in unserem Gesundheitssystem. Siehe auch den aktuellen Fall von Nokia oder den vor 4 Jahren der Deutschen Bank. Beide Beispiele zeigen doch, dass Firmen trotz milliardenschwerer Einnahmen Menschen entlassen oder die Produktion verlagern, um noch höhere Gewinne zu erzielen. Hier stellen sich dann Fragen von Moral, Werten und Ethik. Solche Beispiele gibt es zuhauf. Dabei zählen nur die Zahlen, die Ausdruck bekommen im Aktienkurs (Shareholder Value), Wachstumsraten, ausgewiesenen Gewinnen und Rentabilität. Unbestritten ist auch, dass der ökonomische Gedanke „Wirtschaftlichkeit“ sich in Deutschlands Gesundheitssystem etabliert hat und mehr und mehr als Leitlinie gesehen wird. Diese genannten Interessen sind bei den Privaten Kliniken von zentraler Bedeutung, da dies eben deren Ziele sind. Aber auch die kirchlichen und öffentlichen Häuser müssen zumindest kostendeckend arbeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Geldmittel knapper werden, und die Patientenzahl aufgrund der älter werdenden Gesellschaft steigt, d.h. dadurch entstehen Verteilungsprobleme, die aus ethischer Sicht nicht so einfach zu lösen sind. Die Leitfrage die mich zu dem Thema bewegt hat ist, ob dieser Zielkonflikt zwischen Ressourcenverknappung in den Krankenhäusern und der optimalen Versorgung des Patienten, ethisch gelöst werden kann? Könnte der utilitaristische Ansatz von John Stuart Mill (1806-1873) eine Möglichkeit sein? Was dabei interessant ist, dass Mill zu den Begründern der Ökonomischen Theorie gehört, und somit hier ein Zusammenhang zwischen seiner utilitaristischen Ethik und des heute wirtschaftlichen Handelns besteht. In der „Teleologischen Ethik“, zu der der Utilitarismus zählt, ergibt sich der moralische Wert einer Handlung aus den Folgen für die Allgemeinheit. Eine Wertung ob die Handlung moralisch, gut und sittlich ist, hängt mit dem daraus entstehenden Nutzen zusammen. Nach dieser Theorie ist es möglich, dass eine Handlungsentscheidung auf Kosten des Wohlergehens eines Einzelnen und zugunsten des Wohlergehens der Mehrheit getroffen wird (vgl. Krüger / Rapp; 2006).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Auswirkung der Ökonomie in der Praxis im Krankenhaus
- Prekäre Pflegesituation erläutert an einem Beispiel
- Subjektive Folgen des Beispiels
- Objektive Folgen des Beispiels (RICHI-Nursing Studie)
- Resümee der subjektiven und objektiven Folgen
- Utilitaristische Ethik
- Die Theorie der Utilitaristischen Ethik von John Stuart Mill (1806-1873)
- Resümee der Theorie von Mill
- Die Anwendung des Utilitarismus an dem Fallbeispiel
- Ethische Analyse nach Brody H.
- Ergebnis und Reflexion der Analyse nach Brody H.
- Probleme des Utilitarismus
- Expertenstatus
- Folgenabschätzung und Wertbestimmung
- Vertrauenswürdigkeit von Experten
- Bestimmung des Gutes
- Verantwortungsträger
- Fairness
- Regelverstöße
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht, ob Ethik und Ökonomie im Krankenhaus einen Widerspruch darstellen. Sie analysiert die Auswirkungen von ökonomischen Entscheidungen auf die Pflegesituation und die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus anhand eines Beispiels aus der operativen Abteilung eines Zentral-OPs. Die Arbeit untersucht, ob der utilitaristische Ansatz von John Stuart Mill eine ethische Lösung für den Zielkonflikt zwischen Ressourcenverknappung und optimaler Patientenversorgung bieten kann.
- Die Auswirkungen der Ökonomisierung im Krankenhausalltag auf die Pflegequalität und die Arbeitszufriedenheit des Personals.
- Die Anwendung der utilitaristischen Ethik von John Stuart Mill auf die beschriebene Situation im Krankenhaus.
- Die Analyse der Stärken und Schwächen des utilitaristischen Ansatzes im Kontext der ethischen Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen.
- Die Diskussion der Probleme, die sich aus der Anwendung des Utilitarismus ergeben, insbesondere in Bezug auf die Objektivität des Experten, die Folgenabschätzung und die Wertbestimmung.
- Die Suche nach einer möglichen Lösung des Zielkonflikts zwischen Ethik und Ökonomie im Krankenhaus.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Frage, ob Ethik und Ökonomie im Krankenhaus einen Widerspruch darstellen. Sie beleuchtet die aktuelle Situation in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen, die geprägt ist von ökonomischen Zwängen und Ressourcenverknappung. Die Leitfrage der Arbeit lautet, ob der utilitaristische Ansatz von John Stuart Mill eine ethische Lösung für den Zielkonflikt zwischen Ressourcenverknappung und optimaler Patientenversorgung bieten kann.
Das zweite Kapitel beschreibt die Auswirkungen der Ökonomie in der Praxis im Krankenhaus. Anhand eines Beispiels aus der operativen Abteilung eines Zentral-OPs werden die Folgen der Ressourcenverknappung für die Pflegequalität und die Arbeitsbedingungen des Personals dargestellt. Die subjektiven Folgen für die Mitarbeiter, wie Arbeitsunzufriedenheit, Motivationsverlust und steigende Ausfallquote, werden ebenso beschrieben wie die objektiven Folgen, die sich in der RICHI-Nursing Studie widerspiegeln. Die Studie belegt, dass die Rationalisierung der Pflege zu schlechteren Resultaten, wie Patientenunzufriedenheit, höheren Komplikationsraten und erhöhten Kosten, führt.
Im dritten Kapitel wird die utilitaristische Ethik von John Stuart Mill vorgestellt. Die Theorie besagt, dass eine Handlung moralisch als „gut" oder „richtig" bewertet wird, wenn sie das „größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen" zum Ziel hat. Mill definiert „Glück" als Lust und das Freisein von Unlust. Die moralische Korrektheit einer Handlung ist an den zu kalkulierenden Folgen zu beurteilen. Der Utilitarismus fordert von jedem Handelnden, zwischen seinem eigenen Glück und dem der anderen mit ebenso strenger Unparteilichkeit zu entscheiden wie ein unbeteiligter und wohlwollender Zuschauer.
Das vierte Kapitel wendet den Utilitarismus auf das Fallbeispiel aus dem Krankenhaus an. Mithilfe des utilitaristischen Analysemodells von Brody werden die verschiedenen Handlungsoptionen und deren Folgen analysiert. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die „arbeitnehmerfreundlichen" und „qualitätssichernden" Handlungen in der Rangfolge vorne liegen.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Problemen des Utilitarismus. Es werden die Kritikpunkte der Theorie diskutiert, wie zum Beispiel die Frage nach dem Expertenstatus, die Folgenabschätzung und die Wertbestimmung, die Objektivität des Experten, die Bestimmung des Gutes, die Verantwortungsträger, die Fairness und die Regelverstöße.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ethik und Ökonomie im Gesundheitswesen, insbesondere im Krankenhaus. Die Arbeit analysiert den Widerspruch zwischen diesen beiden Bereichen anhand des utilitaristischen Ansatzes von John Stuart Mill. Weitere wichtige Themen sind die Folgen der Ökonomisierung im Krankenhaus, die Rationalisierung der Pflege, die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals, die Patientenversorgung und die ethische Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Die Analyse beleuchtet die Probleme des Utilitarismus, wie zum Beispiel die Objektivität des Experten, die Folgenabschätzung, die Wertbestimmung und die Fairness.
- Quote paper
- Kapp Michael (Author), 2008, Ethik und Ökonomie in den Krankenhäusern - ein Widerspruch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112109