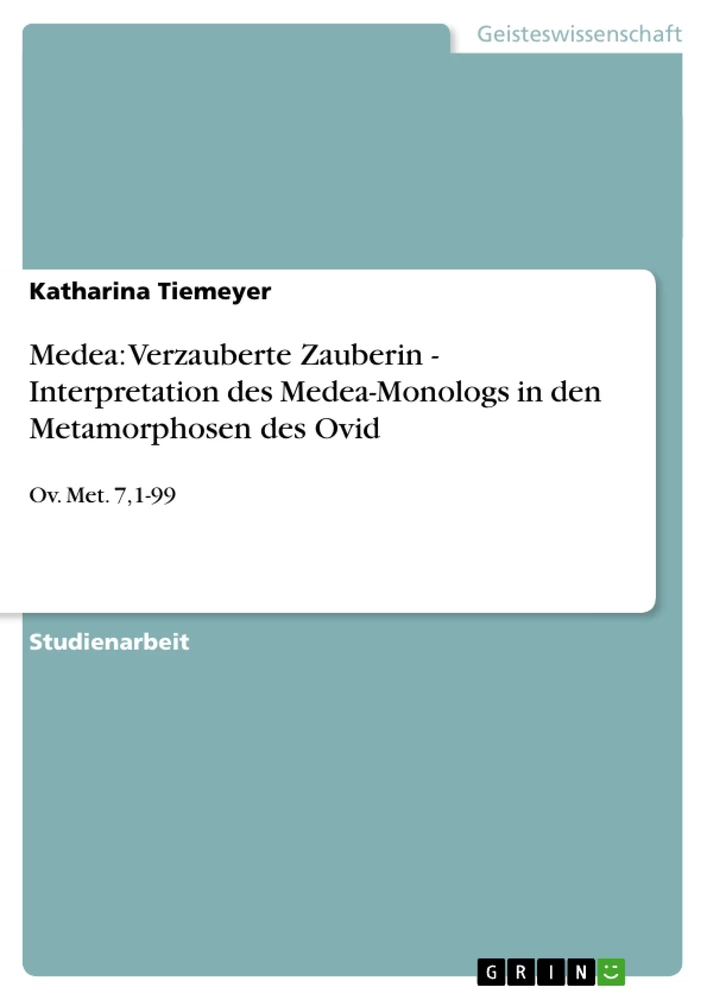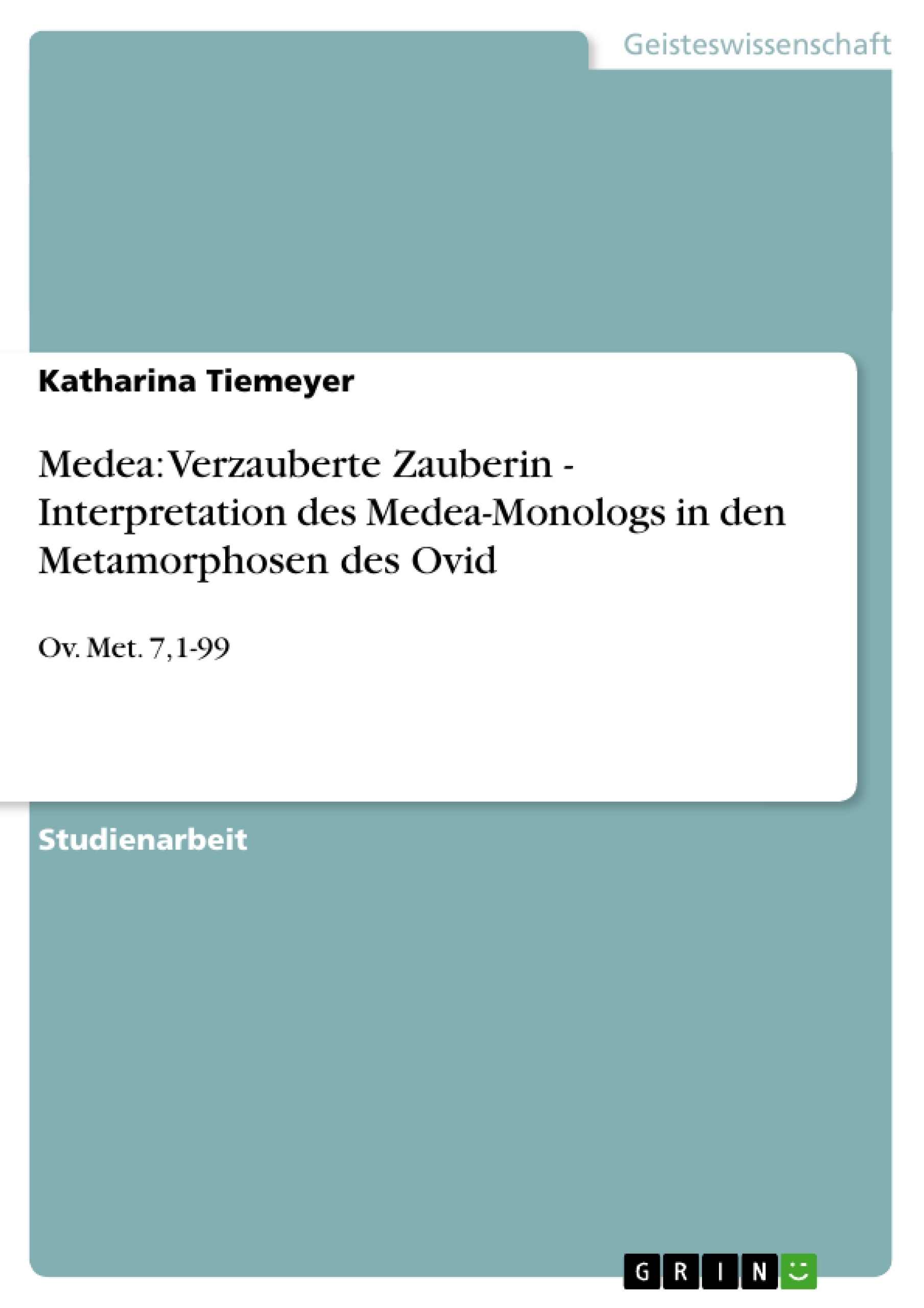Sie ist eine dämonische Frauengestalt voll düsterer Tragik: wir kennen sie als leidenschaftliche Rächerin, brutale Mörderin, gefährliche Zauberin – die Attribute des Bösen, die dieser Figur zugeschrieben werden, sind von unerschöpflicher Vielfalt: Medea.
Der Mythos um diese Frau, der bis in die vorhomerische Tradition zurückreicht, hat seit der Antike bis in die Gegenwart eine Vielzahl von Dichtern immer wieder fasziniert und zu zahlreichen Werken inspiriert, die, was das Wesen der Medea betrifft, stark variieren. Allgemein jedoch ist diese Frau als „die gewaltigste Zauberin der Antike“ in die Geschichte eingegangen, die in ihrer Leidenschaft vor keiner, noch so grausamen Tat zurückschreckt.
Auch Ovid hatte es diese sagenumwobene Frauengestalt angetan, er widmete sich ihr in seinem Werk gleich dreimal: Neben einer verschollenen Tragödie , findet sich der Medea-Mythos auch in den Heroides und in den Metamorphosen .
Der mythologische Hintergrund gehörte zum Allgemeinwissen eines gebildeten Römers und es steht außer Frage, dass Ovid die entsprechenden literarischen Vorlagen, [...], gekannt und seinem Werk zugrunde gelegt hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er die Sage einfach übernommen und nacherzählt hat. [...].Während Medea und ihre Geschichte in der mythologischen Überlieferung sowie bei den Autoren vor seiner Zeit immer stark in Zusammenhang mit der Argonautensage steht und in einem Atemzug mit Iason genannt wird, fällt bei Ovid auf, dass ihn vor allem die Zauberin selbst interessiert hat und die Geschichte vom Goldenen Vlies bei ihm nur schmückender Hintergrund für das eigentliche Motiv, das Wesen Medeas, ist.
Besonders auffällig ist dies in der Medea-Episode in den Metamorphosen, von der ein Ausschnitt in dieser Arbeit analysiert und interpretiert werden soll. [...]
In dieser Arbeit gilt das Interesse den ersten 99 Versen des ersten Teils, da Medea sich noch in Kolchis befindet. Diese Textpassage kennzeichnet vor allem ein Monolog Medeas vor ihrer Entscheidung für Iason. Es folgt die Begegnung mit Iason im Tempel der Hekate. Danach setzt sich die Erzählung fort mit der Beschreibung der drei Kämpfe, die der Argonaut in Kolchis auszustehen hat, bevor er als Sieger davonzieht. [...]. Die Textauswahl beschränkt sich somit auf die Szene, die der Dichter ganz der Figur der Medea, ihrem inneren Gemütszustand und ihrer Liebe zu Iason gewidmet hat. Im Zentrum der Analyse soll ihr Monolog stehen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Einordnung der Textpassage in den mythologischen und literarischen Kontext
- 2. Aufbau und Struktur
- 3. Interpretation
- 3.1. Die Verzauberung: Die Ankunft der Argonauten in Kolchis (V.1-11a)
- 3.2. Die Zauberin und der nescio quis deus: Der Monolog Medeas (V.11b-73)
- 3.2.1. Medea zwischen furor und ratio
- 3.2.2. Plädoyer für den Geliebten
- 3.2.3. Scheinbar gesiegt?
- 3.2.4. Rhetorisches Spiel oder Ausdruck wahrer Gefühle?
- 3.3. Liebeszauber: Die Begegnung mit Iason im Tempel (V.74-99)
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und interpretiert einen Auszug aus Ovids Metamorphosen (7,1-99), der Medeas Monolog vor ihrer Entscheidung für Iason beschreibt. Ziel ist es, Ovids Darstellung von Medeas Gefühlswelt und die Frage nach der Natur ihrer Liebe zu Iason zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die literarische Gestaltung und vermeidet einen intertextuellen Vergleich mit anderen Medea-Darstellungen.
- Ovids literarische Gestaltung von Medeas innerem Konflikt
- Die Darstellung von Liebe und Verzauberung bei Ovid
- Medeas Rolle im Kontext des Argonautenmythos bei Ovid
- Analyse des Medeamonologs im Hinblick auf Rhetorik und Emotionen
- Die Ambivalenz der Figur Medea zwischen Vernunft und Leidenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt Medea als vielschichtige Figur des Mythos vor, die von verschiedenen Autoren unterschiedlich interpretiert wurde. Ovids Fokus auf die Zauberin selbst, im Gegensatz zur traditionellen Verbindung mit der Argonautensage, wird hervorgehoben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse eines Auszugs aus Ovids Metamorphosen (7,1-99), der Medeas Monolog vor ihrer Entscheidung für Iason darstellt, ohne dabei auf andere Medea-Darstellungen einzugehen.
II. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst wird die Textpassage in den mythologischen und literarischen Kontext eingeordnet, wobei die verschiedenen Versionen des Argonautenmythos und Ovids Umgang mit seinen literarischen Vorlagen (insbesondere Euripides und Apollonius von Rhodos) beleuchtet werden. Der zweite Abschnitt analysiert den Aufbau und die Struktur des ausgewählten Textausschnitts, wobei der Fokus auf Medeas Monolog liegt. Der dritte Teil liefert eine detaillierte Interpretation des Monologs, unterteilt in die Ankunft der Argonauten, Medeas inneren Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft, ihr Plädoyer für Iason und die Frage nach der Echtheit ihrer Gefühle. Die Begegnung mit Iason im Tempel der Hekate wird ebenfalls interpretiert.
Schlüsselwörter
Medea, Ovid, Metamorphosen, Argonautenmythos, Monolog, Verzauberung, Liebe, Leidenschaft, Zauberin, furor, ratio, Rhetorik, literarische Analyse, mythologischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Ovids Medea-Monolog (Metamorphosen 7,1-99)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert und interpretiert einen Auszug aus Ovids Metamorphosen (Buch 7, Verse 1-99). Der Fokus liegt auf Medeas Monolog vor ihrer Entscheidung für Iason, wobei ihre Gefühlswelt und die Natur ihrer Liebe zu Iason im Mittelpunkt stehen. Intertextuelle Vergleiche mit anderen Medea-Darstellungen werden vermieden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Ovids literarische Gestaltung von Medeas innerem Konflikt, die Darstellung von Liebe und Verzauberung, Medeas Rolle im Kontext des Argonautenmythos bei Ovid, die Rhetorik und Emotionen in Medeas Monolog und die Ambivalenz der Figur zwischen Vernunft und Leidenschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Der Hauptteil ist in drei Abschnitte unterteilt: Einordnung des Textes in den mythologischen und literarischen Kontext, Analyse des Aufbaus und der Struktur des Textauszugs und eine detaillierte Interpretation des Medeamonologs (inkl. Ankunft der Argonauten, Medeas innerer Konflikt, ihr Plädoyer für Iason, die Echtheit ihrer Gefühle und die Begegnung mit Iason im Tempel der Hekate).
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf Ovids Metamorphosen (Buch 7, Verse 1-99). Der mythologische und literarische Kontext wird beleuchtet, wobei die verschiedenen Versionen des Argonautenmythos und Ovids Umgang mit seinen literarischen Vorlagen (insbesondere Euripides und Apollonius von Rhodos) berücksichtigt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medea, Ovid, Metamorphosen, Argonautenmythos, Monolog, Verzauberung, Liebe, Leidenschaft, Zauberin, furor, ratio, Rhetorik, literarische Analyse, mythologischer Kontext.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Untersuchung von Ovids Darstellung von Medeas Gefühlswelt und die Frage nach der Natur ihrer Liebe zu Iason. Die Arbeit konzentriert sich auf die literarische Gestaltung des Monologs und vermeidet einen Vergleich mit anderen Medea-Darstellungen.
Welche Aspekte von Medeas Charakter werden besonders betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Medeas inneren Konflikt zwischen Vernunft (ratio) und Leidenschaft (furor), ihre rhetorischen Fähigkeiten im Monolog und die Ambivalenz ihrer Gefühle für Iason.
Wie wird der Monolog selbst analysiert?
Der Monolog wird in verschiedene Abschnitte unterteilt und im Detail interpretiert, unter Berücksichtigung von rhetorischen Mitteln und der Entwicklung von Medeas Emotionen.
Welche Rolle spielt der mythologische Kontext?
Der mythologische Kontext (Argonautenmythos) dient als Grundlage für das Verständnis von Medeas Situation und ihren Entscheidungen. Die Arbeit untersucht, wie Ovid diesen Mythos in seiner Darstellung verarbeitet.
- Quote paper
- Katharina Tiemeyer (Author), 2004, Medea: Verzauberte Zauberin - Interpretation des Medea-Monologs in den Metamorphosen des Ovid, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112095