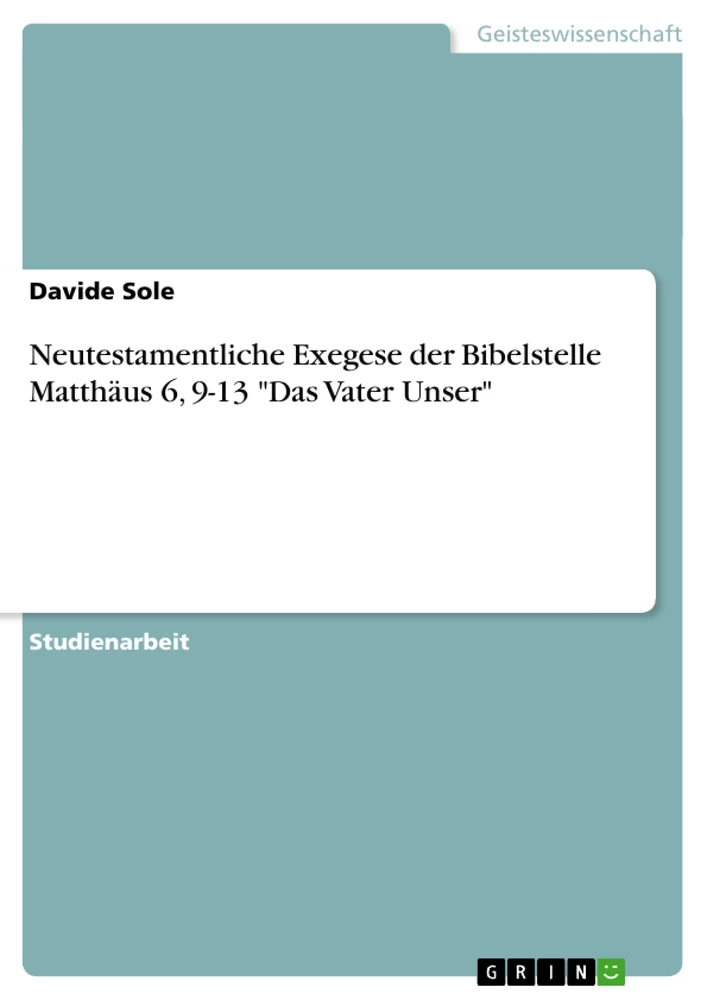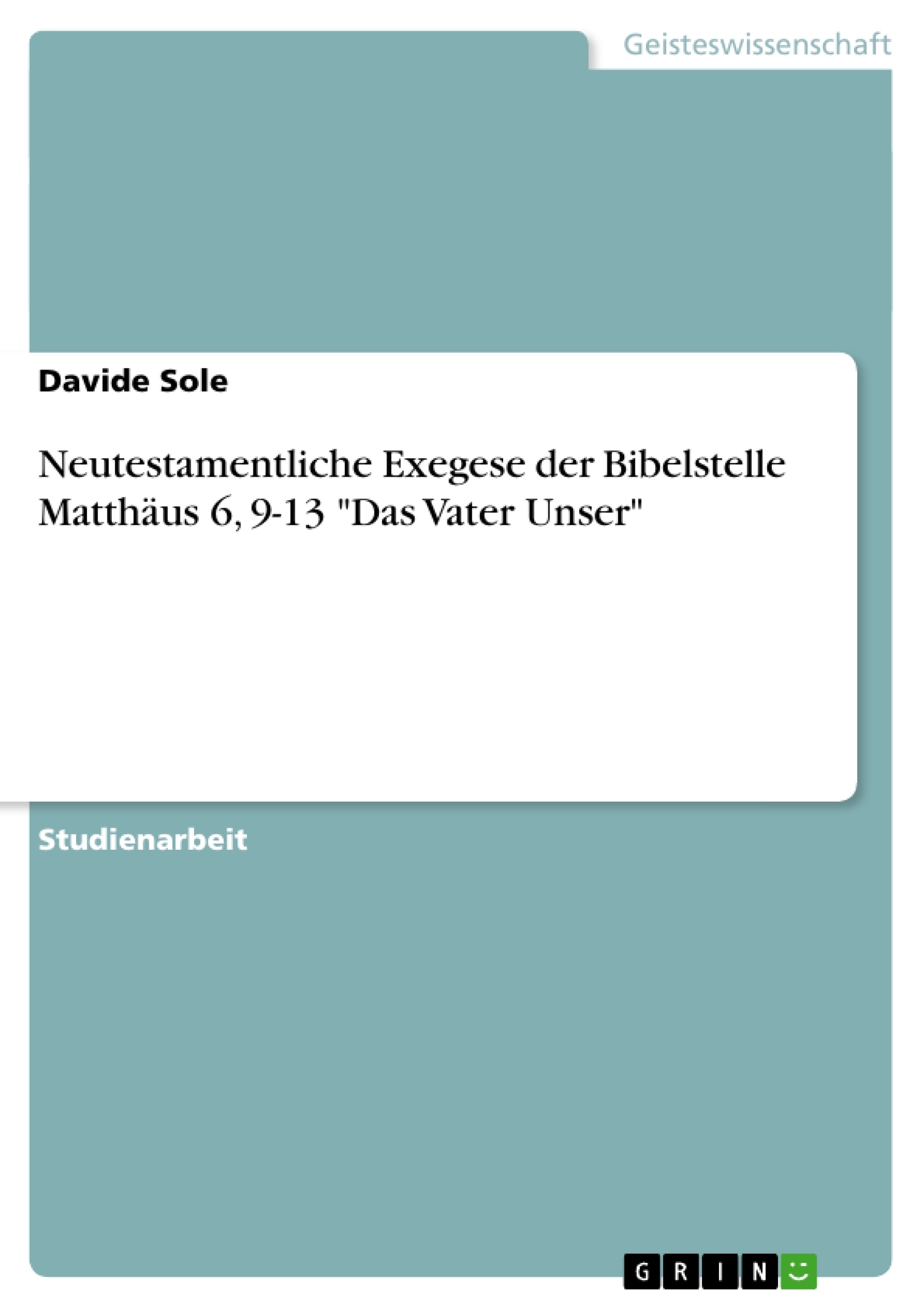In der folgenden Proseminararbeit soll die Bibelstelle Matthäus 6, 9-13 des Neuen Testamentes exegetisch aufbereitet werden. Dabei handelt es sich um das bekannteste Gebet, nämlich das VATER UNSER.
Bei den vorzunehmenden einzelnen Arbeitsschritten soll eine Auswahl der von STRECKER vorgegebenen Arbeitsanweisungen zum neutestamentlichen Proseminar 2007 an der Universität Mainz verwendet werden. Diese stützen sich im Wesentlichen auf die in ROLOFFS „Neues Testament“ beschriebenen Arbeitsschritte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Textkritik
- Textkritisches Problem ws.
- Textkritisches Problem уñç.
- Textkritisches Problem αφήκαμεν..
- Übersetzung
- Sprachanalyse
- Syntaktisch-stilistische Analyse (Verhältnis Zeichen - Zeichen).
- Wortebene
- Stilfiguren
- Satzebene.
- Semantische Analyse
- Pragmatische Analyse
- Literarkritik
- Äußere Abgrenzung des Textes.
- Kontextanalyse
- Quellenkritik
- Feststellung der Einheitlichkeit des Textes.
- Kurze Darstellung der Zwei-Quellen-Theorie
- Synoptischer Vergleich
- Logienquelle [Q 11, 2b-4 (Mt 6, 7-13 // Lk 11, 1-4)]
- Formkritik
- Gattungsbestimmung
- Sitz im Leben
- Traditionsgeschichte (Begriffs- und Motivgeschichte)
- >πάτερ<<
- >βασιλείας.
- Kompositions- und Redaktionskritik
- Aufriss und Komposition des Evangeliums.
- Einbettung und Funktion des Einzelstückes im Evangelium.
- Redaktionelle Arbeit am Einzelstück
- Gesamturteil über den Evangelisten und sein Werk.
- Versexegese
- Gesamtexegese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perikope Matthäus 6,9-13 (Das Vaterunser) mittels historisch-kritischer Exegese. Ziel ist die wissenschaftliche Erschließung des Textes unter Berücksichtigung seines historischen und sprachlichen Kontextes. Die Arbeit rekonstruiert die ursprünglichste Textgestalt und analysiert sprachliche, literarische und kompositorische Aspekte.
- Rekonstruktion der ursprünglichsten Textgestalt mittels Textkritik
- Sprachliche und literarische Analyse des Vaterunsers
- Untersuchung des Kontextes und der Quellen des Textes
- Analyse der Traditionsgeschichte und der Bedeutung wichtiger Begriffe
- Erforschung der Komposition und Redaktion des Textes im Matthäusevangelium
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Diese Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit, der die historisch-kritische Exegese verwendet, um den biblischen Text als menschliches Reden von Gott zu verstehen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der historisch-kritischen Exegese und ihre Prämissen, beginnend mit Spinoza und Turrentini bis zu Troeltsch, und diskutiert kritische Positionen gegenüber diesem Ansatz. Der Fokus liegt auf der wissenschaftlichen, objektiven Untersuchung des Vaterunsers im Matthäusevangelium.
Textkritik: Dieses Kapitel rekonstruiert die ursprünglichste Textgestalt des Vaterunsers durch die Analyse von drei ausgewählten Textstellen. Es konzentriert sich auf die Identifizierung und Bewertung von Varianten im Text und deren Auswirkungen auf die Bedeutung. Die Methode dient als Grundlage für die weitere exegetische Arbeit.
Sprachanalyse: Die Sprachanalyse untersucht den Text des Vaterunsers aus sprach- und literaturwissenschaftlicher Perspektive. Sie beleuchtet syntaktische Strukturen, stilistische Mittel, semantische Bedeutungen und die pragmatische Funktion des Textes im kommunikativen Kontext. Die Analyse zielt darauf ab, ein tiefes Verständnis des Textes auf der Ebene der Sprache zu erreichen.
Literarkritik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung des Textes, der Kontextanalyse und der Feststellung der Texteinheit. Es analysiert den Vaterunser-Text innerhalb des Matthäusevangeliums, untersucht seinen literarischen Kontext und die Beziehungen zu anderen Textpassagen, um seine Funktion und Bedeutung im Gesamtwerk zu klären. Die Einheitlichkeit des Textes wird kritisch geprüft.
Quellenkritik: Dieses Kapitel analysiert die Quellen des Vaterunsers im Matthäusevangelium im Vergleich zu Lukas und Markus unter Verwendung der Zwei-Quellen-Theorie. Es untersucht Übereinstimmungen und Unterschiede in den Überlieferungen, um die Entstehung und Entwicklung des Textes nachzuvollziehen und seine verschiedenen Fassungen zu vergleichen.
Formkritik: In diesem Kapitel wird die Gattung des Vaterunsers bestimmt und sein Sitz im Leben untersucht. Die Analyse fokussiert auf die literarische Form des Gebets und seinen ursprünglichen Kontext innerhalb der frühchristlichen Gemeinde. Ziel ist es, den ursprünglichen Zweck und die Funktion des Gebets zu rekonstruieren.
Traditionsgeschichte (Begriffs- und Motivgeschichte): Dieses Kapitel untersucht die Begriffs- und Motivgeschichte der zentralen Begriffe "πάτερ" (Vater) und "βασιλείας" (Königreich) im Vaterunser. Die Analyse verfolgt die Entwicklung dieser Begriffe im Kontext der jüdischen und frühchristlichen Tradition, um ihre Bedeutung im Vaterunser zu verstehen.
Kompositions- und Redaktionskritik: Dieses Kapitel analysiert die Komposition des Vaterunsers im Matthäusevangelium und die redaktionelle Arbeit des Evangelisten. Es untersucht die Einbettung des Gebets in den Kontext des Evangeliums und die Intentionen des Redaktors bei der Gestaltung des Textes. Die Analyse zielt auf ein Verständnis der theologischen und literarischen Intentionen des Evangelisten.
Schlüsselwörter
Historisch-kritische Exegese, Matthäusevangelium, Vaterunser, Textkritik, Sprachanalyse, Literarkritik, Quellenkritik, Formkritik, Traditionsgeschichte, Kompositionskritik, Redaktionskritik, Synoptische Evangelien, Zwei-Quellen-Theorie, Bibelauslegung, Semantik, Pragmatik.
Häufig gestellte Fragen zum Vaterunser im Matthäusevangelium
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Perikope Matthäus 6,9-13 (Das Vaterunser) mittels historisch-kritischer Exegese. Ziel ist die wissenschaftliche Erschließung des Textes unter Berücksichtigung seines historischen und sprachlichen Kontextes. Die Arbeit rekonstruiert die ursprünglichste Textgestalt und analysiert sprachliche, literarische und kompositorische Aspekte.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet die historisch-kritische Exegese. Dies beinhaltet Textkritik (Rekonstruktion der ursprünglichsten Textgestalt), Sprachanalyse (syntaktisch-stilistische Analyse, Wortebene, Satzebene, semantische und pragmatische Analyse), Literarkritik (äußere Abgrenzung, Kontextanalyse), Quellenkritik (Zwei-Quellen-Theorie, synoptischer Vergleich), Formkritik (Gattungsbestimmung, Sitz im Leben), Traditionsgeschichte (Begriffs- und Motivgeschichte), und Kompositions- und Redaktionskritik (Aufriss und Komposition, Einbettung und Funktion, redaktionelle Arbeit, Gesamturteil).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einführung, Textkritik, Übersetzung, Sprachanalyse, Literarkritik, Quellenkritik, Formkritik, Traditionsgeschichte, Kompositions- und Redaktionskritik, Versexegese und Gesamtexegese. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt der historisch-kritischen Exegese im Bezug auf das Vaterunser.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Rekonstruktion der ursprünglichsten Textgestalt, die sprachliche und literarische Analyse, die Untersuchung des Kontextes und der Quellen, die Analyse der Traditionsgeschichte und die Erforschung der Komposition und Redaktion im Matthäusevangelium. Die Arbeit beleuchtet auch die Bedeutung wichtiger Begriffe wie "πάτερ" (Vater) und "βασιλείας" (Königreich).
Wie wird die Textkritik durchgeführt?
Die Textkritik analysiert drei ausgewählte Textstellen, um Varianten zu identifizieren und deren Auswirkungen auf die Bedeutung zu bewerten. Dies dient als Grundlage für die weitere exegetische Arbeit.
Welche Aspekte werden in der Sprachanalyse untersucht?
Die Sprachanalyse untersucht syntaktische Strukturen, stilistische Mittel, semantische Bedeutungen und die pragmatische Funktion des Textes. Das Ziel ist ein tiefes Verständnis des Textes auf sprachlicher Ebene.
Wie wird die Quellenkritik angegangen?
Die Quellenkritik vergleicht das Vaterunser im Matthäusevangelium mit Lukas und Markus unter Verwendung der Zwei-Quellen-Theorie. Sie untersucht Übereinstimmungen und Unterschiede, um die Entstehung und Entwicklung des Textes nachzuvollziehen.
Was ist das Ziel der Formkritik?
Die Formkritik bestimmt die Gattung des Vaterunsers und untersucht seinen Sitz im Leben. Ziel ist die Rekonstruktion des ursprünglichen Zwecks und der Funktion des Gebets.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Historisch-kritische Exegese, Matthäusevangelium, Vaterunser, Textkritik, Sprachanalyse, Literarkritik, Quellenkritik, Formkritik, Traditionsgeschichte, Kompositionskritik, Redaktionskritik, Synoptische Evangelien, Zwei-Quellen-Theorie, Bibelauslegung, Semantik und Pragmatik.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den methodischen Ansatz, die Rekonstruktion der ursprünglichsten Textgestalt, die sprachliche und literarische Analyse, die Kontext- und Quellenanalyse, die Traditionsgeschichte, die Kompositions- und Redaktionskritik, sowie die Bestimmung der Gattung und des Sitzes im Leben des Vaterunsers.
- Quote paper
- Davide Sole (Author), 2007, Neutestamentliche Exegese der Bibelstelle Matthäus 6, 9-13 "Das Vater Unser", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111886