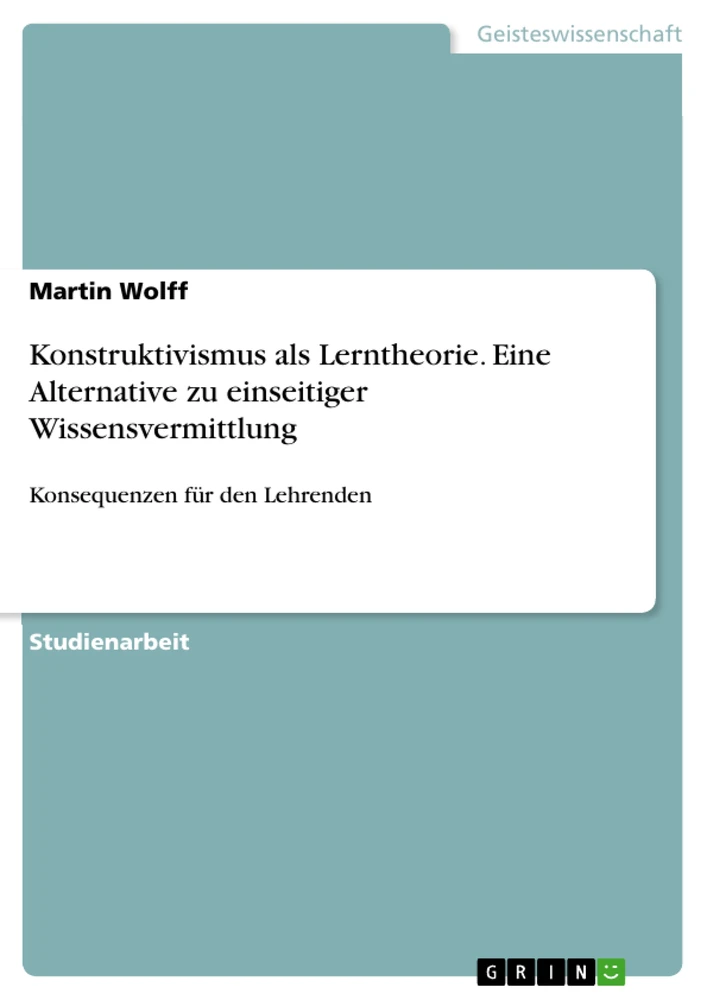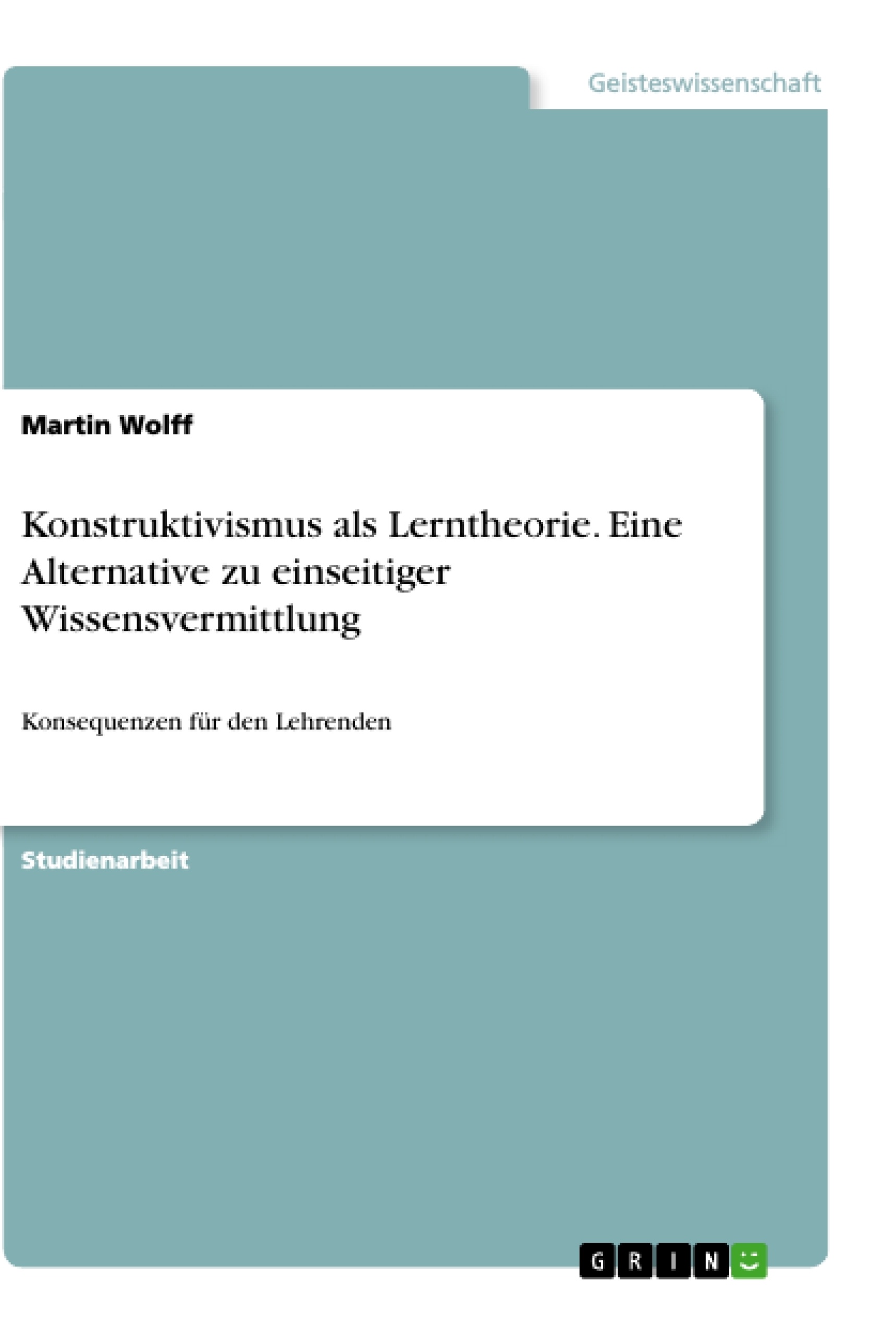Ziel der Arbeit ist es, einen Einblick in konstruktivistische Lerntheorien und eine Alternative zu einseitiger Wissensvermittlung zu geben. Hierfür wird auf die Komplexität des Lernbegriffs Bezug genommen und dieser thematisch skaliert. Es wird dargelegt, inwieweit didaktische Grundparadigmen revolutioniert und erkenntnistheoretisch neu interpretiert wurden. Bezugnehmend auf die Konzeptionen von Jean Piagets genetischer Epistemologie und dessen ausschlaggebenden Einfluss für eine erkenntnistheoretische Neubewertung werden die daraus resultierenden Konsequenzen für Lehr – Lern – Situationen beispielhaft erläutert und der Blickwinkel des Subjektbezuges verdeutlicht. Darüber hinaus wird eine Einbettung in den historischen und gesellschaftlichen Kontext vorgenommen und auf die Ausdifferenzierung verschiedener Interpretationen und Perspektiven innerhalb des Konstruktivismus eingegangen. In diesem Zusammenhang werden voranging die Ausdifferenzierungen durch Konzeptionen des radikalen Konstruktivismus nach Ernst von Glaserfeld sowie des sozial internationalistischem Konstruktivismus nach Kersten Reich vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Skalierung des Lernbegriffs
- 3. Konstruktivismus – von der Epistemologie zur Lerntheorie
- 4. Einfluss vorangegangener Lerntheorien
- 5. Grundsteinlegung Jean Piagets
- 6. Perspektivische Ausdifferenzierung innerhalb des Konstruktivismus
- 7. Konsequenzen für den Lehrenden
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, konstruktivistische Lerntheorien vorzustellen und eine Alternative zur einseitigen Wissensvermittlung aufzuzeigen. Sie untersucht die Komplexität des Lernbegriffs und beleuchtet dessen erkenntnistheoretische Neuinterpretationen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss von Jean Piagets genetischer Epistemologie und den daraus resultierenden Konsequenzen für Lehr-Lern-Situationen.
- Komplexität des Lernbegriffs und dessen Skalierung
- Konstruktivismus als Lerntheorie und seine epistemologischen Wurzeln
- Einfluss von Jean Piagets genetischer Epistemologie
- Ausdifferenzierung des Konstruktivismus (radikaler und sozial-konstruktivistischer Ansatz)
- Konsequenzen für die Praxis des Lehrens und Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Konstruktivismus als Lerntheorie ein und betont die Komplexität des Lernbegriffs im Gegensatz zu reduktionistischen Schulmodellen. Sie skizziert das Ziel der Arbeit: einen Einblick in konstruktivistische Lerntheorien zu geben und eine Alternative zur einseitigen Wissensvermittlung aufzuzeigen. Die Einleitung gibt einen Ausblick auf die weiteren Kapitel und ihre Schwerpunkte.
2. Skalierung des Lernbegriffs: Dieses Kapitel befasst sich mit der Vielschichtigkeit des Lernbegriffs. Es werden verschiedene Dimensionen des Lernens beleuchtet, von naturwissenschaftlichen und neurobiologischen Perspektiven bis hin zu pädagogisch-didaktischen Konzeptionen. Die zeitliche Determination des Lernens als permanenter Prozess und die Bedeutung von Erfahrung und Veränderung als Basisstrukturen werden diskutiert. Die individuelle, subjektbezogene Adaption von Lerninhalten und der Aspekt der Nachhaltigkeit im Lernprozess werden hervorgehoben. Das Kapitel zeigt die Herausforderungen auf, den Lernbegriff universell zu erfassen, und betont die Bedeutung der Variablen für Lerntheorien.
3. Konstruktivismus – von der Epistemologie zur Lerntheorie: Dieses Kapitel erläutert den Konstruktivismus als Lerntheorie, die auf subjektiven Erfahrungen und nachhaltigen Veränderungen basiert. Der Begriff der Perturbation wird eingeführt, um die Modifikation von Deutungsmustern durch widersprüchliche Interaktionen mit der Umwelt zu beschreiben. Die Rolle kognitiver Schemata und neuronaler Repräsentationen in der Wissensgenerierung und Wirklichkeitskonstruktion wird betont. Der Subjektbezug des Konstruktivismus wird hervorgehoben, sowie dessen Wurzeln in der Biologie und die daraus resultierende Ablehnung eines absoluten Wahrheitsanspruchs.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Lerntheorie, Jean Piaget, genetische Epistemologie, radikaler Konstruktivismus, sozial-konstruktivistischer Konstruktivismus, Lernbegriff, Wissenskonstruktion, Wirklichkeitskonstruktion, Subjektbezug, Perturbation, Viabilität.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Konstruktivistische Lerntheorien
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit konstruktivistischen Lerntheorien. Er untersucht die Komplexität des Lernbegriffs, beleuchtet dessen erkenntnistheoretische Neuinterpretationen und analysiert den Einfluss von Jean Piagets genetischer Epistemologie auf Lehr-Lern-Situationen. Ein zentrales Anliegen ist es, eine Alternative zur einseitigen Wissensvermittlung aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Skalierung des Lernbegriffs, Konstruktivismus – von der Epistemologie zur Lerntheorie, Einfluss vorangegangener Lerntheorien, Grundsteinlegung Jean Piagets, Perspektivische Ausdifferenzierung innerhalb des Konstruktivismus, Konsequenzen für den Lehrenden und Resümee.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, konstruktivistische Lerntheorien vorzustellen und die Komplexität des Lernbegriffs zu verdeutlichen. Er möchte eine Alternative zur einseitigen Wissensvermittlung aufzeigen und den Einfluss von Jean Piagets genetischer Epistemologie auf das Verständnis von Lernen und Lehren herausarbeiten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der Komplexität des Lernbegriffs und dessen Skalierung, dem Konstruktivismus als Lerntheorie und seinen epistemologischen Wurzeln, dem Einfluss von Jean Piagets genetischer Epistemologie, der Ausdifferenzierung des Konstruktivismus (radikaler und sozial-konstruktivistischer Ansatz) und den Konsequenzen für die Praxis des Lehrens und Lernens.
Was wird in Kapitel 2 ("Skalierung des Lernbegriffs") behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die Vielschichtigkeit des Lernbegriffs aus verschiedenen Perspektiven (naturwissenschaftlich, neurobiologisch, pädagogisch-didaktisch). Es diskutiert die zeitliche Determination des Lernens, die Bedeutung von Erfahrung und Veränderung, die individuelle Adaption von Lerninhalten und die Nachhaltigkeit des Lernprozesses. Die Herausforderungen bei der universellen Erfassung des Lernbegriffs und die Bedeutung von Variablen für Lerntheorien werden hervorgehoben.
Was ist der Fokus von Kapitel 3 ("Konstruktivismus – von der Epistemologie zur Lerntheorie")?
Kapitel 3 erläutert den Konstruktivismus als Lerntheorie, die auf subjektiven Erfahrungen und nachhaltigen Veränderungen basiert. Es führt den Begriff der Perturbation ein und betont die Rolle kognitiver Schemata und neuronaler Repräsentationen in der Wissensgenerierung und Wirklichkeitskonstruktion. Der Subjektbezug des Konstruktivismus, seine Wurzeln in der Biologie und die Ablehnung eines absoluten Wahrheitsanspruchs werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Konstruktivismus, Lerntheorie, Jean Piaget, genetische Epistemologie, radikaler Konstruktivismus, sozial-konstruktivistischer Konstruktivismus, Lernbegriff, Wissenskonstruktion, Wirklichkeitskonstruktion, Subjektbezug, Perturbation und Viabilität.
Welche Rolle spielt Jean Piaget im Text?
Jean Piagets genetische Epistemologie spielt eine zentrale Rolle. Der Text untersucht seinen Einfluss auf die konstruktivistische Lerntheorie und die daraus resultierenden Konsequenzen für Lehr-Lern-Situationen. Piagets Arbeiten bilden eine wichtige Grundlage für die im Text dargestellten Konzepte.
- Citar trabajo
- Martin Wolff (Autor), 2020, Konstruktivismus als Lerntheorie. Eine Alternative zu einseitiger Wissensvermittlung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1118763