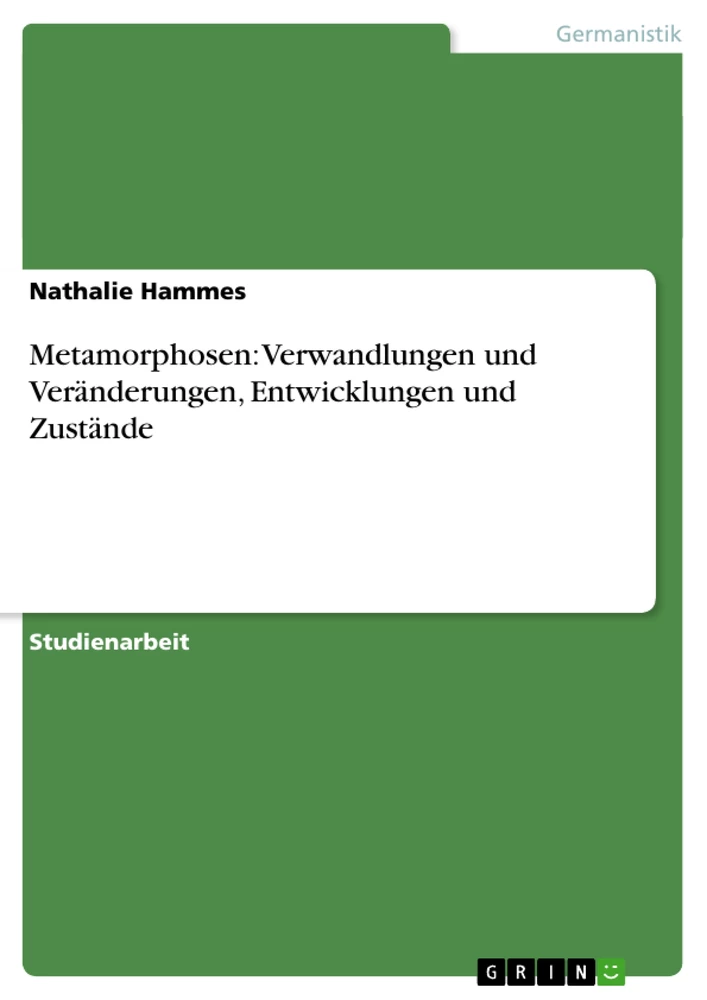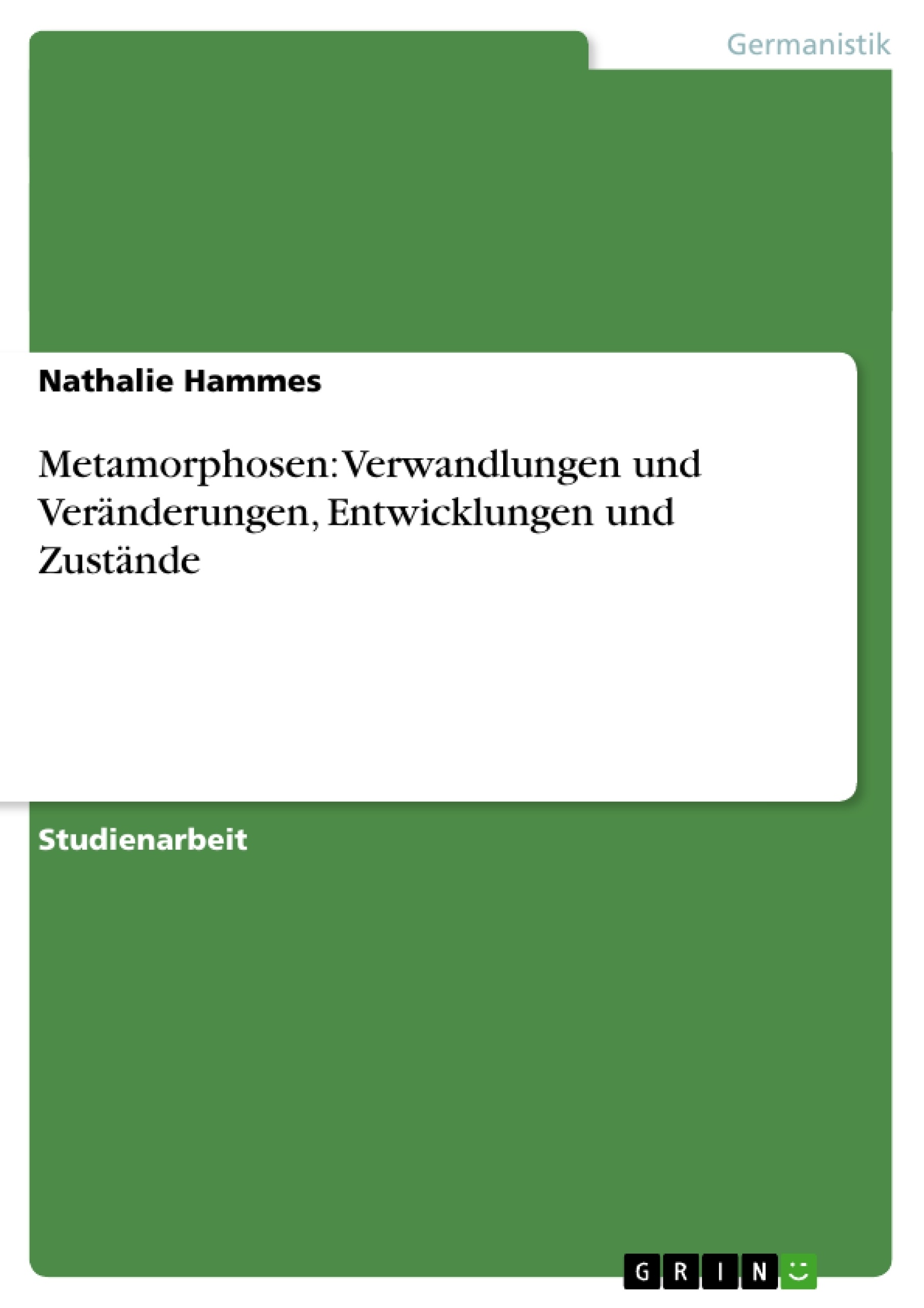Sich zu verwandeln und zu verändern ist für jeden Menschen interessant, auch wenn es nur Gedanken sind, sich einmal in einem anderen Körper, in einem anderen Leben wieder zu finden. In vielen Filmen und Büchern kann man heutzutage mitverfolgen, wie eine Person mit einer zweifachen Identität seine Umwelt beeinflusst oder sich in einen Held verwandelt. Diese modernen Geschichten haben die Verwandlungsthematik gemeinsam, die seit mehreren Jahrhunderten in vielen Werken und Epochen in Literatur, Malerei und Bildhauerei zu finden ist.
Schon in der Antike befassten sich Autoren mit diesem Motiv, aus denen der Dichter Ovidius Publius Naso sehr hervorsticht. Mit seinem Werk „Metamorphosen“ fasste er in seiner damaligen politisch-geschichtlichen Situation die griechisch-römischen Sagen zu einem Gedicht zusammen, das bis heute nichts an Interesse verloren hat. Das allumfassende Leitmotiv darin ist der Mythos Verwandlung. Viele Autoren nach ihm haben sich von seinem Werk inspirieren lassen und ihre eigene Schöpfung daraus kreiert. Das Verwandlungsmotiv entwickelte sich im historischen Prozess weiter und wurde den jeweiligen Epochen angepasst. Künstler und Autoren hatten persönliche Erfahrungen in ihre Bearbeitungen mit einfließen lassen, so dass der Metamorphosenbegriff sich stetig weiterentwickelte. Von Ovid über Nikolaj Gogol und Michail Bulgakow zu Christian Ransmayr und Mario Vargas Llosa: der Mythos der Metamorphose blieb in seiner Aussage polysemantisch und wurde durch die Art und Weise, wie er seine Botschaft aussprach, definiert: er selbst unterlag bzw. unterliegt auch heute noch einer Metamorphose. Wie entwickelte sich der Begriff „Metamorphose“ bis heute bzw. wie wurde der Mythos zu verschiedenen Zeiten umgesetzt bzw. eingesetzt? Die Aktualität des Begriffes „Metamorphose“ und seine moderne Umsetzung werden im Folgenden an verschiedenen Texten untersucht.
Ovids „Metamorphosen“ sind Ausgangspunkt dieser Arbeit. Autor, Inhalt und Verwandlungsthematik werden kurz vorgestellt. In dieser Arbeit werden Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert in Annäherung an den antiken Mythos der Verwandlung untersucht und wie ihre zeitgenössische Verwandlungsthematik mit Ovids „Metamorphosen“ zu vergleichen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ovidius Publius Naso
- 1.1. Sein Leben, seine Zeit
- 1.2. Ovids Schaffen
- 2. Metamorphose
- 2.1. Worterklärung nach Brockhaus
- 2.2. „Metamorphosen“, geschrieben von Ovidius Publius Naso
- 2.2.1. Struktur
- 2.2.2. Inhalt
- 3. Verwandlungen
- 3.1. Verwandlungsarten
- 3.2. Das Verwandlungsmotiv
- 4. Rezeptionen von Metamorphosen
- 4.1. „Alice im Wunderland“, von Lewis Carroll
- 4.1.1. Der Autor und sein Sprachspiel
- 4.1.2. Inhalt
- 4.1.3. Struktur und Gattung
- 4.1.4. Verwandlungen
- 4.2. „Die Verwandlung“, von Franz Kafka
- 4.2.1. Der Autor
- 4.2.2. Briefe an Felice Bauer
- 4.2.3. Die Erzählung
- 4.2.4. Die Verwandlungsthematik
- 4.3. „La métamorphose de Narcisse“, von Salvador Dalí als Beispiel aus dem 20. Jahrhundert aus dem Bereich der Malerei
- 4.3.1. Die Surrealisten
- 4.3.2. Der Maler Salvador Dalí und die paranoisch-kritische Methode
- 4.3.3. Das Gemälde
- 4.3.4. Das Gedicht
- 4.1. „Alice im Wunderland“, von Lewis Carroll
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Umsetzung des Metamorphosen-Motivs in Literatur und Kunst von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Sie analysiert, wie der Begriff "Metamorphose" sich im Laufe der Zeit gewandelt hat und wie verschiedene Künstler und Autoren dieses Motiv in ihren Werken verarbeitet haben.
- Die Entwicklung des Metamorphosen-Motivs von der Antike bis zur Moderne
- Der Einfluss von Ovids "Metamorphosen" auf spätere Werke
- Vergleichende Analyse der Verwandlungsthematik in ausgewählten Werken
- Die unterschiedlichen Ausdrucksformen des Metamorphosen-Motivs in Literatur und Kunst
- Die Aktualität des Metamorphosen-Motivs in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Metamorphose ein und skizziert die Bedeutung des Motivs in Literatur und Kunst verschiedener Epochen. Sie hebt Ovids "Metamorphosen" als zentralen Ausgangspunkt der Arbeit hervor und kündigt die Untersuchung der Rezeption dieses Werkes in späteren Werken an. Die Einleitung verdeutlicht das Interesse an Verwandlung und Veränderung als menschliches Grundbedürfnis, das sich in vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen manifestiert.
1. Ovidius Publius Naso: Dieses Kapitel bietet eine kurze Biographie Ovids, beleuchtet seine Zeit und seinen Werdegang als Dichter. Es wird sein Werk "Metamorphosen" als einflussreiches Beispiel antiker Literatur vorgestellt. Der Fokus liegt auf Ovids Leben, seiner Position in der römischen Gesellschaft, und dem Kontext, der seine literarische Arbeit beeinflusste. Die Verbannung Ovids und die ungeklärten Umstände werden erwähnt, wobei die Auswirkungen auf sein Schaffen angedeutet werden.
2. Metamorphose: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Metamorphose" anhand einer Worterklärung und analysiert die Struktur und den Inhalt von Ovids "Metamorphosen". Es wird die zentrale Rolle des Mythos und die vielschichtigen Bedeutungen des Motivs innerhalb von Ovids Werk beleuchtet. Die Kapitelstruktur der "Metamorphosen" selbst wird analysiert und ein Überblick über die erzählten Mythen gegeben, ohne jedoch in detaillierte Inhaltsangaben einzelner Geschichten einzugehen.
3. Verwandlungen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Arten von Verwandlungen und das übergreifende Motiv der Verwandlung in der Literatur. Die verschiedenen Arten der Verwandlung werden kategorisiert und es wird auf die verschiedenen Funktionen und Bedeutungen des Motivs eingegangen. Es wird der Grundstein für die spätere Analyse von Verwandlungs-Darstellungen in anderen Werken gelegt.
4. Rezeptionen von Metamorphosen: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption des Metamorphosen-Motivs in Werken des 19. und 20. Jahrhunderts, mit einem Fokus auf Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ und Franz Kafkas „Die Verwandlung“, sowie Salvador Dalís „La métamorphose de Narcisse“. Die Analyse konzentriert sich auf die jeweiligen Interpretationen und Aktualisierungen des antiken Mythos und zeigt auf, wie die Thematik in verschiedenen künstlerischen Medien aufgegriffen und neu interpretiert wurde. Der Vergleich der unterschiedlichen Werke soll die Wandlungsfähigkeit des Motivs und seine anhaltende Relevanz aufzeigen.
Schlüsselwörter
Metamorphose, Verwandlung, Ovid, Metamorphosen, Rezeption, Literatur, Kunst, Mythos, Alice im Wunderland, Die Verwandlung, Salvador Dalí, Antike, Moderne, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Metamorphosen-Motivs in Literatur und Kunst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung und Umsetzung des Metamorphosen-Motivs in Literatur und Kunst von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Sie untersucht, wie sich der Begriff "Metamorphose" im Laufe der Zeit gewandelt hat und wie verschiedene Künstler und Autoren dieses Motiv in ihren Werken verarbeitet haben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Metamorphosen-Motivs von der Antike bis zur Moderne, den Einfluss von Ovids "Metamorphosen", eine vergleichende Analyse der Verwandlungsthematik in ausgewählten Werken, die unterschiedlichen Ausdrucksformen des Motivs in Literatur und Kunst und die Aktualität des Motivs in der Gegenwart.
Welche Werke werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert Ovids "Metamorphosen", Lewis Carrolls "Alice im Wunderland", Franz Kafkas "Die Verwandlung" und Salvador Dalís "La métamorphose de Narcisse". Der Fokus liegt auf der jeweiligen Interpretation und Aktualisierung des antiken Mythos in diesen Werken.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Ovidius Publius Naso (Biographie und Werk), Metamorphose (Definition und Analyse von Ovids Werk), Verwandlungen (verschiedene Arten und das Motiv der Verwandlung) und Rezeptionen von Metamorphosen (Analyse der ausgewählten Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung und die vielschichtigen Ausdrucksformen des Metamorphosen-Motivs aufzuzeigen und seine anhaltende Relevanz in Literatur und Kunst über verschiedene Epochen hinweg zu belegen. Der Vergleich verschiedener Werke soll die Wandlungsfähigkeit des Motivs verdeutlichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Metamorphose, Verwandlung, Ovid, Metamorphosen, Rezeption, Literatur, Kunst, Mythos, Alice im Wunderland, Die Verwandlung, Salvador Dalí, Antike, Moderne, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Welche Arten von Verwandlungen werden betrachtet?
Die Arbeit kategorisiert verschiedene Arten von Verwandlungen, die in den analysierten Werken vorkommen, und untersucht deren jeweilige Funktion und Bedeutung im Kontext des Gesamtwerks.
Wie wird der Einfluss von Ovids "Metamorphosen" dargestellt?
Die Arbeit zeigt auf, wie Ovids "Metamorphosen" als einflussreiches Werk der Antike die spätere Literatur und Kunst geprägt hat und wie das Metamorphosen-Motiv in verschiedenen Epochen und Medien aufgegriffen und neu interpretiert wurde.
Welche Epochen werden abgedeckt?
Die Arbeit umfasst die Antike (mit Ovid) und die Moderne (mit Werken des 19. und 20. Jahrhunderts), um die Entwicklung und die anhaltende Relevanz des Metamorphosen-Motivs zu veranschaulichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und vergleichenden Literaturwissenschaft, die sich mit dem Thema Metamorphose und dessen literarischer und künstlerischer Umsetzung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Nathalie Hammes (Author), 2008, Metamorphosen: Verwandlungen und Veränderungen, Entwicklungen und Zustände, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111826