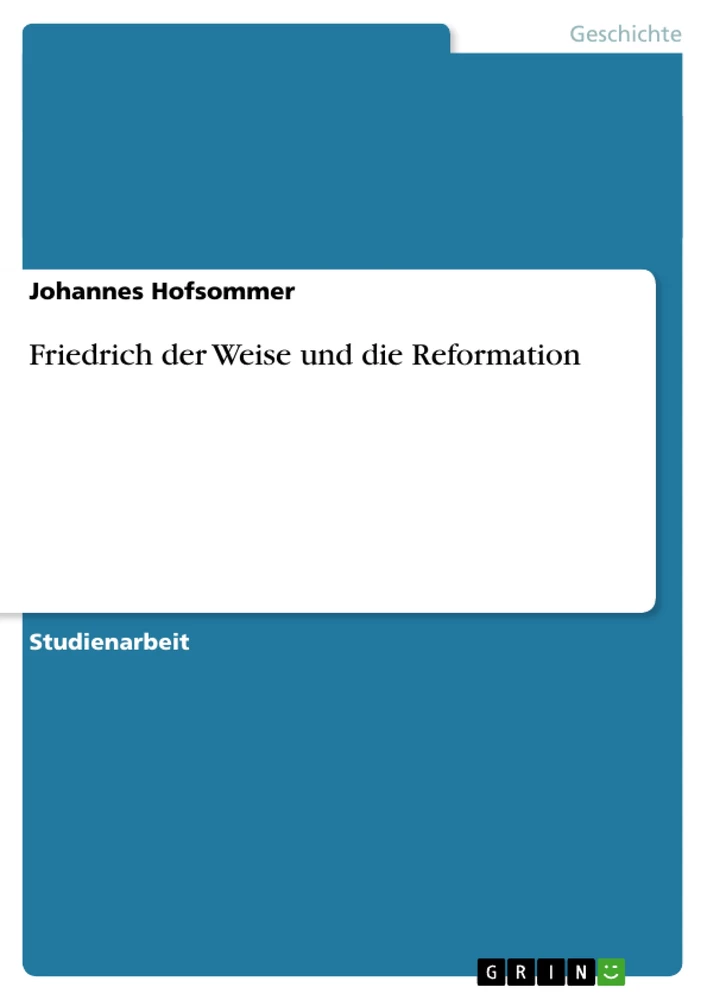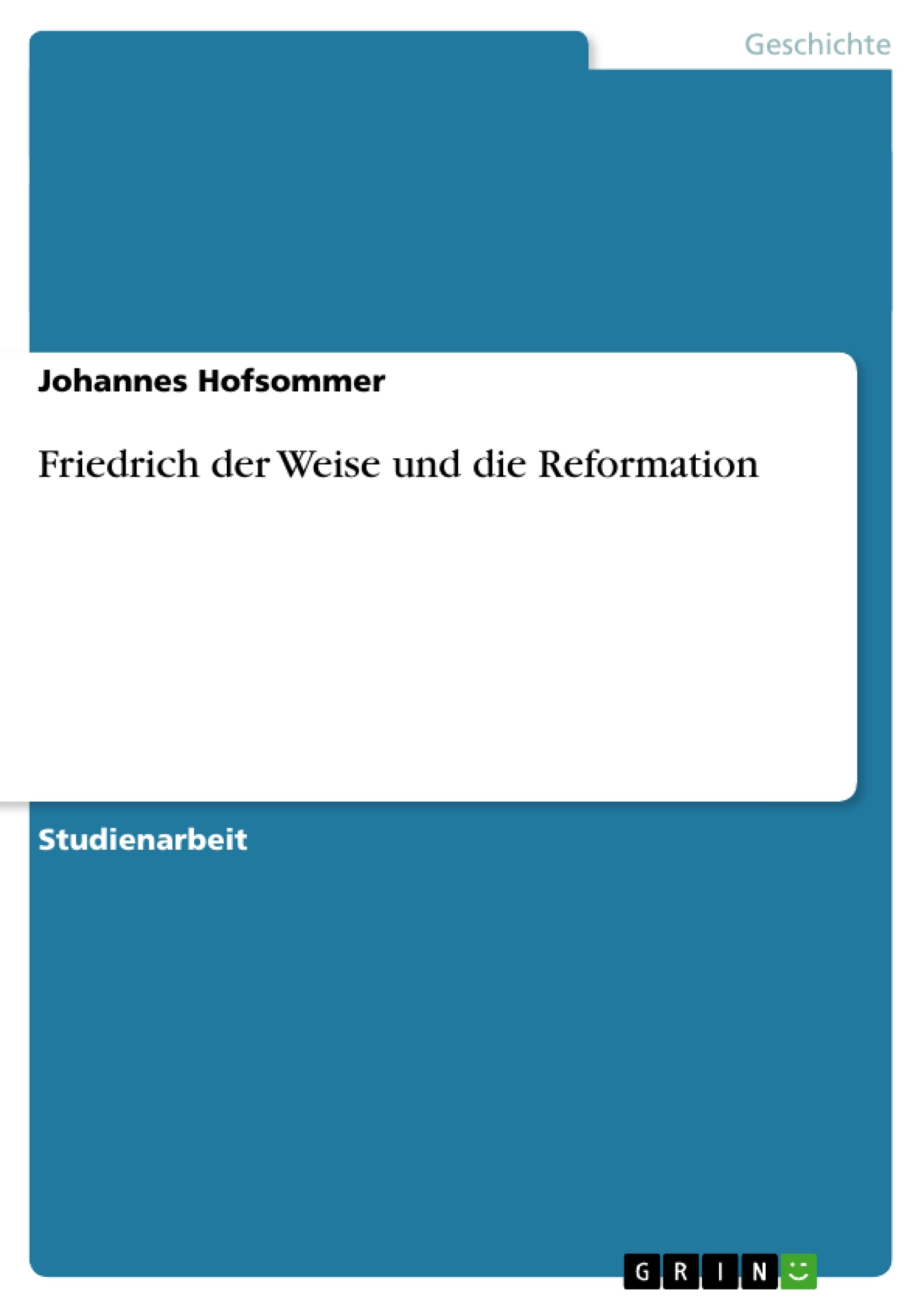In der vorliegenden Arbeit „ Friedrich der Weise und die Reformation“
soll anhand des Werdegangs des Kurfürsten von Sachsen die Frage
erläutert werden, inwiefern der sächsische Landesherr
mitverantwortlich für die Ausbreitung der Reformation war.
Dazu wird im ersten Kapitel der politische Aufstieg Friedrichs
dargestellt, der aufzeigen soll, wie stark der Wettiner in die
Administration des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
eingebunden war. Das darauffolgende Kapitel „Friedrich der Weise
und Doktor Martin Luther“ soll die Verbindung des Landesherrn zu
seinem Untertanen in den Vordergrund stellen, um daran die
„Reformatorischen Beweggründe Friedrich des Weisen“ ableiten zu
können.
Dadurch soll dem Leser ein Einblick in die dynastischen, geistlichen
und weltlichen Konfliktsituationen gegeben werden, die verdeutlichen
sollen, in welch einer Lage sich der Kurfürst von Sachen befand, als er
es seinem Untertanen und Professor Luther ermöglichte, dessen
Thesen zu vertreten und sie zeitgleich zu verteidigen, was eine
Zeitenwende einläuten sollte und die katholische Kirche spaltete.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Person des
sächsischen Kurfürsten Friedrich der Weise und soll die Eigenschaften
dessen herausstellen um der Frage nachzugehen, ob die Reformation
nicht allein durch geistliche Überzeugungen die Zeit zur Entfaltung
gestattet bekam, die sie benötigte.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der politische Aufstieg Friedrich des Weisen von Sachsen
3. Friedrich der Weise und Dr. Martin Luther
4. Die reformatorischen Beweggründe Friedrich des Weisen
5. Zusammenfassung
6. Quellen- und Literaturverzeichnis
1.Einleitung
In der vorliegenden Arbeit „ Friedrich der Weise und die Reformation“ soll anhand des Werdegangs des Kurfürsten von Sachsen die Frage erläutert werden, inwiefern der sächsische Landesherr mitverantwortlich für die Ausbreitung der Reformation war.
Dazu wird im ersten Kapitel der politische Aufstieg Friedrichs dargestellt, der aufzeigen soll, wie stark der Wettiner in die Administration des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation eingebunden war. Das darauffolgende Kapitel „Friedrich der Weise und Doktor Martin Luther“ soll die Verbindung des Landesherrn zu seinem Untertanen in den Vordergrund stellen, um daran die „Reformatorischen Beweggründe Friedrich des Weisen“ ableiten zu können.
Dadurch soll dem Leser ein Einblick in die dynastischen, geistlichen und weltlichen Konfliktsituationen gegeben werden, die verdeutlichen sollen, in welch einer Lage sich der Kurfürst von Sachen befand, als er es seinem Untertanen und Professor Luther ermöglichte, dessen Thesen zu vertreten und sie zeitgleich zu verteidigen, was eine Zeitenwende einläuten sollte und die katholische Kirche spaltete.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Person des sächsischen Kurfürsten Friedrich der Weise und soll die Eigenschaften dessen herausstellen um der Frage nachzugehen, ob die Reformation nicht allein durch geistliche Überzeugungen die Zeit zur Entfaltung gestattet bekam, die sie benötigte.
2. Der politische Aufstieg Friedrich des Weisen von Sachsen
Am 17. Januar 1463 wurde Friedrich III. von Sachsen als erster Sohn des Herzogs Ernst aus der Familie der Wettiner und seiner Frau Elisabeth, der Tochter des Herzogs Albrecht III. von Bayern, geboren.[1] Da sein Großvater Friedrich der Sanftmütige, der mit der Schwester des Kaisers Friedrich III. verheiratet war, ein Jahr nach der Geburt seines Enkels verstarb, erlangte sein Vater Ernst die Kurfürstenwürde,[2] welche die Wettiner im Jahr 1423 erlangt hatten.[3]
Ernst hatte neben Friedrich noch fünf weitere Kinder, von denen drei Söhne und zwei Töchter waren. Der Kurfürst hatte vorgesehen, dass die beiden Söhne Friedrich und Johann seine Nachfolge antreten sollten, wohingegen ihre Brüder Albrecht und Ernst der Kirche dienten.[4] Somit legte der Kurfürst großen Wert auf die Erziehung seiner zwei Söhne Friedrich und Johann.[5] Sie lernten beide bei Ulrich Kämmerlin von Aschaffenburg die lateinische Sprache, Geschichte und Naturkunde.[6] Darüber hinaus wurden sie in der Fertigkeit der Jagd und der Kunst des ritterlichen Turniers unterwiesen.[7] Diese geistigen, als auch körperlichen Tätigkeiten sollten die beide jungen Herzöge darauf vorbereiten, das weit zerstreute Herrschaftsgebiet nach dem Tod des Vaters zu verwalten. Dazu gehörte auch das Erlernen der französischen Sprache, in der sie an dem Hof des Mainzer Kurfürsten Diether von Isenburg unterrichtet wurden.[8] Dieser Aufenthalt sollte die letzte Stufe der herzoglichen Ausbildung darstellen, die die beiden wettinischen Brüder auf ihre späteren Aufgaben vorbereiten sollte.
Warum beide dies taten, zeigt die Geschichte des Hauses Wettin. Da die Thronfolge nicht durch ein Erstgeborenenrecht geregelt war, stritt schon der Großvater von Friedrich und Johann, Friedrich II. der Sanftmütige mit seinem Bruder Wilhelm III. um die Herrschaft in Sachsen im so genannten Sächsischen Bruderkrieg von 1446 bis 1451.[9]
Das Ergebnis dieser verheerenden Auseinandersetzungen war eine Gebietsteilung, die ergab, dass Friedrich II. Meißen erhielt und Wilhelm III. die Thüringischen Gebiete.
Nach dem Tod der beiden jedoch vereinten sich die Territorien wieder unter der Führung von Friedrichs Vater Ernst und dessen Bruder Albert.
Diese legten jedoch am 26. August 1485 fest, dass das Land wiederum geteilt werden sollte,[10] wobei Kurfürst Ernst die Herrschaft über die Gebiete von Thüringen, Meißen und dem Vogtland zugestanden bekam.[11]
Als im Jahr 1486 Kurfürst Ernst von Sachsen an den Folgen eines Jagdunfalls starb,[12] war für Friedrich und Johann die Zeit angebrochen, das Land zu regieren, über welches ihr Vater nach der Teilung geherrscht hatte.[13] Friedrich übernahm die Würde des Kurfürsten, die nach den Bestimmungen der Reichsverfassung beim älteren lag.[14] Trotz der Verkleinerung des Reiches, bedingt durch die Teilung von 1485, nahm das Land, über das Friedrich nun herrschte, eine tragende Funktion im Deutschen Reich ein. Allein das Gebiet, das ihm unterstand, wies darauf hin, da es sich von Schlesien und der Mark Brandenburg im Nordosten bis hin nach Franken und Hessen im Westen ausdehnte.[15]
Doch nicht nur die Größe seines Reiches, sondern auch der wirtschaftliche Aufschwung des Landes, der seit dem aufblühenden Handel von Stoffen und Tüchern in der Mitte des 15. Jahrhunderts eingesetzt hatte, war für den Wohlstand Sachsens ausschlaggebend. Darüber hinaus entwickelte sich im Herrschaftsgebiet Friedrichs der Acker- und Bergbau, wobei letzterer gegen Ende des Jahrhunderts für einen ungeahnten Reichtum sorgte.[16] Bei Erzfunden in Schnee- und Schreckenberg wurden Städte gegründet, die die ehemals „Wilde Ecke“ des Erzgebirges zu einem bevölkerungsreichen Territorium werden ließen.
Diese wirtschaftliche Blüte und die territoriale Größe stellten das Fundament einer gefestigten Stellung des erst 23- jährigen Friedrichs dar, welcher diese so besonnen nutzte, dass er im Laufe der Zeit den Beinamen „der Weise“ bekam. Ausschlaggebend dafür war, dass der junge Kurfürst nicht nur die politischen Geschicke seines Landes zu lenken wusste, sondern auch die Tatsache, dass er es verstand, sich um die Finanzen und das Wohlergehen seiner Untertanen zu sorgen.
Auch seine Präsenz im Sachsenland zeigte die Verbindung des Kurfürsten mit seinem Herrschaftsgebiet. Entgegen den Gewohnheiten dieser Zeit verließ Friedrich das Land nur, wenn seine Kurfürstenwürde dies verlangte. Die einzige Reise, die aus eigenem Interesse den sächsischen Landesherren dazu veranlasste sein Territorium zu verlassen, war die Reise nach Palästina. Dazu brach er am 19. März 1493 auf, um in Jerusalem das „Heilige Grab“ zu besuchen.[17] Doch nicht nur die Wallfahrt war Anlass dieser Reise. Das Augenmerk des tief im katholischen Glauben verwurzelten Kurfürsten lag auch auf der Reliquiensammlung. Neben dem täglichen Messebesuch,[18] der Marien- und Heiligenverehrung legte gerade das Zusammentragen von Heiligenreliquien Zeugnis von dem frommen Leben Friedrichs ab.[19] Die Reliquien aus Jerusalem sollten den Grundbestand seiner Sammlung bilden, die sich zu einer der größten der damaligen Zeit entwickeln sollte.[20]
Neben diesem Heiligenkult widmete sich der Kurfürst von Sachsen aber auch den Angelegenheiten des Deutschen Reiches. War er doch einer jener sieben Fürsten, denen es oblag den König zu wählen. Die erste Reise bedingt durch diese hohe Würde, unternahm Friedrich in Begleitung seines Bruders Johann kurz nach dem Tod ihres Vaters Ernst im Jahr 1486.[21] Ihr Weg führte sie nach Frankfurt, wo auf dem dort von Kaiser Friedrich III. einberufenen Reichstag die Kurfürsten mit dem Kaiser in Verhandlungen treten wollten, um über ein Reichsgericht, ein Reichsheer, eine Reichssteuer und einen Reichslandfrieden zu beraten. Friedrich III. von Sachsen war in seiner Position als Erzmarschall des Deutschen Reiches vertreten,[22] als am 17. März jenes Jahres der Frankfurter Reichslandfriede beschlossen wurde.[23] Dieser sollte zehn Jahre andauern und für das Römische Reich Deutscher Nation verbindlich sein.[24] Dieser Name wurde in Frankfurt erstmals in einem Gesetz festgehalten und zeugte zeitgleich von den übernationalen Interessen der Deutschen Kaiser.[25]
Die politischen Interessen Friedrichs auf der Ebene des Reiches waren zu Anfang verhalten, war doch der Kurfürst von Sachsen noch ein Neuling auf diesem politischen Parkett. Mit zunehmender Präsenz auf den Reichstagen[26] aber gewann Friedrich immer mehr an Einfluss.[27]
Spätestens nach dem Tod des Kaisers Friedrich III. am 25. Mai 1493[28] erlangte der sächsische Kurfürst eine Stellung innerhalb des Reiches, die eine gewisse Autorität beinhaltete. Dies wurde durch den neuen römischen König[29] Maximilian I. möglich, da dieser Friedrich vertraglich am 14. Juli 1494 in seine Dienste nahm.[30] Aufgrund dessen zog Friedrich nach Maastricht, wo der König zu dieser Zeit weilte.[31]
Nun wurde der Kurfürst von Sachsen neben seinem Amt als Reichserzmarschall zusätzlich ein besoldeter Rat Maximilian I.. In dieser Position begleitete Friedrich den König 1495 zum Reichstag nach Worms, den Maximilian erstmals leitete.[32] Hier wurde der gewachsene Einfluss des Kurfürsten von Sachsen hinsichtlich der Reichspolitik deutlich. Das Reichskammergericht, das ein einheitliches Rechtssystem im Deutschen Reich darstellen sollte, widersprach den Vorstellungen Friedrichs als auch denen des Markgrafen von Brandenburg, da sie darin einen Eingriff in ihre kurfürstlichen Rechte sahen.[33] Durch die erlangte Autorität konnte Friedrich den Reichsfürsten ein gesondertes Recht zusichern, welches vorsah, dass die Kurfürsten im Fall einer Anklage nur ihren Räten Rede und Antwort stehen mussten. Darüber hinaus sollte nur ein Aufruf an das Reichskammergericht den Anklägern der Kurfürsten möglich sein.
[...]
[1] Vgl. Spalatin S. 21.
[2] Vgl. Stephan S. 27.
[3] Vgl. Ludolphy S. 280.
[4] Vgl. Nasemann S. 1.
[5] Vgl. Schirmer, Die ernestinischen Kurfürsten, S. 65.
[6] Vgl. Spalatin S. 22.
[7] Vgl. Spalatin S. 22.
[8] Vgl. Nasemann S. 4.
[9] Vgl. Wartenberg S. 21.
[10] Vgl. Ludolphy S. 67.
[11] Vgl. Wartenberg S. 21.
[12] Vgl. Stephan S. 42.
[13] Vgl. Spalatin S. 23.
[14] Vgl. Fritz, Die Goldene Bulle, S. 58.
[15] Vgl. Ludolphy S. 65.
[16] Vgl. Schirmer S. 162f.
[17] Vgl. Spalatin S. 26.
[18] Vgl. Spalatin S. 28.
[19] Vgl. Spalatin S. 28.
[20] Vgl. Bornkamm S. 34.
[21] Vgl. Ludolphy S. 140.
[22] Neben der Kurwürde war zugleich das Amt des Reichserzmarschalls für den Herzog von Sachsen verbindlich. Es verpflichtete den Kurfürsten das Reichsschwert bei Krönungszeremonien, als auch an Reichstagen zu tragen.
[23] Vgl. Tutzschmann S. 100.
[24] Vgl. Ziehen S. 24.
[25] Vgl. Ludolphy S. 137.
[26] Spalatin schreibt, dass Friedrich nicht unter 30 Reichstage besucht habe, was für eine finanzielle Stärke des Kurfürsten von Sachsen spricht, da der Wormser Reichstag von 1521 allein 14.000 fl. verschlungen haben soll.
[27] Vgl. Ludolphy S. 141.
[28] Vgl. Schmidt- von Rhein S. 14.
[29] Seit der Königswahl Maximilians auf dem Reichtag zu Frankfurt 1486, wurde der deutsche König
von diesem Zeitpunkt auch römischer König genannt. Vgl. Köpf S. 30.
[30] Vgl. Böhmer S. 110.
[31] Vgl. Böhmer S. 95.
[32] Vgl. Spalatin S. 128.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Arbeit "Friedrich der Weise und die Reformation"?
Die Arbeit untersucht die Rolle des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen bei der Ausbreitung der Reformation. Es wird analysiert, inwiefern er durch seine Handlungen und Entscheidungen die Reformation beeinflusst und gefördert hat.
Wie wird Friedrichs politischer Aufstieg dargestellt?
Das zweite Kapitel beschreibt Friedrichs politischen Werdegang, seine Einbindung in die Administration des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und seinen Einfluss innerhalb des Reiches.
Welche Verbindung hatte Friedrich der Weise zu Dr. Martin Luther?
Ein Kapitel widmet sich der Beziehung zwischen Friedrich dem Weisen und Martin Luther. Es untersucht, wie der Landesherr seinen Untertanen unterstützte und schützte, um dessen Thesen zu verbreiten und zu verteidigen.
Welche Beweggründe hatte Friedrich der Weise, die Reformation zu unterstützen?
Die Arbeit untersucht die dynastischen, geistlichen und weltlichen Konfliktsituationen, die Friedrichs Entscheidung beeinflussten, Luther zu unterstützen. Es geht um die Frage, ob Friedrichs Unterstützung hauptsächlich auf geistlichen Überzeugungen beruhte oder auch politische und persönliche Interessen eine Rolle spielten.
Welche Rolle spielten die wirtschaftlichen Verhältnisse Sachsens unter Friedrich dem Weisen?
Die Arbeit geht auf den wirtschaftlichen Aufschwung Sachsens unter Friedrich dem Weisen ein, der durch Handel, Ackerbau und vor allem Bergbau geprägt war. Es wird untersucht, wie dieser wirtschaftliche Aufschwung Friedrichs politische Position stärkte.
Welchen Stellenwert hatte die Religion für Friedrich den Weisen?
Die Arbeit beschreibt Friedrichs tiefe Verwurzelung im katholischen Glauben, seine Wallfahrt nach Jerusalem und seine Sammelleidenschaft für Reliquien. Diese Aspekte werden im Zusammenhang mit seiner späteren Unterstützung der Reformation betrachtet.
Wie beeinflusste Friedrich der Weise die Reichspolitik?
Friedrichs Position als Kurfürst und Reichserzmarschall ermöglichte es ihm, Einfluss auf die Reichspolitik zu nehmen. Er begleitete König Maximilian I. zu Reichstagen und setzte sich für die Rechte der Kurfürsten ein.
Was war der Frankfurter Reichslandfriede von 1486?
Der Frankfurter Reichslandfriede von 1486, an dessen Beschluss Friedrich beteiligt war, sollte zehn Jahre lang für das Römische Reich Deutscher Nation verbindlich sein und Frieden sichern.
Wer waren Friedrichs Eltern und Geschwister?
Friedrich III. von Sachsen war der Sohn von Herzog Ernst aus der Familie der Wettiner und seiner Frau Elisabeth, der Tochter des Herzogs Albrecht III. von Bayern. Er hatte mehrere Brüder und Schwestern.
Wie wurde Friedrich auf seine Rolle als Kurfürst vorbereitet?
Friedrich erhielt eine umfassende Ausbildung in lateinischer Sprache, Geschichte, Naturkunde, Jagd und ritterlichen Turnieren. Er lernte auch Französisch und wurde am Hof des Mainzer Kurfürsten Diether von Isenburg unterrichtet.
- Arbeit zitieren
- Johannes Hofsommer (Autor:in), 2008, Friedrich der Weise und die Reformation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111742