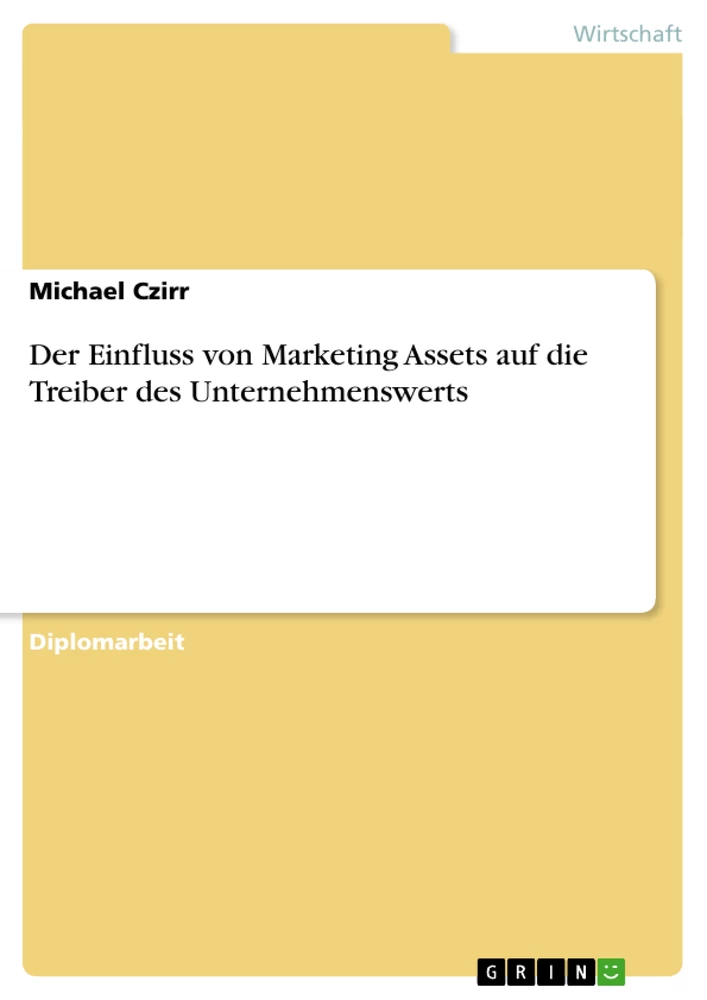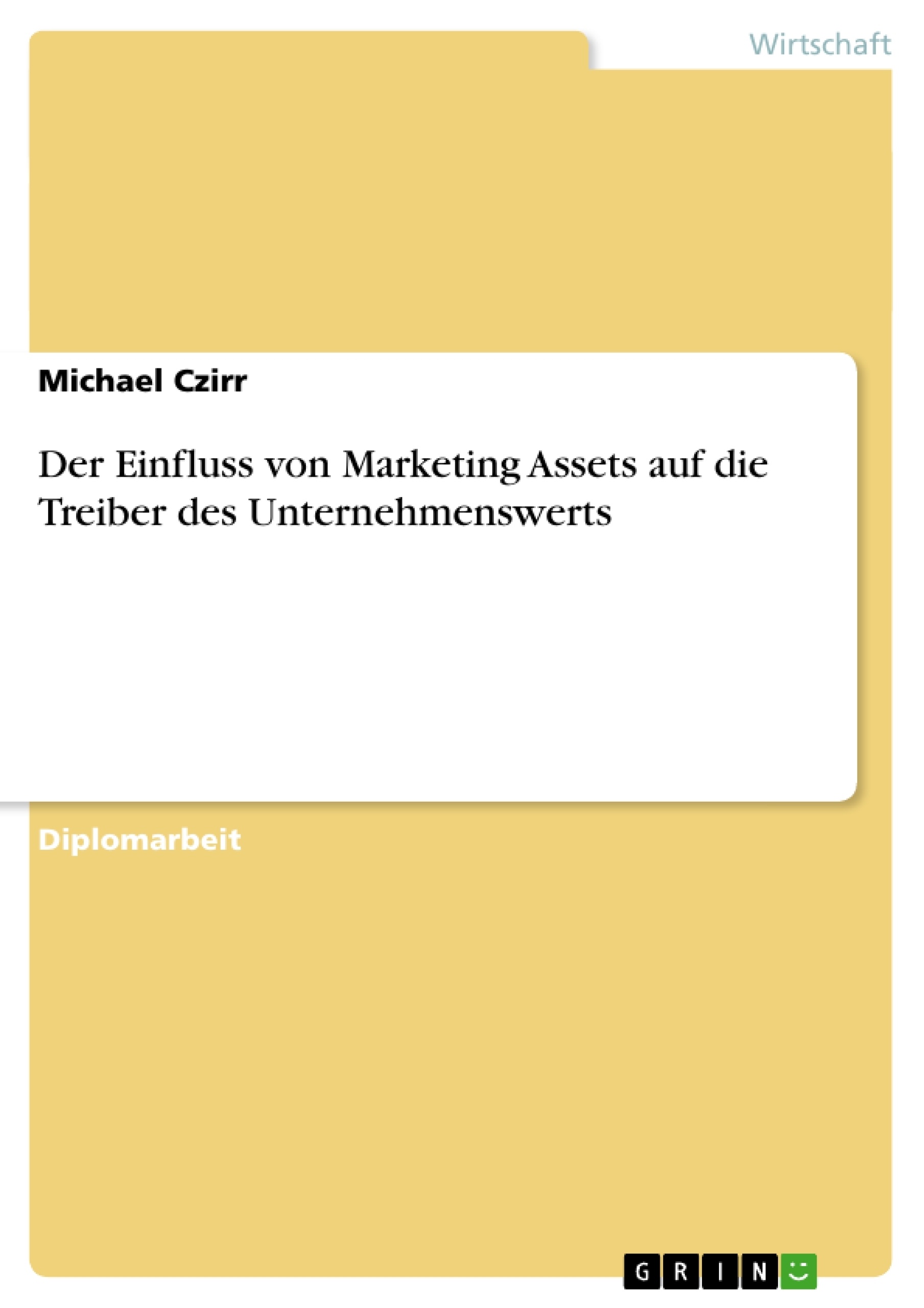Die Beziehung zwischen Top-Management und den Entscheidungsträgern im Marketing
wird heutzutage durch ein Spannungsverhältnis charakterisiert, in dem die Daseinsberechtigungdes Marketings vielfach von der Frage abhängt, ob es zur ökonomischen Wertschöpfung eines Unternehmens beiträgt. Aus der zunehmenden Konzentration auf die Unternehmenswertmaximierung als finales Geschäftsziel folgt, dass alle Unternehmenseinheiten im Wettbewerb um knappe Ressourcen stehen und vornehmlich deren Wertbeitrag zur Rechtfertigung der Budgetallokation dient. [Vgl. Day/Fahey, 1988, S.46] Zusätzliche Brisanz erfährt diese Betrachtung vor dem Hintergrund, dass die Wirkung des Marketings überwiegend in der Entwicklung von intangiblen marktbasierten Vermögenswerten (Marketing Assets) liegt, deren monetäre Bewertung der Makel einer gewissen Subjektivität und Willkür anhängt. Als Konsequenz dieser diffizilen Bewertbarkeit wird das Marketing tendenziell mit zuwenig finanziellen
Mitteln ausgestattet [vgl. Srivastava at al., 1998, S.3f.] und ist im Fall von Kostensenkungsprogrammen regelmäßig als eine der ersten Einheiten betroffen, da es teilweise als wesentlicher Kostenfaktor ohne nachweisbaren Mehrwert wahrgenommen wird [vgl. Erickson/ Jacobson, 1992, S.1265]. Mithin ergibt sich insbesondere für das Marketing die Notwendigkeit, die Bedeutung im Gesamtgefüge der Unternehmensfunktionen zu begründen und diese anhand seines Einflusses auf kapitalmarktnahe Erfolgsgrößen zu belegen. Dieses Spannungsverhältnis aus der Praxis aufgreifend rückte in den 90er Jahren der ökonomische Wertbeitrag von Marketingmaßnahmen in den Fokus der Marketing-Literatur, was sich durch erste empirische Arbeiten zum Einfluss von Marke [vgl. Aaker/Jacobson, 1994]
und Kundenzufriedenheit [vgl. Anderson et al., 1994] auf den Unternehmenserfolg äußerte. Obwohl seitdem eine Reihe von Artikeln zum Zusammenhang von Marketing und finanzwirtschaftlichen
Kennziffern1 veröffentlicht wurde, ist die Relevanz dieser Thematik ungebrochen.
Hierfür sprechen das Marketing Science Institute, das 2002 die Marketing/Finance-Forschung zur Top-Forschungspriorität ausgerufen hat [vgl. Lehmann, 2002, S.18], der fortdauernde Aufruf renommierter Forscher zur Bearbeitung offener Fragen [vgl. Rust et al., 2004b, S.83] und die hohe Anzahl an aktuellen Veröffentlichungen im Marketing/Finance-Bereich [vgl. u.a. McAlister et al., 2007; Fornell et al., 2006; Madden et al., 2006].
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Treiber des Unternehmenswerts
- 2.1 Grundlegende Aspekte zum Unternehmenswert
- 2.1.1 Definition und Relevanz
- 2.1.2 Ermittlung von Unternehmenswerten
- 2.1.2.1 Verfahrensüberblick
- 2.1.2.2 Discounted Cashflow-Verfahren
- 2.1.3 Maximierung des Unternehmenswerts als Management-Konzept
- 2.1.4 Synthese von Bewertungs- und Management-Konzept in Werttreibermodellen
- 2.2 Ansatz nach Miller/Modigliani als studienzentrales Werttreibermodell
- 2.2.1 Theoretische Fundierung
- 2.2.2 Resultierende Annahmen und Implikationen
- 2.2.3 Empirische Evidenz zu finanzwirtschaftlichen Treibern des Unternehmenswerts
- 2.3 Determinanten der identifizierten Werttreiber
- 2.3.1 Grundlegende Erklärungsansätze
- 2.3.1.1 Marktorientierter Ansatz
- 2.3.1.2 Ressourcenbasierter Ansatz
- 2.3.2 Empirische Evidenz zu den Determinanten der identifizierten Werttreiber
- 2.3.2.1 Überblick
- 2.3.2.2 Empirische Erkenntnisse von werttreiberspezifischen Studien
- 3 Marketing Assets als Wertdeterminanten
- 3.1 Konzeptionalisierung der Marketing Assets
- 3.1.1 Hintergrund
- 3.1.2 Definition und Klassifizierung
- 3.1.3 Die Wertschöpfungskette der Marketing Assets
- 3.2 Empirische Evidenz zum Wertbeitrag der Marketing Assets
- 3.2.1 Einfluss der Kundenzufriedenheit auf den Unternehmenserfolg
- 3.2.2 Einfluss der Brand Equity auf den Unternehmenserfolg
- 3.2.3 Einfluss der Werbeausgaben auf den Unternehmenserfolg
- 4 Modellrahmen und Hypothesen der Untersuchung
- 4.1 Modellrahmen
- 4.2 Herleitung der Hypothesen
- 4.2.1 Einfluss der Marketing Assets auf die Profitabilität
- 4.2.2 Einfluss der Marketing Assets auf das Gewinnwachstum
- 4.2.3 Einfluss der Marketing Assets auf die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums
- 5 Empirische Studie
- 5.1 Modellspezifikationen
- 5.1.1 Modellierung der Profitabilität
- 5.1.2 Modellierung des Gewinnwachstums
- 5.1.3 Modellierung der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums
- 5.2 Datengrundlage
- 5.2.1 Vorgehen bei der Datenerhebung
- 5.2.2 Operationalisierung der Variablen
- 5.2.2.1 Finanzwirtschaftliche und sonstige Kennzahlen
- 5.2.2.2 Kundenzufriedenheit
- 5.2.2.3 Brand Equity
- 5.3 Deskriptive Analysen
- 5.4 Modellschätzung
- 5.4.1 Schätzergebnisse zum Modell der Profitabilität
- 5.4.2 Schätzergebnisse zum Modell des Gewinnwachstums
- 5.4.3 Schätzergebnisse zum Modell der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums
- 5.5 Robustheit der Ergebnisse
- 5.5.1 Modell der Profitabilität
- 5.5.2 Modell des Gewinnwachstums
- 5.5.3 Modell der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums
- 5.6 Kritische Würdigung der Ergebnisse
- 6 Implikationen
- 6.1 Beitrag der Studie zur gegenwärtigen Unternehmenspraxis
- 6.2 Beitrag der Studie zur gegenwärtigen Forschung
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss von Marketing Assets auf die Treiber des Unternehmenswerts. Ziel ist es, die Beziehung zwischen verschiedenen Marketing-Ressourcen (wie Kundenzufriedenheit, Brand Equity und Werbeausgaben) und zentralen Werttreibern wie Profitabilität und nachhaltigem Gewinnwachstum zu analysieren. Die Arbeit stützt sich dabei auf ein etabliertes Werttreibermodell und integriert empirische Befunde.
- Der Einfluss von Marketing Assets auf den Unternehmenswert
- Die Identifizierung relevanter Werttreiber
- Die empirische Überprüfung der Hypothesen mittels Regressionsanalysen
- Die Ableitung von Implikationen für die Unternehmenspraxis und zukünftige Forschung
- Die kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien und empirischen Studien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz der Untersuchung des Einflusses von Marketing Assets auf den Unternehmenswert hervorgehoben und die Forschungsfrage formuliert.
2 Treiber des Unternehmenswerts: Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Aspekte des Unternehmenswerts, seine Ermittlung mittels verschiedener Verfahren (insbesondere Discounted Cashflow-Verfahren) und die Maximierung des Unternehmenswerts als Managementkonzept. Es wird das zentrale Werttreibermodell von Miller/Modigliani vorgestellt und dessen theoretische Fundierung sowie empirische Evidenz diskutiert. Die Kapitel analysiert zudem die Determinanten der identifizierten Werttreiber, sowohl aus marktorientierter als auch ressourcenbasierter Perspektive, inklusive einer umfassenden Darstellung der empirischen Befunde.
3 Marketing Assets als Wertdeterminanten: Dieses Kapitel definiert und klassifiziert Marketing Assets und analysiert deren Wertschöpfungskette. Es werden die empirischen Befunde zum Wertbeitrag von Kundenzufriedenheit, Brand Equity und Werbeausgaben auf den Unternehmenserfolg im Detail dargestellt und eingeordnet.
4 Modellrahmen und Hypothesen der Untersuchung: Das Kapitel beschreibt den entwickelten Modellrahmen der Untersuchung und leitet daraus die zentralen Hypothesen ab. Hier wird der Einfluss der Marketing Assets auf die Profitabilität, das Gewinnwachstum und die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums untersucht und in konkrete Hypothesen übersetzt.
5 Empirische Studie: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Studie. Es beschreibt die Modellspezifikationen, die Datengrundlage (einschließlich Datenerhebung und Operationalisierung der Variablen), die deskriptiven Analysen und die Ergebnisse der Modellschätzungen. Weiterhin werden die Robustheit der Ergebnisse und eine kritische Würdigung der Befunde vorgenommen.
Schlüsselwörter
Unternehmenswert, Werttreiber, Marketing Assets, Kundenzufriedenheit, Brand Equity, Werbeausgaben, Profitabilität, Gewinnwachstum, Nachhaltigkeit, Miller/Modigliani, empirische Studie, Regressionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Einfluss von Marketing Assets auf die Treiber des Unternehmenswerts
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss von Marketing Assets (wie Kundenzufriedenheit, Brand Equity und Werbeausgaben) auf die Treiber des Unternehmenswerts, insbesondere Profitabilität und nachhaltiges Gewinnwachstum. Es wird analysiert, wie diese Marketing-Ressourcen den Unternehmenswert beeinflussen.
Welches Werttreibermodell wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das etablierte Werttreibermodell von Miller/Modigliani. Dieses Modell wird detailliert vorgestellt, seine theoretische Fundierung erläutert und die empirische Evidenz dazu diskutiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analyse mit empirischen Methoden. Die empirische Überprüfung der Hypothesen erfolgt mittels Regressionsanalysen. Die Datengrundlage wird detailliert beschrieben, inklusive der Operationalisierung der Variablen (Finanzkennzahlen, Kundenzufriedenheit, Brand Equity).
Welche Marketing Assets werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Marketing Assets: Kundenzufriedenheit, Brand Equity und Werbeausgaben. Der Wertbeitrag jedes einzelnen Assets wird separat untersucht und eingeordnet.
Welche Variablen werden im Modell berücksichtigt?
Das Modell umfasst Marketing Assets (Kundenzufriedenheit, Brand Equity, Werbeausgaben) als unabhängige Variablen und Profitabilität, Gewinnwachstum und die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums als abhängige Variablen. Die Beziehung zwischen diesen wird mittels Regressionsanalysen untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Treiber des Unternehmenswerts, Marketing Assets als Wertdeterminanten, Modellrahmen und Hypothesen, Empirische Studie, Implikationen und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die empirische Studie präsentiert die Ergebnisse der Regressionsanalysen zum Einfluss der Marketing Assets auf Profitabilität, Gewinnwachstum und die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums. Die Robustheit der Ergebnisse wird geprüft und kritisch gewürdigt.
Welche Implikationen werden abgeleitet?
Die Arbeit leitet Implikationen für die gegenwärtige Unternehmenspraxis und zukünftige Forschung ab. Es wird diskutiert, wie die Ergebnisse für verbesserte strategische Entscheidungen im Marketing und im Management genutzt werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unternehmenswert, Werttreiber, Marketing Assets, Kundenzufriedenheit, Brand Equity, Werbeausgaben, Profitabilität, Gewinnwachstum, Nachhaltigkeit, Miller/Modigliani, empirische Studie, Regressionsanalyse.
Wo finde ich detaillierte Informationen zur Methodik der Datenerhebung und -aufbereitung?
Kapitel 5 ("Empirische Studie") beschreibt detailliert die Datengrundlage, das Vorgehen bei der Datenerhebung und die Operationalisierung der Variablen (inklusive Finanzkennzahlen, Kundenzufriedenheit und Brand Equity).
Wie wird die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums operationalisiert?
Die Operationalisierung der Variablen, einschließlich der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums, wird in Kapitel 5.2.2 ("Operationalisierung der Variablen") ausführlich erklärt.
- Quote paper
- Michael Czirr (Author), 2008, Der Einfluss von Marketing Assets auf die Treiber des Unternehmenswerts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111740