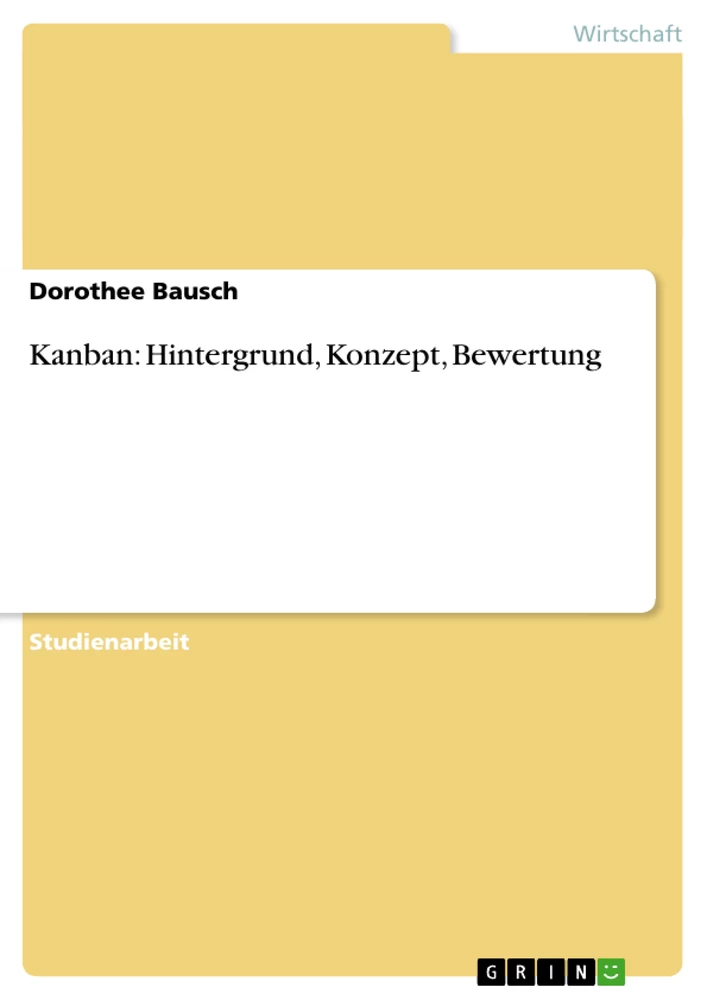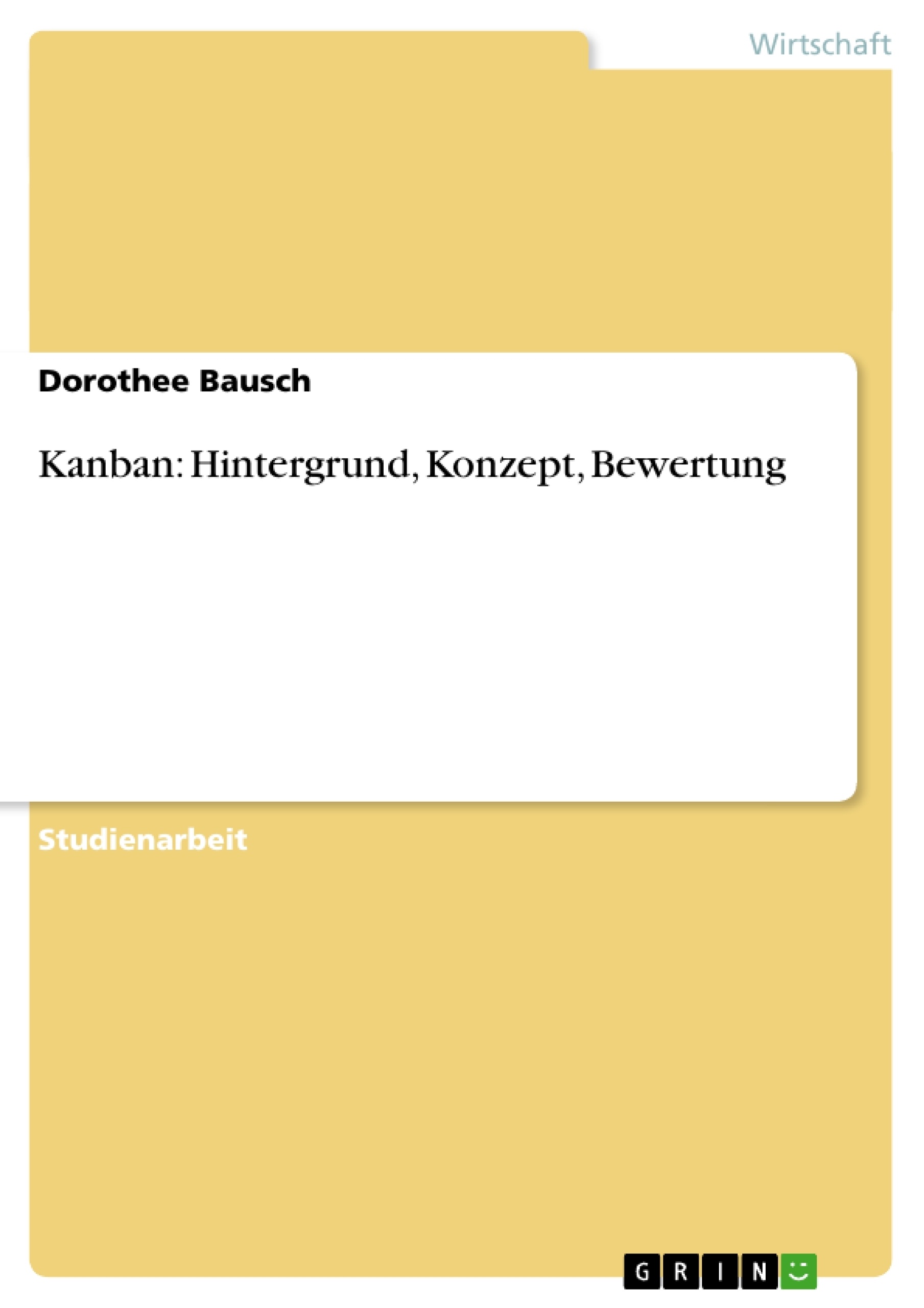Die Niederlage im pazifischen Krieg in den 50er Jahren führte bei den Japanern dazu, dass sie das Gefühl hatten, ein Land mit knappen Ressourcen zu sein und daher Verschwendung zu vermeiden sei. Unter diesem Eindruck stehend, galt es nun ein Konzept zu entwickeln, dass dieses erfüllen konnte. Als Vorreiter zeigte sich der japanische Automobilkonzern Toyota, der unter der Führung von Taiichi Ohno das sogenannte Kanban-System entwickelte, welches im Jahr 1962 im gesamten Unternehmen implementiert wurde – zu einer Zeit als sich Japan in vollem Wachstum befand. Die Einführung dieses Konzeptes sollte dazu dienen, den Materialfluss in der Montage bei möglichst geringer Nutzung der dafür benötigten Ressourcen sicherzustellen. In den 70er Jahren fand dieses Konzept seinen Weg nach Europa und hat sich als ein geeignetes Instrumentarium gegen die Verschwendung von Ressourcen erwiesen.
Hintergrund:
Konzept:
Anwendungsbeispiel:
Bewertung:
Literatur und Internetquellen:
Kanban
Hintergrund:
Die Niederlage im pazifischen Krieg in den 50er Jahren führte bei den Japanern dazu, dass sie das Gefühl hatten, ein Land mit knappen Ressourcen zu sein und daher Verschwendung zu vermeiden sei. Unter diesem Eindruck stehend, galt es nun ein Konzept zu entwickeln, dass dieses erfüllen konnte. Als Vorreiter zeigte sich der japanische Automobilkonzern Toyota, der unter der Führung von Taiichi Ohno das sogenannte Kanban-System entwickelte, welches im Jahr 1962 im gesamten Unternehmen implementiert wurde – zu einer Zeit als sich Japan in vollem Wachstum befand. Die Einführung dieses Konzeptes sollte dazu dienen, den Materialfluss in der Montage bei möglichst geringer Nutzung der dafür benötigten Ressourcen sicherzustellen. In den 70er Jahren fand dieses Konzept seinen Weg nach Europa und hat sich als ein geeignetes Instrumentarium gegen die Verschwendung von Ressourcen erwiesen.
Konzept:
Kanban ist der japanische Ausdruck für Karte oder Schild (siehe Abb. 1). Diese Karte – häufig ein Stück Papier in einer Plastikhülle – ist ein Informationsträger und enthält in der Regel folgende Daten (vgl. Kamiske, Brauer 2003, S. 103f.):
- Name und Identnummer des Teils oder Artikels;
- Skizze der Teile;
- Behälterart und Anzahl der Teile pro Behälter;
- Herkunft der Teile (herstellende Abteilung oder Lieferant);
- Empfänger der Teile (verbrauchende Abteilung oder Kunde);
- Registriernummer und laufende Nummer des Kanbans;
- Abholzeit (Zeitpunkt, wann die Teile zum Abholen bereitgestellt sein müssen);
- ggf. zusätzliche Informationen (z.B. Arbeitsanweisungen, Prozessparameter).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Kanban-Karte (http://www.ebz-beratungszentrum.de/...)
Das Kanban-System ist „ein auf Karten basierendes Instrument zur Steuerung des Material- und Informationsflusses auf Werkstattebene (Fertigungssteuerung). Das Kanban-System übt keine Organisationsfunktion aus, es ist lediglich ein Steuerungsinstrument, welches angewendet wird, um ein Produktionssystem nach dem Just-in-Time-Prinzip zu erreichen“ (Kamiske, Brauer 2003, S. 99f.). Nach dem Holprinzip entnimmt der nachgelagerte Arbeitsgang beim vorgelagerten „nur das gerade benötigte Teil in der benötigten Menge und zum benötigten Zeitpunkt“ (http://www.ebz-beratungszentrum.de/...). Wie Abbildung 2 zeigt, erfolgt die Produktionssteuerung nach dem Kanban-Prinzip in einem Regelkreissystem aus sich selbst steuernden Regelkreisen. Die durchgängigen Pfeile stellen den Materialfluss und die gestrichelten Pfeile den Informationsfluss dar. Zwischen den einzelnen Fertigungsstufen (hier z.B.: Rohmaterial, Rohbearbeitung, Feinbearbeitung, Vormontage und Endmontage) liegen Zwischenlager und ganz am Ende das Fertiglager. Die Kanban-Karte dient dazu, „die Aktivitäten innerhalb des Produktionsprozesses in Form einer rückläufigen Informations-flusskette und einer vorwärtslaufenden Materialflusskette“ (Kamiske, Brauer 2003, S. 104) miteinander zu verknüpfen und kommt zwischen einer Quelle, die Material anliefert und einer Senke, die dieses Material verbraucht zum Einsatz. Bei diesem Vorgang kann die Kanban-Karte allerdings nicht über mehrere Regelkreise hinweg laufen. Die jeweiligen Zwischenlager können sowohl Quelle als auch Senke sein. Daraus resultieren „zwei Ausprägungen von Regelkreisen und damit auch (...) zwei grundsätzliche Arten von Kanban-Karten. Der Fertig-ungs-Kanban kursiert zwischen einer produzierenden Stelle (Quelle) und dem Zwischenlager (Senke), der Verbrauchs- oder Transport-Kanban (…) zwischen dem Zwischenlager (Quelle) und einer verbrauchenden Stelle (Senke)“ (Kamiske, Brauer 2003, S. 104).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Produktionssteuerung nach Kanban (http://www.ebz-beratungszentrum.de/...)
[...]
- Quote paper
- Dorothee Bausch (Author), 2006, Kanban: Hintergrund, Konzept, Bewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111591